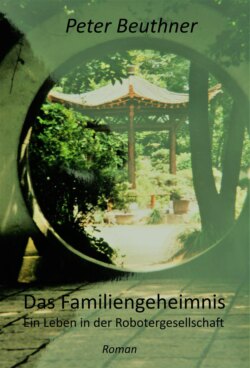Читать книгу Das Familiengeheimnis - Peter Beuthner - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Stammtisch
ОглавлениеEs war eine illustre Herrenrunde, die da in der traditionsreichen Brauereiwirtschaft in Söflingen, einem Stadtteil im Westen Ulms, zusammensaß. Sie trafen sich jeden Monat einmal dort und klönten dann einen Abend lang bei Bier und einer kräftigen Brotzeit über Gott und die Welt. Qiang war, schon kurz nachdem er sich in Ulm niedergelassen hatte, von Klaus Eppelmann in diese Gesellschaft eingeführt worden.
Neben Qiang zur Linken saß Jochen Grüner, ein Mitfünfziger, der seinem Namen alle Ehre machte, denn er setzte sich vehement für die Belange der Grünen-Partei in der Kommunal- und Landespolitik ein. Er war von schlanker, fast hagerer Gestalt, ernährte sich weitgehend von biologisch hochwertigen Nahrungsprodukten und hielt sich körperlich fit durch jede Menge sportliche Betätigungen. Er hatte eine spitze Nase, spitzes Kinn, etwas streng guckende Augen und volles braunes Haar.
Links daneben saß Gunter Guter, Professor für Geriatrie an der Universität Ulm, der wegen seiner recht ordentlichen Leibesfülle und seines runden, meist roten und immer etwas aufgedunsenen Gesichtes schon rein äußerlich einen starken Kontrast zu Jochen Grüner bildete. Er war ein sehr gemütlich aussehender, älterer Herr von ungefähr sechzig Jahren, der sich offenbar durch Nichts aus der Ruhe bringen ließ.
Daneben saß Manfred Medent, eine sehr gepflegte Erscheinung, immer modern und bestens gekleidet. Er war Zahnarzt und erfreute sich dank seiner anerkannten Fähigkeiten bei der Zahnbehandlung eines großen Patientenzustroms.
Neben ihm saß Ralf Gerngroß, der zweite Kommunalpolitiker in dieser Runde, Mitglied des Stadtrates und Baudezernent von Ulm. Er war ein kräftiger, aber etwas untersetzter Mann von knapp über vierzig Jahren mit leicht exaltiertem Benehmen, mit dem er vermutlich seine evidenten Minderwertigkeitskomplexe zu überspielen versuchte. Er trug stets Schuhe mit sehr hohen Absätzen, und sein schon recht schütteres Haar versuchte er offenbar durch einen mächtigen Schnauzbart zu kompensieren.
Zu seiner Linken saß der weit über die Ulmer Region hinaus bekannte Architekt Karl Hausmann, der mit seinem großen Architekturbüro schon viele Aufträge für die Stadt ausgeführt hat. Es waren zumeist Objekte, die schon wegen ihrer exponierten Lage, vor allem aber auch wegen ihrer schon fast genial anmutenden Gestaltung beeindruckende Akzente in der Stadt setzten. Karl Hausmann war fünfundvierzig, mittelgroß, wohlproportioniert, hatte kurze blonde Haare und einen Blick, der irgendwie immer in die Ferne gerichtet schien und ihm einen merkwürdig gedankenvollen, fast verträumten oder gar wehmütigen Gesichtsausdruck verlieh. Er schien sich unentwegt mit seiner Umgebung gestalterisch auseinanderzusetzen, immer kritisch prüfend, häufig mißbilligend und immer nach einer besseren Lösung suchend.
Neben ihm saß Volker Ungerecht, der Landgerichtspräsident von Ulm, ein sehr jovialer älterer Herr so um die Sechzig von mittelgroßer, etwas rundlicher Figur mit ernstem Blick, aber sehr freundlichem Wesen. Sie nannten ihn manchmal scherzhaft „Richter Gnadenlos“, obgleich er in seinen Urteilen weder ungerecht noch gnadenlos war. Im Gegenteil, gerade weil er schon einen so ungeliebten Namen trug, bemühte er sich immer ganz besonders, größte Gerechtigkeit walten zu lassen. Er war ein sehr guter Zuhörer, analysierte messerscharf und schlußfolgerte dann äußerst konsequent, aber immer fair.
Der Letzte in dieser Runde, zwischen Volker Ungerecht und Klaus Eppelmann sitzend, war Adrian Musenmann, der Theater-Intendant Ulms, ein äußerst geselliger Mensch, der immer wieder, wenn ihm das Gesprächsthema zu einseitig oder zu langweilig wurde, einen Witz einfließen ließ und auf diese Weise die Stimmung wieder auflockerte. Er war so ungefähr Fünfundvierzig, groß, schlank, hatte ein sehr ausdrucksstarkes, schönes Gesicht mit unübersehbar femininen Zügen, dazu fast schulterlange dunkelblonde Locken. Die waren allerdings nicht echt. Ihm war kein Aufwand zu groß, um sich seine Haare regelmäßig locken und frisieren zu lassen.
Einer fehlte heute in der Runde, Artur Weise, Professor für Philosophie an der Universität Ulm. Er kurierte gerade eine Grippe aus.
„Heute geht die Runde auf meine Kosten“, sagte Manfred Medent, nachdem alle Platz genommen hatten. Er war letzte Woche dreiundvierzig geworden, und für seinen Geburtstag mußte er nun nach alter Gepflogenheit einen ausgeben. Das hatte sich im Laufe der Zeit seit Bestehen dieser Stammtischrunde einfach so eingespielt, und davor konnte sich keiner drücken.
„Es ist doch immer wieder schön, wenn einer Geburtstag hat“, freute sich Adrian Musenmann, um dann nach einer bewußt eingelegten Pause zu ergänzen: „jedenfalls, wenn es ein anderer ist“. Dann lachte er laut auf und schaute sich beifallheischend um. „Wenn man selber Geburtstag hat, dann hat man auch selbst den ganzen Aufwand und die Kosten. Da macht es schon gleich keinen Spaß mehr!“
„Also, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht“, erwiderte Manfred Medent, „wenn wir schon mal in der Kneipe sitzen, dann ist es doch überhaupt kein Aufwand für uns! Aber du denkst wahrscheinlich wieder ans Geld, du Geizhals, dabei könntest du dir das bei deinem Einkommen locker leisten.“
„Du scheinst dich ja gut auszukennen, was mein Einkommen anbetrifft. Aber Spaß beiseite, ich freue mich einfach darauf, einen gutverdienenden Zahnarzt heute mal so richtig schädigen zu können.“
„Tu das ruhig, Adrian, solange du noch richtig beißen kannst. Spätestens nach deinem nächsten Besuch in meiner Praxis könnte das schon ganz anders aussehen.“
Allgemeines Gelächter.
„Siehst du, Adrian, mit seinem Zahnarzt sollte man es sich möglichst nicht verscherzen. Irgendwann sitzt du wieder ganz kleinlaut und mickrig in seinem Sessel, und dann hast du in jedem Fall das Nachsehen“, frotzelte Gunter Guter.
„Ja, ja, ich weiß, es soll ja immer wieder Leute geben, die ihre Position schamlos zum Nachteil ihrer Mitmenschen ausnutzen“, sinnierte Adrian. „Dafür habe ich leider den falschen Beruf gewählt. Ich könnte euch höchstens mit einer schlechten Inszenierung ärgern, wenn ihr Kulturbanausen überhaupt ins Theater ginget.“
Inzwischen war die erste Runde Bier gekommen, und alle erhoben ihr Glas, um auf das Wohl des Geburtstagskindes anzustoßen. „Ex!“ rief Adrian, und kippte sein Glas in einem Schluck hinunter. „Hm . . ., das erste Bier läuft immer ganz besonders gut“, sagte er betont schwärmerisch, während er der Bedienung Zeichen gab, ein neues Bier zu bringen. Und wie er die Bedienung noch so anschaute, fiel ihm spontan ein Witz ein: „Mal aufgepaßt, Leute! Ihr seid doch alle verheiratet – und das schon seit mehr oder weniger vielen Jahren. Da habt ihr doch garantiert alle das gleiche Problem!“
„Was für ein Problem?“ wollten einige wissen.
„Also, dann hört mal zu. Dann könnt ihr nämlich auch gleich lernen, wie man damit umgeht: Ein Ehepaar schlendert gemütlich durch den Zoo, schaut sich hier die Elefanten, da die Giraffen, dort die Löwen an, und so weiter, und so weiter. Dann kommen sie zu den Affen. In einem Käfig sitzt ein ausgewachsener Gorilla und stiert apathisch in die Gegend. ‚Schau mal, der arme Kerl sitzt da die ganze Zeit alleine rum und langweilt sich‘, sagt der Mann zu seiner Frau. ‚Ja, der sieht auch irgendwie traurig aus, finde ich‘, antwortet die Frau. Nach kurzer Überlegung sagt der Mann zu seiner Frau: ‚Wir könnten ihn ja mal ein bißchen aufmuntern. Was hältst du davon‘? ‚Wie willst du das denn machen‘? fragt die Frau. ‚Na ganz einfach‘, sagt er, ‚mach doch mal deine Bluse auf und zeig ihm deinen Busen! Ich möchte wetten, daß der ganz schnell aufhört, zu dösen‘. ‚Du hast verrückte Ideen‘! brüskiert sich die Frau. ‚Ich kann mich doch hier nicht in aller Öffentlichkeit ausziehen‘! ‚Du sollst dich ja auch nicht ausziehen‘, beruhigte er sie, ‚sondern nur ein bißchen von deinem Busen zeigen. Außerdem ist doch hier weit und breit kein Mensch in der Nähe‘! ‚Na weißt du, . . .‘ murmelte sie und öffnete zögernd ihre Bluse. ‚Ja komm, ein bißchen mehr kannst du ihm schon noch zeigen‘! ermutigte ihr Mann sie ungeduldig. Sie stellte sich direkt vor den Gorilla und öffnete ihre Bluse noch etwas weiter. ‚Ah! Schau nur‘, rief ihr Mann erfreut, ‚er zeigt schon die ersten Regungen! Komm, laß noch etwas sehen‘!
Der Gorilla zeigte anscheinend tatsächlich Interesse, denn er stierte nicht mehr dösig in die Gegend, sondern starrte mit großen Augen auf die Frau. Plötzlich sprang er auf und kam ganz nah an das Gitter. ‚Vielleicht hebst du den Rock mal etwas hoch‘, schlug der Mann vor. Sie hob den Rock und zeigte ihre Oberschenkel. Der Gorilla wurde sehr unruhig und rüttelte aufgeregt an den Gitterstäben, während er gierig die Frau fixierte. ‚Siehst du, es funktioniert‘, rief der Mann ganz begeistert. ‚Ich wußte doch, daß wir dem ein bißchen Spaß bringen können. Komm, zeig ihm noch etwas mehr‘! Die Frau fummelte gerade noch an ihrem Rock herum, als ihr Mann sie plötzlich packte, die Käfigtür aufriß und sie hineinschubste. Dann schloß er die Tür eiligst wieder und rief ihr lachend und triumphierend zu: ‚So, und jetzt zeig mir mal, wie du dem Gorilla beibringst, daß du Migräne hast‘! Ha, ha!“
Schallendes Gelächter. Ausgelassene Stimmung. Die Herren hielten sich die Bäuche vor Lachen, während die Bedienung das Essen brachte. Besonders Adrian wieherte förmlich über seinen eigenen Witz. Die Bedienung schaute derweil etwas irritiert in die Runde, denn sie glaubte zu erahnen, die Herren könnten möglicherweise einen Scherz auf ihre Kosten gemacht haben.
„Keine Sorge, wir lachen nicht über Sie“, bemühte sich Gunter Guter, der ihr verdutztes Gesicht bemerkt hatte, sogleich um eine Erklärung.
„Männerwitze!“ murmelte die Bedienung verächtlich vor sich hin und verschwand, nachdem sie alles serviert hatte.
„Köstlich!“ amüsierte sich auch Ralf Gerngroß. „Wie aus dem richtigen Leben!“
Nur Jochen Grüner konnte nicht über den Witz lachen. Im Gegenteil, er fand ihn albern, blöd und überdies unlogisch, weil ja die Zoobesucher die Käfigtore überhaupt nicht öffnen können. Im übrigen empfand er ihn auch als frauenfeindlich. Aber dafür fand er bei seinen Stammtischbrüdern kein Verständnis. Immer noch lachend machten die sich über ihr Essen her. Und Adrian konnte es sich nicht verkneifen, ihn „Spaßbremse“ zu nennen.
„Apropos einlochen“, wandte sich Karl Hausmann an Qiang, nachdem sich die Herren wieder beruhigt hatten, „hast du nicht Lust, mit dem Golfen anzufangen? Ich wette, du wirst begeistert sein, wenn du erst mal den Einstieg gefunden hast.“
„Das mag schon sein“, antwortete dieser nach kurzer Überlegung. „Ich fürchte nur, ich werde nicht genügend Zeit dafür haben, um hinreichend oft spielen zu können und die notwendigen Fortschritte zu machen. Und immer nur als Anfänger auf dem Platz herumzulaufen, habe ich wirklich keine Lust.“
„Ach komm, überleg´s dir nochmal. Wenn du ein bißchen Talent hast, und davon gehe ich bei dir aus, und ein paar Trainerstunden nimmst, was ja finanziell bei dir kein Problem sein dürfte, dann hast du das ziemlich schnell drauf. Und ich garantiere dir, du wirst so begeistert sein, daß du gar nicht wieder aufhören möchtest.“
„Ja, das fürchte ich ja gerade! Soviel Zeit, wie ich dann dafür brauchte, habe ich einfach nicht. Ich bin sehr viel dienstlich unterwegs, wie du weißt, und außerdem habe ich auch sonst noch genügend andere Verpflichtungen. Beim besten Willen, ich kann mir kein zeitaufwendiges Hobby mehr leisten."
„Du könntest ja mal einen deiner Roboter auf den Rasen schicken, Qiang, das wäre doch eine echte Gaudi, oder?“ warf Adrian Musenmann ein.
Allgemeines Gelächter.
„Der Adrian! Der hat immer ausgefallene Ideen!“ amüsierte sich Gunter Guter.
„Wieso? So absurd ist die Idee gar nicht!“ wandte Klaus Eppelmann ein. „Die Roboter von Qiang sind kolossal leistungsstark, und präzise sowieso. Warum sollen die nicht auch Golf spielen können? Ich möchte sogar fast wetten, der Karl hat keine Chance, gegen so einen Roboter zu gewinnen.“
„Top, die Wette steht!“ wollte Adrian Musenmann die Sache sogleich perfekt machen.
„Halt, halt! So schnell schießen die Preußen nun auch wieder nicht“, versuchte Klaus Eppelmann zu bremsen. „Zuerst müßten Qiang und Karl ja überhaupt erst mal zustimmen, ob sie so einen Wettkampf machen wollen. Und dann müßte Qiang auch erst mal so ein Ding entsprechend programmieren, denn bisher haben die so etwas ja noch nicht gemacht. Das wäre ja eine ganz neue und sicherlich nicht ganz einfache Aufgabenstellung für die Dinger. Deshalb ließe sich das wahrscheinlich auch nicht so schnell realisieren.“
„Was meinst du denn dazu, Qiang?“ fragte Karl Hausmann. „Hältst du das für möglich?“
Qiang hatte sich die Sache schon, während die anderen noch darüber debattierten, durch den Kopf gehenlassen und war zu dem Ergebnis gekommen, daß er das eigentlich hinkriegen müßte: „Ich finde die Idee ganz amüsant – und zugleich reizvoll. Ja, ich hätte nicht schlecht Lust, mal so einen Versuch zu unternehmen.“
„Also: Top, die Wette gilt!“ fuhr Adrian Musenmann gleich wieder dazwischen.
„Was meinst du, Karl?“ fragte Qiang. „Würdest du – vorausgesetzt, ich kriege die Sache hin – gegen den Roboter antreten?“
„Bei allem Respekt vor deinen technischen Fähigkeiten, Qiang, aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so recht daran, daß man einen Roboter befähigen kann, so anspruchsvolle Bewegungsabläufe und so präzise Schläge auszuführen.“
„Also: Top, die Wette gilt!“ wiederholte Adrian Musenmann. „Um was wettet ihr? Aber nicht kleinlich sein, es geht immerhin um eine bedeutende Sache!“
„Ja, Moment mal“, entrüstete sich Karl Hausmann. „Die Wettidee war ja nicht von uns, sondern von Klaus. Den mußt du fragen, was er ausgeben will, wenn ich gewinne!“
„Also Klaus, was gibst du aus?“ fragte Adrian Musenmann.
„Na, das kommt jetzt alles ein bißchen überraschend für mich. Darauf war ich jetzt gar nicht gefaßt“, sagte Klaus Eppelmann nachdenklich. „Ja, was könnte ich denn da mal springen lassen?“ murmelte er leise vor sich hin.
„Also, da gibt’s doch nicht viel zu überlegen!“ rief Adrian Musenmann. „Das ist doch ein Riesenereignis! Das muß natürlich ordentlich gefeiert werden! Mit so einem kleinen Essen, wie der Manfred uns hier heute abspeist, kommst du dabei natürlich nicht davon! Da machen wir eine richtige Sause!“
„Nein, Adrian“, widersprach Qiang, „jetzt wollen wir das mal nicht übertreiben und aus einem spontanen Einfall gleich eine riesig teure Staatsaktion machen. Also, das muß schon alles im Rahmen bleiben!“
„Da bin ich nicht deiner Meinung. Klaus ist ja schließlich nicht irgendwer, der mal eben was daher schwätzt, das er gleich wieder bereuen müßte. Der wußte sehr genau, was er sagt, als er die Wette anbot“, erwiderte Adrian ziemlich vorlaut.
„Ja, sicher weiß der Klaus sehr genau, was er sagt. Aber da war doch von einem großen Fest überhaupt keine Rede! Man kann ja auch einfach um ´ne Flasche Schampus wetten“, entgegnete Qiang, dem es offensichtlich etwas peinlich war, daß da jetzt so eine große Affäre aus einer flüchtigen Bemerkung gemacht wurde.
„Noi, noi! So billig kommt ihr nicht davon!“ beharrte Adrian Musenmann auf gut Schwäbisch.
Jetzt versuchte Volker Ungerecht zu vermitteln: „Also Leute! Jetzt kloppt euch hier nicht noch wie die Kesselflicker! Laßt uns mal einen vernünftigen Deal machen. Zunächst mal die Fakten: Klaus, du stehst doch noch zu deinem Wettangebot, oder?“
Klaus Eppelmann nickte zustimmend. Einen Rückzieher konnte und wollte er sich jetzt nicht mehr leisten.
„Okay. Dann haben wir zwei, die gegeneinander antreten wollen – einen, vertreten durch seinen Roboter, und den anderen höchst persönlich. Richtig?“ und dabei schaute er Qiang und Karl Hausmann an.
Beide nickten.
„So weit so gut. Jetzt müssen wir noch die Konditionen aushandeln, sprich: einen Zeitpunkt für die Durchführung ausmachen und den Wettpreis festlegen. Und hier bin ich der Meinung, daß der Wettpreis vom Wettanbieter festgelegt wird und von niemand anderem!“ sagte er ziemlich resolut und sah dabei Adrian Musenmann mit ernstem, keinen Widerspruch duldendem Blick in die Augen, bevor er sich Qiang zuwandte. „Kannst du schon eine Aussage treffen, wann du mit deinem Roboter soweit bist, Qiang?“
„Nein, und da möchte ich euch auch um etwas Nachsicht bitten. Die Idee ist gerade erst geboren. Bisher gibt es meines Wissens keinen golf-spielenden Roboter auf der Welt, das Thema ist also auch insofern neu. Jetzt müßt ihr mich zu Hause erst mal ein bißchen darüber nachdenken lassen, wie sich so etwas realisieren läßt. Also kurzum, ich nehme das jetzt als Aufgabe mit nach Hause, und bei unserem nächsten Stammtisch werde ich euch den frühest möglichen Termin nennen. Einverstanden?“
„Ja, das ist in Ordnung“, übernahm Volker Ungerecht gleich wieder die Verhandlungsführung. „Ich denke, wir alle hier sind sehr interessiert an Verlauf und Ausgang der Wette, und ich glaube für alle zu sprechen, wenn ich sage, daß wir hierfür einen Termin finden müssen, an dem alle von uns teilnehmen können. Das will sich sicher niemand entgehen lassen. Ist doch richtig, oder?“
Allgemein zustimmendes Gemurmel.
„Klar, Mensch!“ übertönte Adrian Musenmann lautstark das Gemurmel. „Das wird doch das Ereignis des Jahres hier in Ulm – ach, was sage ich Ulm, das wird ein Welt-Ereignis! Leute, wir müssen das überall publik machen! Ich sage euch, das geht um die ganze Welt! Genau wie damals der erste Schach-Wettkampf von Weltmeister Kasparow – hm . . . , ja, ich glaube jedenfalls, so hieß der – gegen einen Computer.“
„Also bevor jetzt hier die Euphorie ganz und gar mit euch durchgeht, möchte ich doch sehr darum bitten, die Sache nicht so hochzuhängen“, gab Qiang bescheiden zu bedenken. Bisher wissen wir noch nicht einmal, ob es überhaupt funktionieren wird! Und dann möchte ich einen solchen Versuch auf jeden Fall auch erst einmal ganz im Stillen durchführen. Dafür müßt ihr Verständnis haben. Ich will auf keinen Fall ein riesiges Spektakel, an dessen Ende ich möglicherweise total blamiert dastehe. Also laßt uns erst mal im Stillen sehen, ob es funktioniert und wie es läuft, und danach sehen wir weiter.“
„Ja, ich denke, das müssen wir akzeptieren“, unterstützte ihn Volker Ungerecht denn auch sofort. „Bleibt noch der letzte Punkt zu klären: Hast du dir inzwischen überlegt, was dir die Sache wert ist, Klaus?“
„Hm, ich könnte mir vorstellen, daß ich – wenn wir dann, wahrscheinlich an einem Sonntag, bei schönem Wetter und bester Laune alle auf dem Golfplatz sind und Zeugen dieses großen Ereignisses unter Ausschluß der Öffentlichkeit werden – daß ich dann die kulinarische Unterstützung dazu liefere.“
„Also eine Champagner-Party?!“ ergänzte Adrian Musenmann.
„Von mir aus – nenn’ es so“, willigte Klaus Eppelmann schließlich ein.
„Damit haben wir dann wohl alles Notwendige festgelegt“, resümierte Volker Ungerecht, „oder haben wir noch etwas vergessen?“
„Vielleicht müssen noch ein paar Details zum Ablauf des Wettkampfes besprochen und abgestimmt werden?“ antwortete Qiang. „Ich weiß es nicht, dazu kenne ich mich mit dem Golfen zu wenig aus. Aber das hat dann sicher auch noch Zeit. Zuerst wollen wir mal sehen, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Und dafür reichen zunächst mal die bisher getroffenen Vereinbarungen.“
„Na, denn man Prost, meine Herren!“ schloß Volker Ungerecht den Prozeß ab. „Ich bin schon sehr gespannt auf den Ausgang der Wette, wirklich sehr gespannt!“
Jochen Grüner, der die ganze Zeit über recht still die Auseinandersetzung verfolgt hatte, meldete sich jetzt etwas nachdenklich zu Wort: „Jetzt nimmst du uns mit deinen Robotern also nicht nur die Arbeitsplätze weg, sondern auch noch unsere Freizeitbeschäftigung!“
Allgemeines Gelächter.
„Na, ist doch wahr!“ verteidigte Jochen Grüner seine Hypothese. „Wo man hinguckt – überall sind Computer und Roboter am Werkeln! Was bleibt denn da noch für uns Menschen? Wenn sich das so weiterentwickelt, sitzen wir nur noch im Lehnstuhl und schieben Langeweile.“
„Was ja auch nicht schlecht wäre – solange die Dinger für uns schaffen und unseren Wohlstand erhalten oder sogar mehren“, bemerkte Ralf Gerngroß.
„Also in meinem Theater wird es keine Roboter geben!“ rief Adrian Musenmann. „Jedenfalls nicht, solange ich das Sagen habe!“
„So weit wird es ja wohl hoffentlich auch nicht kommen“, wandte Gunter Guter ein. „So gut und hilfreich die Dinger sind, vor allem bei monotonen, stereotypen oder gar stupiden Tätigkeiten, aber erstens werden sie den Menschen sicher niemals in allen Dingen ersetzen können, davon bin ich jedenfalls felsenfest überzeugt, und zweitens dürfen sie den Menschen auch gar nicht überall ersetzen! Da müssen wir alle im eigenen Interesse höllisch aufpassen! Denn wenn wir nur noch untätig herumsitzen, dann werden wir sehr schnell verblöden. Nein, wir müssen uns fit halten, körperlich und geistig. Also brauchen wir für beides entsprechende Betätigungen – ein Leben lang. Deshalb ist es nur richtig, daß sich jeder zusätzlich zu der Grundversorgung noch etwas dazu verdienen muß, um sein Leben angenehm und komfortabel zu gestalten – womit auch immer, das bleibt seine Entscheidung, aber er muß was tun, um sich körperlich und geistig fit zu halten. Faulenzer und Nichtsnutze müssen sich halt mit der Grundversorgung bescheiden, und das ist auch gut so! Mehr können sie von der Gesellschaft nicht erwarten.“
„Ja, Gunter, genau das, was du hier gerade so vehement einforderst, das haben wir in unserer Gesellschaft inzwischen doch weitgehend erreicht“, griff Klaus Eppelmann in die Diskussion ein. „Die ‚Dinger‘, wie du sie nennst, sind eine enorme Erleichterung für uns, indem sie uns all jene Aufgaben und Arbeiten abnehmen, die wir Menschen sowieso nicht gerne selber tun. Damit schaffen sie uns ganz neue Freiräume für andere, viel interessantere Tätigkeiten und neue Entfaltungsmöglichkeiten. Wir können jetzt Dinge tun, von denen wir früher nur hätten träumen können, weil wir den größten Teil unserer Zeit damit hätten verbracht haben müssen, mehr oder weniger stupide wie die Hamster im Laufrad zu rennen, um unsere Brötchen zu verdienen, und im Rest der Zeit die sonstigen notwendigen, aber meist lästigen Dinge zu erledigen. Damit waren ja bekanntlich früher die Tagesabläufe weitgehend ausgefüllt, und abends war man dann gewöhnlich schon zu müde, um sich nochmal zu geistig anspruchsvollen Themen aufzuraffen.“
„Was willst du uns eigentlich sagen?“ fragte Jochen Grüner.
„Äh, . . .“ Klaus Eppelmann wunderte sich etwas über die Frage. „Ja, . . . , offenbar habe ich mich nicht verständlich ausgedrückt. Dann versuche ich es nochmal: Also, ich wollte eigentlich zwei Dinge zum Ausdruck bringen: Erstens bin ich nicht der Meinung, daß die Roboter uns alle Arbeit und jetzt sogar noch unsere Freizeitvergnügen wegnehmen, wie du es offensichtlich empfindest, Jochen, oder zumindest befürchtest. Im Gegenteil, ich halte sie für sehr nützlich, denn sie entlasten uns von lästigen und öden Tätigkeiten, die kein Mensch heute mehr selber machen möchte. Betrachte sie einfach als moderne Sklaven, denn das sind sie im Grunde. Abgesehen davon aber haben sie Fähigkeiten, denke zum Beispiel an Schnelligkeit, Präzision, Gedächtnis, die kein Mensch in gleicher Weise je leisten könnte. Das heißt, sie taugen eben nicht nur zu Sklavenarbeiten, sondern sind darüber hinaus für bestimmte schwierige Aufgaben sogar unersetzlich! In jedem Fall aber dienen sie dem Menschen! Deshalb halte ich es für falsch, sie gewissermaßen als Feinde des Menschen zu betrachten. Sie sind ja vom Menschen für den Menschen geschaffen worden! . . . So, und zweitens gewinnen wir Menschen daraus den Nutzen, daß wir uns ganz auf solche Aufgaben konzentrieren können, die uns Spaß und Freude bereiten, die für uns interessant und anspruchsvoll sind, die Kreativität erfordern. Das meinte ich vorhin mit neuen Freiräumen. Was nützen dir die besten Gedanken und Pläne, wenn du sie allein schon aus Zeitgründen nicht verwirklichen kannst. Stell dir doch mal vor, wie frustrierend es sein muß, wenn du im Alter dein Leben Revue passieren läßt und feststellen mußt, daß du zwar ´ne Menge tolle, interessante Ideen und Absichten im Laufe deines Lebens gehabt, aber keine davon verwirklicht hast. Das wäre doch eine schreckliche Erkenntnis! . . . Siehst du, und so etwas dürfte dir heutzutage eigentlich nicht mehr passieren. Du hast einfach ganz andere Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung! Und es liegt einzig und allein an dir selbst, ob du etwas daraus machst oder nicht. Die ‚Umstände‘ kannst du jedenfalls nicht mehr als Entschuldigung für Untätigkeit und unerfüllte Wünsche verantwortlich machen. Und damit komme ich jetzt zur Quintessenz meiner Ausführung: Nun kommt es nämlich darauf an, mit diesem Zeitgewinn etwas Sinnvolles anzufangen, nicht in ein Loch der Trägheit, der Lethargie zu fallen. Und ich finde, das klappt auch sehr gut. Du brauchst dich doch bloß mal umzuschauen, wieviel Leute überall ihre Selbstverwirklichung gefunden haben, zum Beispiel durch künstlerische, kunst-handwerkliche oder handwerkliche Tätigkeiten. Das ganze kulturelle Leben ist regelrecht aufgeblüht, der Bildungssektor boomt; Umweltpflege und Landschaftsgestaltung verschönern unser Leben, . . . naja, und von der Freizeitgestaltung gar nicht zu reden. Ein schöneres Leben kann man sich doch gar nicht vorstellen! Also, was macht dich so skeptisch? Warum bist du so pessimistisch?“
„Das war jetzt aber ´ne lange Rede!“ stellte Jochen fest, indem er dabei tief durchschnaufte. „Oder vielmehr schon ´nen ganzer Vortrag.“
„Wieso wunderst du dich darüber, Jochen?“ unterbrach ihn Adrian Musenmann lautstark, damit es auch keiner überhören konnte: „Du müßtest doch eigentlich wissen, daß der Klaus an verbaler Inkontinenz leidet!“
Alle lachten, während Klaus Eppelmann leicht verlegen wirkte.
Nachdem sich alles wieder ein bißchen beruhigt hatte, begann Jochen Grüner erneut: „Was du sagst, Klaus, klingt ja plausibel und mag auch alles richtig sein. Aber ich denke immer schon ein bißchen weiter. Und ich frage mich, wohin diese Entwicklung noch gehen wird, verstehst du? Gerade weil es schon seit Jahren so ist, wie du es gerade dargestellt hast, deshalb entwickelt sich ja alles noch viel rasanter als früher. Die Erkenntnisse und Technologie-Fortschritte galoppieren ja regelrecht! . . . Wer steuert diese Entwicklungen, damit das Ganze nicht in schiefe Bahnen gerät? Wer behält da überhaupt noch einen Überblick? Und wo soll das alles schließlich enden? . . . Das sind Fragen, die mich beschäftigen, die mir aber keiner beantworten kann.“
Es trat eine Pause betretenen Schweigens ein.
„Also, eines hätten sie von mir aus schon längst mal machen können“, meldete sich der vorlaute Adrian wieder zurück, „nämlich allen Schauspielern einen Chip ins Hirn einpflanzen, damit die nicht dauernd ihre Texte vergessen. Dann könnte ich die heute dies und morgen das spielen lassen – ganz egal, sie hätten alle Rollen immer parat, und wir brauchten auch nicht immer so lange zu proben. Das wär’ doch was, oder?“
Einige schmunzelten, andere schüttelten den Kopf.
„Ja, wie Klaus schon sagte, es hängt einzig und allein vom Menschen selbst ab, was er daraus macht“, mischte sich nun auch Qiang in die Debatte ein, dem es nicht gefiel, daß Adrian alles so ins Lächerliche zog. „Man kann heute bereits sehr vieles tun, und man wird künftig immer noch mehr Möglichkeiten haben. Die Entwicklung läßt sich nicht aufhalten. Aber man muß nicht alles, was man an technischen Möglichkeiten beherrscht, auch wirklich tun. Gerade das Beispiel von Adrian zeigt ja, daß man sehr wohl in der Lage ist, sich Selbstbeschränkungen aufzuerlegen. Denn mit so einer Chip-Implantation hat man ja schon hinlänglich experimentiert. Und nachgewiesener Maßen beherrscht man diese Technik. Aber man ist trotzdem wieder davon abgekommen – aus ethischen Erwägungen! Das zeigt doch, daß der Mensch sich seiner Verantwortung als höchstentwickeltes Geschöpf dieser Erde sehr wohl bewußt ist! Nicht umsonst haben ja die Diskussionen über ethische und moralische Grundsätze unseres Handelns die ganze Entwicklung in zunehmendem Maße begleitet. Das muß dir doch auch ein gewisses Vertrauen in die Zukunft geben, Jochen?!“
Jochen Grüner wiegte seinen Kopf bedächtig hin und her: „Nein, nein. Diese Aussage stimmt ja so nicht! Die Tatsache, daß es – ethische Erwägungen hin oder her – eben doch schon eine Reihe von Menschen mit einem Chip im Kopf gibt, zeigt doch, daß es immer Menschen gibt, die sich nicht um moralische Bedenken kümmern, wenn sie sich damit einen persönlichen Vorteil versprechen. Also, mit dem Vertrauen, das ist so eine Sache. Da bin ich eher skeptisch. Ich habe schon zu viele menschliche Enttäuschungen erlebt.“
„Du bist und bleibst halt ein Pessimist!“ rief Adrian Musenmann dazwischen. „Gegen Pessimismus ist kein Kraut gewachsen! Ein hoffnungsloser Fall!“
„Spotte du nur“, entgegnete Jochen Grüner, „Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall! Und Oberflächlichkeit wird eines Tages auch bestraft, warte nur.“
„Willst du nicht zum Theater kommen?“ hänselte Adrian weiter. „Ich hätte eine Prima-Rolle für dich: ‚Der eingebildete Kranke‘ von Molière. Oder von mir aus auch: ‚Der Misanthrop‘, was hältst du davon?“
„Hey, Leute, das bringt uns doch jetzt wirklich nicht weiter!“ griff Gunter Guter ein.
„Aber es zeigt doch sehr anschaulich, daß nicht alle Menschen solche Thematik von grundsätzlicher Bedeutung mit der gebotenen Ernsthaftigkeit behandeln“, beharrte Jochen Grüner. „Also wer gibt euch soviel Vertrauen, daß schon alles seinen richtigen Gang nehmen wird?“
„Eine Garantie dafür wirst du natürlich niemals und von niemandem bekommen!“ entgegnete Gunter Guter. „Aber das sollte trotzdem kein Grund für dich sein, daß du vor lauter Besorgnis in Resignation verfällst. Selbstverständlich müssen wir uns einen geschärften Blick für mögliche Fehlentwicklungen bewahren und rechtzeitig einschreiten, wenn sich solche dennoch anzubahnen scheinen. Nichtsdestotrotz müssen wir offen bleiben für neue Entwicklungen und nicht schon vom Grundsatz her gegen alles Neue opponieren. Sie haben uns bisher schon so viele Verbesserungen und Erleichterungen für unser Leben gebracht, daß wir sie nicht mehr missen möchten. Und es wird weitere Verbesserungen geben, davon bin ich überzeugt!“
„Und es wird weitere Arbeitsplätze kosten“, konstatierte Jochen Grüner.
„Gib dir keine Mühe, Gunter. Aus einem Pessimisten kannst du keinen Optimisten machen!“ mischte Adrian sich wieder ein, noch bevor Gunter Guter das Wort ergreifen konnte. „Das ist völlig aussichtslos. Ich sag‘ ja: Hoffnungsloser Fall!“
„Also komm, Adrian, jetzt reicht´s aber mit deiner Polemisiererei!“ mischte sich nun auch Volker Ungerecht ein, dem es offenbar allmählich zu bunt wurde. „Es muß auch kritische und warnende Stimmen geben! Wer weiß, wo wir ohne sie möglicherweise schon hin gedriftet wären. Schließlich ist nicht jede Entwicklung wirklich nur zu unserem Nutzen.“
„Also gut! Sprechen wir über was anderes“, willigte Adrian ein. „What about sex?“
Aber mit dieser sicher auch ein wenig provokatorisch gemeinten Aufforderung erntete Adrian nur noch mehr Unmutsäußerungen aus der Herrenrunde, so daß er schnell einen anderen Vorschlag nachschob: „What about jobs?“
Wieder lautes Murren und Unmutsäußerungen, teils sogar spöttisches Lachen. Die Herren hatten auch auf dieses Thema keine rechte Lust. Im übrigen, glaubten wohl auch die meisten von ihnen, sei das ja ohnehin wieder nur einer seiner längst nicht immer belustigenden Scherze gewesen. Und das hatte Adrian sich selbst zuzuschreiben, denn er hatte sich durch seine vielen spaßigen, häufig aber nicht wirklich witzigen und teilweise sogar unqualifizierten Äußerungen über die Jahre den Ruf eines nicht unbedingt immer ernst zu nehmenden Spaßvogels erworben.
„Nein, Moment mal! Das interessiert mich wirklich!“ rief Adrian, als er bemerkte, daß sich viele kopfschüttelnd von ihm abwendeten. „Ich wollte schon immer mal wissen, wie das bei euch in der Industrie ist.“
„Willst du jetzt in der Fabrik arbeiten?“ unterbrach ihn, laut lachend, Ralf Gerngroß, und alle stimmten in sein Lachen ein.
„Also, jetzt mal im Ernst“, ließ sich Adrian nicht von dem Zwischenruf beirren. „Ich will natürlich nicht in der Industrie anfangen! Dazu macht mir mein Job viel zu viel Spaß! Aber ich habe keine Ahnung, wie das so bei euch in der Industrie läuft – außer, was man hin und wieder mal in der Zeitung lesen kann. Das ist allerdings herzlich wenig. Und hier haben wir ja mindestens zwei Insider am Tisch, die ja wenigstens mal ein bißchen was erzählen könnten. Es interessiert mich wirklich!“ betonte er nochmal, um der Ernsthaftigkeit seines Wunsches Nachdruck zu verleihen.
Da nicht gleich jemand antwortete und Adrian offenbar befürchtete, man würde ihn immer noch nicht ernstnehmen, begann er selbst mit dem Thema: „Also in meiner Branche ist das ziemlich einfach. Wenn ich einen Künstler brauche, dann stelle ich eine Anzeige ins WorldNet, und prompt stehen am nächsten Tag so und so viele Leute bei mir vor der Tür, die den Job haben wollen. Dann lasse ich die der Reihe nach vorsprechen, vorsingen, vortanzen oder vorspielen, . . .“
„Was, du machst mit allen ein Vorspiel?“ rief Ralf Gerngroß wieder laut dazwischen und hielt sich dabei den Bauch vor Lachen. Höhnisches Gelächter in der Runde.
Adrian sah ihn mit einem strafenden Blick an und sagte verächtlich: „Witzbold!“
„Naja, der Schluß liegt doch nahe, nachdem du gerade vorher selbst noch die Frage nach Sex gestellt hattest, oder?“ hakte Ralf mit einem süffisanten Lächeln nach.
„Also gut, jetzt hast du deinen Spaß gehabt, und jetzt hältst du dich aus unserer ernsthaften Unterhaltung raus, okay?“ entgegnete Adrian. Und um weiteren Zwischenrufen möglichst erst gar keine Gelegenheit zu geben, setzte er unmittelbar fort: „Ja, also was ich gerade sagen wollte, ist, daß ich eigentlich immer aus einer großen Auswahl guter Kräfte aussuchen kann. Dann machen wir einen Vertrag für das betreffende Arrangement, und danach beginnt wieder ein neues Spiel.“
„Ein Vorspiel, meinst du!“ rief Ralf Gerngroß wieder mit verkniffenem Lachen dazwischen.
Während Adrian ihm einen bösen Blick zuwarf, beruhigte Klaus Eppelmann ihn: „Einfach ignorieren!“
„Ja, also bei uns ist niemand zeitlich lange gebunden“, wandte Adrian sich wieder an Klaus und Qiang. „Und was man so hört, sind eure Ingenieure ja wohl heutzutage zum größten Teil auch alles ‚freischaffende Künstler‘, oder?“
„Wenn du mit freischaffend meinst, daß sie vielfach als selbständige Unternehmer agieren, dann hast du recht“, antwortete Klaus Eppelmann. „Allerdings gilt das nicht generell und in allen Bereichen. In unserem Metier ist das jedenfalls nicht in dem Maße möglich, weil wir – wie du ja weißt – im Verteidigungssektor tätig sind, und da unterliegt mehr oder weniger alles der Geheimhaltung. Und die wäre im häuslichen Bereich natürlich nicht im notwendigen Umfang zu gewährleisten. Deshalb müssen unsere Ingenieure nach wie vor ihre Arbeit fast vollständig im gesicherten Gelände der Firma leisten. Und natürlich müssen wir sie auch längerfristig an uns binden, das versteht sich von selbst. Aber in der zivilen Industrie ist es in der Tat so, daß sie vorwiegend als freischaffend bezeichnet werden können. Das wird dir Qiang sicher bestätigen.“
„Ja, sicher. Das kann ich bestätigen. Und in unserer Firma ist es ja gang und gäbe seit langem“, pflichtete Qiang ohne Zögern bei. „Es wird sehr viel zu Hause gearbeitet, jedenfalls überall dort, wo es sich von der Art der Arbeit und der Arbeitsabläufe her einrichten läßt.“
„Dies trifft im übrigen auch für viele Behördenaufgaben und andere Dienstleistungen zu“, mischte sich Ralf Gerngroß wieder ein.
„Und wie funktioniert das bei euch so in der Praxis?“ wollte Adrian von Qiang wissen, ohne Ralf auch nur eines Blickes zu würdigen.
„Jetzt tu doch nicht so, als würdest du dich für ernsthafte Arbeit interessieren, Adrian!“ lästerte Ralf weiter.
Adrian wollte gerade aus der Haut fahren, besann sich aber noch rechtzeitig eines Besseren. Den Triumph, sich vor aller Augen zur Unbeherrschtheit provozieren zu lassen, wollte er Ralf nicht gönnen. Er atmete kurz und tief durch und entgegnete dann betont ruhig: „Mein lieber kleiner Gern-e-groß, du hast offenbar keinen blassen Schimmer, was ernsthafte Arbeit ist. Sonst wüßtest du, daß meine tägliche Beschäftigung am Theater auch eine sehr ernsthafte Arbeit ist. Aber im Gegensatz zu dir interessiere ich mich eben auch für andere Tätigkeiten außerhalb meines Horizonts.“ Dabei fixierte er Ralf noch einmal kurz mit einem sehr vorwurfsvollen Blick, um sich dann wieder Qiang zuzuwenden.
Klaus Eppelmann schmunzelte: „Na, ihr seid ja gut drauf heute!“
„Ich bin immer gut drauf!“ erwiderte Adrian trotzig. „Aber jetzt mal Schluß mit der Lästerei. Es interessiert mich wirklich, wie das in eurem Metier so abgeht.“
„Also gut. Aber ich möchte die anderen hier nicht langweilen“, räumte Qiang ein und schaute dabei mit fragendem Blick in die Runde.
„Nein, nein! Mach nur!“ vernahm er als Echo.
„Okay. Du mußt dir das ungefähr so vorstellen“, begann Qiang zu erläutern: „Die Entwicklungsingenieure agieren im Prinzip wie selbständige Kleinunternehmer, jedenfalls zu einem großen Teil. Sie bekommen von unserer Firma, im allgemeinen via WorldNet, eine Aufgabenstellung, vergleichbar mit einer Kunden-Ausschreibung für eine Auftragsvergabe. Der Ingenieur prüft diese Aufgabenstellung auf mögliche Unklarheiten in den Anforderungen, auf Durchführbarkeit der Aufgabe, auf mögliche Risiken bei der Durchführung sowie auf die jeweiligen Randbedingungen beziehungsweise Voraussetzungen. Bei eventuellen Unklarheiten kann er jederzeit Rücksprache mit uns nehmen, um Mißverständnisse und Fehleinschätzungen möglichst frühzeitig auszuräumen. Er macht dann, wenn er an dem Auftrag interessiert ist, eine Aufwandsschätzung in Zeitbedarf und Kosten und vergleicht diese mit dem vorgegeben Liefertermin und dem veranschlagten Budget. Auf der Basis dieser Überlegungen erstellt er schließlich ein Angebot und schickt es, wiederum via WorldNet, an seinen Auftraggeber, in dem Fall also an uns. Dieser prüft das Angebot, führt üblicherweise noch Verhandlungen mit dem Anbieter oder den Anbietern und vergibt schließlich den Auftrag.“
„Hört sich eigentlich einfach an“, bemerkte Adrian.
„Es soll ja auch möglichst unkompliziert sein! Sonst wäre es ja mit großer Wahrscheinlichkeit schon wieder ineffizient!“ entgegnete Qiang. „Aber natürlich gibt´s auch immer mal wieder Fälle, wo es nicht ganz so smooth läuft. Such is Life!“
„Das versteht sich von selbst“, stimmte Adrian zu.
„Für uns ist jedenfalls das Entscheidende an diesem Prinzip“, erläuterte Qiang, „daß die Ingenieure jetzt nicht mehr für die Stunden bezahlt werden, die sie in der Firma verbringen, sondern ausschließlich für die erbrachte Leistung beziehungsweise das gelieferte Produkt – reines Leistungsprinzip! Wieviel Zeit und Mühe sie dafür aufgewendet und zu welchen Tages- oder Nachtzeiten sie daran gearbeitet haben, ist dem Auftraggeber völlig egal, Hauptsache das Ergebnis wird innerhalb des vorher vereinbarten Zeitraumes in der erwarteten Qualität geliefert.“
„Just in Time! Verstehe!“ sagte Adrian, wirkte aber dennoch etwas nachdenklich. „Und natürlich im vereinbarten Budget, nicht?“
„Der Preis der Leistung ist zu dem Zeitpunkt kein Thema mehr, denn der wurde ja bereits bei der Auftragsvergabe verhandelt. Es ist zwar auch schon manchmal zu Nachforderungen gekommen, wenn sich im Laufe der Bearbeitung unvorhergesehene Schwierigkeiten, die dann zu erheblichen Mehraufwendungen führten, ergeben haben. Da haben wir dann gegebenenfalls nachverhandelt. Aber im Normalfall ist das Thema mit der ursprünglichen Vertragsverhandlung für uns erledigt. Eventuelle Risiken gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Wer seinen Job gut macht, der macht seine Risikoabschätzung bereits vor Angebotsabgabe sehr gewissenhaft, damit ihm später nicht solche Gefahren drohen. Genau das müssen wir ja gegenüber unseren Kunden auch tun.“
Die ganze Arbeitswelt hatte sich im Laufe der letzten Jahrzehnte dramatisch verändert. Firmen mit Tausenden oder gar Hunderttausenden von festangestellten Arbeitnehmern gab es – mit Ausnahme in der Verteidigungsindustrie – nicht mehr. Vielmehr hielten die Firmen üblicherweise nur noch eine vergleichsweise kleine Stammbelegschaft fest Angestellter, die für die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens praktisch unverzichtbar waren, die die Kernaufgaben des jeweiligen Geschäftes wahrnahmen und über das dazu notwendige Know-how verfügten. Zu diesen Kernaufgaben gehörten je nach Ausrichtung der Firmen insbesondere die Systemanalyse, -design und -integration, die Spezifikation der jeweiligen Produkte und ihrer Komponenten, Forschungsarbeiten, Expertenwissen, Kreativität und deren Umsetzung in Innovationen, spezifische Serviceaufgaben, sowie immer auch das Management der Auftragsabwicklung.
Dahingegen wurde die Entwicklung von einzelnen Komponenten des Gesamtsystems nach vorgegebener Spezifikation nicht selten an Externe – andere Firmen oder selbständige „Heim-Arbeiter“ – unterbeauftragt, gegebenenfalls auch die Fertigung, soweit diese überhaupt noch manuell erfolgte. In den Produktionsstätten waren nämlich fast ausnahmslos Roboter und softwaregesteuerte 3D-Drucker eingesetzt, was zu einer phantastischen Produktivitätssteigerung geführt hatte, denn die Roboter waren per se fleißig, präzise und – wenn nötig – rund um die Uhr im Einsatz. Sie benötigten lediglich etwas Energie, die ihnen üblicherweise durch in den letzten Jahren dank eines erheblich gesteigerten Wirkungsgrades sehr viel effizientere Solartechnik zugeführt wurde. So benötigte man selbst in größeren Produktionsstätten im allgemeinen nur noch ein bis zwei Personen für die Aufgabenprogrammierung der Roboter und deren Ausführungsüberwachung.
Zur stark angewachsenen Gruppe der Selbständigen zählten unter anderen auch alle sogenannten „Heim-Arbeiter“. Im Grunde waren es ausgelagerte Arbeitsplätze der großen Firmen, deren vormalige Angestellte sich in Anpassung an die neuen Gegebenheiten verselbständigt hatten. Dabei handelte es sich zum Teil um hochspezialisierte Fachkräfte, die als freie Mitarbeiter in enger Bindung zu einem bestimmten Auftraggeber immer wieder ganz bestimmte Projektaufgaben übernahmen und diese zu dessen Zufriedenheit erledigten, so daß sich hier sehr häufig ein längerfristiges vertrauensvolles Zusammenarbeitsverhältnis herausbildete. Zum größeren Teil aber handelte es sich um Selbständige, die ihr Können und ihre Arbeitsleistung im Sinne einer „verlängerten Werkbank“ oder auch bestimmte Dienstleistungen an alle möglichen Interessenten auf dem freien Arbeitsmarkt anboten, sich mit ihren Fähigkeiten also selbst vermarkteten.
Feste Wochenarbeitszeiten gab es bis auf wenige Ausnahmen, besonders in den sogenannten Präsenz-Berufen, nicht mehr. Das war möglich geworden, weil die Gehälter nicht mehr nach Zeitaufwand, sondern grundsätzlich nach Leistung gezahlt wurden. Dies wiederum war nur möglich, sofern jede zu erbringende Leistung vorher klar definiert und hinsichtlich ihres „Wertes“ abgeschätzt worden ist. Und genau das war gängige Praxis geworden, denn die Vorteile dieses reinen Leistungsprinzips gegenüber dem früheren „Beschäftigungsprinzip“, bei dem häufig mangels Auslastung oder aufgrund von Fehlbeschäftigung sehr viel „Totzeiten“ entstanden beziehungsweise „Blindleistung“ erzeugt wurde und dadurch jede Menge Ineffizienz herrschte, waren unbestreitbar groß. Die Beschäftigten im Angestelltenverhältnis bekamen – genau wie die Selbständigen – von ihrem Auftraggeber klare, von Aufwand und Komplexität her überschaubare Aufgabenstellungen mit definierten Vorgaben zur Lieferung, Form und Qualität des Ergebnisses. Die eigentliche Arbeitszeit spielte dabei überhaupt keine Rolle mehr, der betreffende Bearbeiter konnte so viel oder so wenig Zeit investieren wie er wollte beziehungsweise brauchte, und er konnte sich auch die Zeit einteilen wie er wollte, er mußte lediglich zum vereinbarten Zeitpunkt sein Ergebnis in der erwarteten Qualität abliefern.
Die Durchsetzung des Leistungsprinzips und die Automatisierung der Produktion mittels Robotern als treibende Faktoren hatten die Arbeitswelt total verändert. Es waren sehr viele kleine bis mittelgroße Unternehmen entstanden, und es gab ein „Heer“ von Selbständigen, die sich ihre Aufträge auf dem virtuellen Arbeitsmarkt, einer Homepage im WorldNet, suchten. In vielen Berufen konnte die Arbeit zu Hause – häufig am Computer, der über das WorldNet via verschlüsselter Datenübertragung mit der Firma verbunden war – erledigt werden. In die Firma ging man nur gelegentlich, zu vereinbarten Zeiten, um die Aufgabenstellung gründlich durchzusprechen, um beispielsweise mit den „Kollegen“ notwendige Abstimmungen vorzunehmen, oder zu bestimmten Anlässen, aber auch um die für die Zusammenarbeit wichtigen persönlichen Kontakte zu pflegen. Diese Entwicklung war nicht zuletzt auch durch die weite Verbreitung und umfangreiche Nutzung von Computern in Verbindung mit der gesicherten Informationsübertragung über inzwischen sehr leistungsfähige Kommunikationsnetzwerke unterstützt worden. Und sie hatte nicht nur im industriellen Bereich Platz gegriffen, sondern in allen Arbeitsbereichen, auch bei den Behörden, wo inzwischen sehr viele Aufgaben von Heim-Arbeitsplätzen aus durchgeführt wurden, denn die meisten Behördenanfragen kamen seit langer Zeit ohnehin übers WorldNet.
Sehr vorteilhaft wirkte sich dieser Wandel auch auf das Verkehrsaufkommen aus, das
dadurch in Summe deutlich reduziert und zeitlich besser verteilt wurde, so daß selbst die sogenannte Rush hour damit ihren Schrecken verlor. Denn auch die immer noch notwendigen Zusammentreffen – neben den weitverbreiteten Konferenzschaltungen mit Videoübertragung – verteilten sich jetzt besser über den Tag.
Bei den sogenannten Call- und Präsenz-Berufen – dazu zählten all jene, bei denen der Betreffende während einer bestimmten, vereinbarten Zeit entweder in Abrufbereitschaft oder sogar am Ort seiner Tätigkeit präsent sein mußte, also zum Beispiel alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wie Polizei, Feuerwehr, Not- und Rettungsdienste, aber auch Ärzte und Pfleger, Wach- und Schutzdienste, in der Aus- und Weiterbildung und ähnliches – verhielt sich das natürlich etwas anders. Aber auch dort hatte sich das Leistungsprinzip zu einem gewissen Grade durchgesetzt. Alle in diesen Berufsgruppen Tätigen hatten, wenn sie nicht selbständig waren, jeweils zeitlich begrenzte Verträge mit einem für diese Zeit festen Grundgehalt – einfach für ihre Anwesenheit. Ihre Tätigkeit während dieser Zeit wurde dann entsprechend der zugeordneten Wertigkeit extra honoriert. Nach Ablauf des Zeitvertrages konnte dieser verlängert werden oder auch nicht, je nach Bedarf und individueller Bewährung.
Die meisten Schwierigkeiten mit diesem gesellschaftlichen Wandel hatten wohl die Gewerkschaften, und von dort kamen auch die größten Widerstände, denn sie fürchteten ernsthaft und nicht ganz unbegründet um ihre Existenzberechtigung. Welche Rolle sollten sie noch spielen, wenn die weitaus größte Mehrzahl aller Berufstätigen faktisch eigenständige Unternehmer waren, die sich selbständig ihre Arbeit suchten und auch ihre Interessen selbst vertraten?
Aber gerade darin erkannte man schließlich die neue, freilich völlig andersartige Aufgabe der Gewerkschaften, die insofern eine große Herausforderung für sie darstellte. Sie mußten umdenken. Es gab nicht mehr die großen, durch klare Fronten getrennten Blöcke – die Gruppe der Arbeitnehmer auf der einen Seite, deren Interessen man gegen die Forderungen der Arbeitgeber auf der anderen Seite vertreten mußte. Diese Fronten hatten sich praktisch aufgelöst. Jeder konnte Arbeitnehmer und Arbeitgeber zugleich sein, und viele waren in dieser Doppelfunktion tätig. Aber mit der konsequenten Einführung des Leistungsprinzips entstanden auch ganz neue Aufgaben. So erkannte man ziemlich bald die Notwendigkeit, die Auftragsvergabe generell einer Art Qualitätskontrolle zu unterziehen, um der Willkür, der Übervorteilung und dem Mißbrauch nicht Tür und Tor zu öffnen. Und für den Fall, daß doch ein solcher Verdacht entstand, mußte es eine Schiedsstelle geben, an die sich jeder wenden konnte, um eine Klärung aus neutraler Sicht herbeizuführen. Ein solcher Fall war beispielsweise gegeben, wenn der „Wert“ eines Auftrags vom Auftraggeber zu gering eingeschätzt und demzufolge unterbezahlt erschien, oder umgekehrt, wenn ein Auftragnehmer seine Leistung zu Dumpingpreisen anbot, um Mitbewerber auszuschalten. Der Aufwand für ein bestimmtes, zu vergebendes Arbeitspaket – und damit der Auftragswert – mußte jederzeit einer Überprüfung durch die Schiedsstelle standhalten können. Diese Kontroll- und Schiedsfunktion als neutrale Instanz übernahm jetzt die Gewerkschaft. Klar, daß sie sich völlig neu orientieren und die neue Rolle und die damit verbundenen Aufgaben selbst erst lernen mußte. Vor allem mußte sie auch über die notwendigen Fachleute in ihren Reihen verfügen, um die erforderliche Beurteilungsfähigkeit zu haben. Im allgemeinen wurden bestimmte Verhandlungsspielräume, sogenannte „Vergütungsbänder“, mit einer oberen und unteren Grenze festgelegt, innerhalb derer sich die handelnden Parteien einigen mußten.
Die Vorteile dieser Arbeitsmarktveränderungen lagen klar auf der Hand. Für die Firmen waren dies folgende: Leerzeiten im Angestelltenbereich gab es praktisch nicht mehr, hier sparte die Firma sehr viel Geld. Der Bedarf an Räumlichkeiten und Infrastruktur war wesentlich geringer, weil ein sehr großer Teil der Beschäftigten zu Hause arbeitete – auch hier sparte die Firma Geld. Und schließlich waren die Produkte selbst im allgemeinen weit weniger fehlerbehaftet, hatten also eine bessere Produktqualität und Termintreue. Dies war vor allem dem Umstand zu verdanken, daß die Aufgaben schon vor Auftragsvergabe sehr viel gründlicher definiert und abgeschätzt werden mußten als es früher üblich war und daß die Arbeiten jetzt – in Eigenverantwortung – viel sorgfältiger durchgeführt wurden. Dadurch reduzierte sich die Wahrscheinlichkeit von Fehleinschätzungen beziehungsweise Fehlern erheblich, was zu großen Kosteneinsparungen führte. Denn gerade Fehler in den frühen Phasen einer Entwicklung, die in aller Regel erst sehr viel später entdeckt werden, verursachen dann um so größere Kosten und Zeitüberzüge je später sie erkannt werden. Und schließlich war auch das Risiko, das bei technischen Problemstellungen immer auftreten kann, jetzt weitgehend vom Auftraggeber zum freien Mitarbeiter verlagert worden, jedenfalls soweit die Aufgabenstellung des Auftraggebers nicht schon fehlerhaft war. Das Gehaltsniveau ist jetzt zwar deutlich höher als früher, aber dafür entfallen für den Auftraggeber sämtliche Sozialleistungen einschließlich Betriebsrenten für seine – jetzt eigenverantwortlichen – Auftragnehmer. Die Auftraggeber müssen dafür keine Rücklagen mehr bilden und werden gleichzeitig von dem damit verbundenen bürokratischen Verwaltungsaufwand entlastet.
Auf der anderen Seite waren die Vorteile für den freien Mitarbeiter vor allem seine völlig freie Zeitverfügung und damit auch in gewisser Weise seine Lebensgestaltung. Er konnte jetzt beispielsweise – wenn er mit seinem Einkommen entsprechend gut auskam – ein halbes oder ganzes Jahr Urlaub machen. Er konnte auch Aufträge von anderen Firmen annehmen oder Weiterbildungsveranstaltungen besuchen. Er konnte sich freier entfalten und seine ‚Unternehmer-Qualitäten‘ entwickeln, indem er vielleicht Teile seines Auftrags an einen Unterauftragnehmer vergab. Er mußte nicht täglich zur Arbeitsstätte und zurück fahren. Er konnte sein Familien- oder generell sein Privatleben freier organisieren. Das war insbesondere für junge Familien mit Kleinkindern ein unschätzbarer Vorteil, den sie gerne für sich in Anspruch nahmen.
Es gab allerdings auch unerwünschte Nebeneffekte: So kam es verschiedentlich zur „Vereinsamung“ von Menschen, weil die Betroffenen zum größten Teil ihrer Zeit – allein – zu Hause an ihren Computern saßen und zu wenig Kontakt zu ihren Arbeitskollegen, die für manche überhaupt die einzigen Kontakte zu anderen Menschen schlechthin waren, bekamen. Sie wohnten durchaus nicht alle am selben Ort, weil das heimarbeit-bedingt auch gar nicht notwendig war, und sie trafen sich ja nur noch gelegentlich, zu bestimmten dienstlichen Anlässen. Dem versuchten allerdings die Auftraggeber häufig durch Förderung von Zusammenkünften und Gemeinschaftsveranstaltungen entgegenzuwirken, denn es lag auch in ihrem ureigenen Interesse, die Zusammenarbeit in ihren Projekten zu fördern, weil der Erfolg der Arbeit letztlich davon abhing.
Eine andere Begleiterscheinung war der gegenüber früheren Zeiten viel höhere Leistungsdruck, dem die Leute jetzt zwangsläufig ausgesetzt waren, denn sie mußten sich praktisch täglich neu bewähren, wurden ständig und unmittelbar an ihrem Erfolg gemessen. Von diesem Erfolg hing schließlich auch ihre weitere Beschäftigung beziehungsweise Beauftragung sehr wesentlich ab, denn die vertragliche Bindung der Auftragnehmer zu ihrem Auftraggeber war jetzt deutlich geringer als bei den früher üblichen Festanstellungen. Das war gewissermaßen der Preis, den sie für den größeren Freiheitsgrad in ihrer Selbstbestimmung und persönlichen Zeiteinteilung zahlen mußten.
Auf der anderen Seite waren die Chancen, einen Auftrag zu erhalten, jetzt deutlich größer als in früheren Zeiten. Das hatte verschiedene Gründe: Zum einen waren die Firmen aufgrund der viel geringeren Zahl von Festanstellungen in ihren Betrieben auf die vermehrte Vergabe von Aufträgen an Externe angewiesen. Zum anderen gab es jetzt eine für alle Firmen in der EU einheitliche, nämlich am vereinbarten Auftragswert ausgerichtete Entlohnungsstruktur. Die früher speziell in Deutschland sehr hohen Lohnnebenkosten pro Mitarbeiter sind entfallen, und das führte in der Tat zu einem größeren Beschäftigungseffekt. Denn damals beschäftigten die Firmen wegen der hohen Lohnnebenkosten lieber wenig Leute mit vielen Wochenarbeitsstunden, anstatt mehr Leute mit weniger Wochenarbeitsstunden. Nachdem diese „Schieflage“ beseitigt worden war und die Entlohnung nicht mehr auf Stundenbasis, sondern auf der Basis eines gut vorauskalkulierbaren Leistungswertes erfolgte, funktionierte der Arbeitsmarkt wesentlich entspannter. Dem Auftraggeber konnte es jetzt egal sein, ob sein Auftrag von einem oder von mehreren Auftragnehmern gemeinsam bearbeitet wurde, ob also der Leistungswert – die Bezahlung – an einen Auftragnehmer ging oder unter mehreren aufgeteilt wurde. Hauptsache für ihn war, daß die vereinbarte Leistung in der vereinbarten Zeit und Qualität erbracht wurde. Zum Ausgleich für die entfallenen Lohnnebenkosten mußten die Auftraggeber jetzt allerdings zwangsläufig ein inflationsbereinigt höheres Lohnniveau als in früheren Zeiten akzeptieren, um die Auftragnehmer in die Lage zu versetzen, ihre Sozialversicherungs- und Vorsorgeaufwendungen bezahlen zu können.
Mit der Vereinfachung und europaweiten Vereinheitlichung der Vergütungsstruktur sowie dem automatischen Einzug der Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge bei jedem Kapitaltransfer wurden innereuropäische „Verzerrungen“ aufgehoben und Verwaltungsaufwände auf allen Ebenen drastisch reduziert, was letztlich allen zugute kam: Das System war gerechter, und es war besser für die Bürger und besser für die Gesellschaft.
Die in früheren Jahren in weiten Teilen vorherrschende Versorgungsmentalität existierte praktisch nicht mehr. Das sogenannte „Soziale Netz“, vielfach auch als „Hängematte“ bezeichnet und als Ruhekissen ausgenutzt, stand in dieser Form nicht mehr zur Verfügung. Jetzt gab es die Allgemeine Grundversorgung, und damit mußte zufrieden sein, wer nicht arbeiten wollte. Zusätzliche Hilfe bekamen jetzt nur noch nachgewiesenermaßen wirklich kranke und notleidende, unterstützungsbedürftige Menschen, die unverschuldet in diese Situation geraten waren und nicht mehr allein herauskommen konnten. Das wurde streng kontrolliert. Wer arbeitsfähig war, hatte keinen Anspruch auf diese Unterstützung. So mußte sich jeder nolens volens selbst um eine Arbeit bemühen, sich selber kümmern, wenn er seinen Lebensstandard verbessern wollte. Und Arbeit gab es genug, obwohl sehr viele Arbeitsplätze, insbesondere in der Produktion durch den Robotereinsatz und in der Verwaltung durch automatisierte Verarbeitungsprozesse, verlorengegangen waren. Dafür gab es aber beispielsweise auch keine ehrenamtlichen Tätigkeiten mehr, auch keine unentgeltliche Nachbarschaftshilfe. Jede Tätigkeit mußte bezahlt werden. Besonders im Dienstleistungsbereich boomte der Arbeitsmarkt regelrecht, selbst in dem ehemals als „Service-Wüste“ verschrienen Deutschland. Angebot und Nachfrage waren gleichermaßen sehr groß, ob es sich nun um Kinder- oder Krankenbetreuung, Altenpflege, „Wellness“-Anwendungen im weitesten Sinne, Aus- und Weiterbildung, Garten- und Landschaftspflege, Reparatur- oder Reinigungsdienste, Transportdienste, Unterhaltung jedweder Art, oder was auch immer handelte. Jeder Erwachsene hatte eine Ausbildung, einen Beruf und – wenn er wollte – einen oder mehrere Jobs. Man hatte nicht keine Arbeit, weil es keine gab, sondern nur, wenn man nicht zu arbeiten brauchte, weil man auch so vermögend genug war, oder wenn man nicht arbeiten wollte, weil man Urlaub machte oder eine Weiterbildungsmaßnahme wahrnahm. Wie man überhaupt seine Zeit nach eigenem Gutdünken frei einteilen konnte. So gab es nicht Wenige, die etliche Monate am Stück hart arbeiteten, um sich dann mit dem verdienten Geld eine längere Weltreise leisten zu können. Diese neu gewonnene Freiheit, sein Leben, seinen Alltag selbst bestimmen und gestalten zu können, nicht jeden Tag von neuem in die gleiche, zeitlich vorgegebene „Tretmühle“ gehen und seine Stunden „absitzen“ zu müssen, diese neue Freiheit war es vor allem, die – nach quälend langen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen – die Mehrheit der Bevölkerung schließlich doch für diesen gravierenden gesellschaftlichen Wandel vereinnahmte. Und nicht nur das – sie förderte die Kreativität der Menschen in einem Ausmaß, wie es vorher niemand sich auszumalen vermochte. Das gesellschaftliche Leben pulsierte in allen Bereichen. Im Kunsthandwerk, wie in allen anderen Kunstgattungen, vervielfachten sich die schöpferischen Tätigkeiten, blühte das Geschäft in Angebot und Nachfrage. Die Urlaubs- und Freizeitgestaltung und die damit verbundenen Dienstleistungen entwickelten sich zu einem kolossalen Wachstumsmotor. Gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen verschiedenster Art standen zur Auswahl, führten die Menschen zusammen, ermöglichten neue Kontakte, gaben neue Anregungen. Jeder konnte zu jedem Zeitpunkt und an jeder Stelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder selber anbieten. Geschäftiges Treiben allerorten. Die vielfältigen Möglichkeiten zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung im Handeln und das dadurch gestärkte Selbstbewußtsein jedes Einzelnen führte zu einer erheblichen Reduzierung streßbedingter psychischer Erkrankungen.