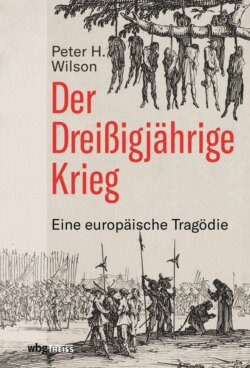Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Peter H. Wilson - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Pax Hispanica Die spanische Monarchie
ОглавлениеDie Epoche von 1516 bis 1659 gilt als das Goldene Zeitalter Spaniens und überhaupt als Ära europäischer Vormacht auf der ganzen Welt. In internationaler Perspektive wird der Dreißigjährige Krieg so zu einem aus einer ganzen Reihe von Konflikten, die verschiedene europäische Mächte zur Abwehr eines – wie sie es sahen – spanischen Griffs nach der Weltherrschaft führten. Ganz gewiss war Spanien, war auch das spanische Überseereich dafür verantwortlich, dass die Auswirkungen des mitteleuropäischen Krieges in den Jahren nach 1618 auf der ganzen Welt zu spüren waren. Die Anwesenheit der Spanier auf dem europäischen Schauplatz prägte den gesamten Kriegsverlauf, selbst wenn, wie wir noch sehen werden, die spanischen Habsburger durchaus ihre eigenen Probleme hatten, die von denen der österreichischen Habsburger deutlich verschieden waren.
In einer entscheidenden Hinsicht glichen sich jedoch die Probleme der beiden Familienzweige. Wie ihre österreichischen Vettern herrschten die spanischen Habsburger über ein riesiges Reich, das sich nur mit Mühe zusammenhalten und regieren ließ. Das Reich der Spanier war in der letzten Zeit noch beträchtlich gewachsen, nachdem Philipp II. 1580 die Portugiesen zu einer gesamtiberischen Kronunion gezwungen hatte, die Portugal – und damit auch dessen Kolonialreich – unter spanische Kontrolle brachte. Zwei Jahre zuvor war der junge portugiesische König Sebastian I. – Dom Sebastião o Desejado, „der Ersehnte“ – zusammen mit der ganzen Blüte des portugiesischen Adels in der verhängnisvollen Schlacht von Alcácer-Quibir (al-Qaṣr al-Kabīr) in Marokko gefallen, was das Ende des Hauses Avis bedeutete, das Portugal seit 1385 beherrscht hatte. Die Kronunion war eine Zwangsheirat, an deren Zustandekommen ein spanisches Invasionsheer maßgeblich beteiligt war. Dennoch lernten viele Portugiesen die Vereinigung ihres Königreiches mit dem spanischen bald zu schätzen, da sie ihnen den Zugang zu spanischen Handels- und Verdienstmöglichkeiten eröffnete. Portugal brachte zwar nur 1,1 Millionen neue Untertanen in die Union ein, konnte aber Gebietsansprüche in Brasilien, Afrika und Asien vorweisen. Die portugiesische Herrschaft über diese Besitzungen war allerdings denkbar schwach ausgeprägt: Um 1600 hielten sich in ganz Brasilien vielleicht gerade einmal 30 000 Europäer und 15 000 aus Afrika verschleppte Sklaven auf, denen immerhin 2,4 Millionen Ureinwohner gegenüberstanden, die sich über das unermessliche, größtenteils noch unerforschte Landesinnere verteilten. Ein paar Tausend Portugiesen waren in den Küstenfestungen von Angola und Mosambik stationiert, rund 10 000 weitere auf Posten in ganz Portugiesisch-Indien (Estado da Índia) verstreut; Letzteres umfasste die Besitzungen östlich des Kaps der Guten Hoffnung, die von Goa im Westen Indiens aus verwaltet wurden.81
Spanien hatte rund 8,75 Millionen Einwohner in Kastilien und den damit verbundenen Regionen Katalonien, Aragón, Valencia und dem Baskenland. Im Gegensatz zur Entwicklung im restlichen Europa kam das Bevölkerungswachstum Kastiliens um 1580 völlig zum Erliegen, was durch Missernten, Seuchen, Auswanderung in die Kolonien und – das vor allem – die doppelte Belastung von Krieg und hohen Steuern bedingt war. Bis 1631 waren nur noch 4 Millionen Kastilier übrig, rund eine Million weniger als 40 Jahre zuvor. Die spanischen Überseegebiete waren ebenfalls von Bevölkerungsschwund betroffen – doch in diesem Fall lag die Ursache in der europäischen Eroberung, die Krankheiten und brutale Ausbeutung über die indigene Bevölkerung brachte. In der Folge sank deren Zahl von über 34 Millionen zu Beginn der Kolonialzeit auf nur etwa 1,5 Millionen um 1620. Zu diesem Zeitpunkt lebten bereits 175 000 Kolonisten und rund noch einmal so viele afrikanische Sklaven und Mestizen verstreut über Mexiko, die Karibik, die West- und Nordküsten Südamerikas sowie in und um Manila auf den Philippinen.82 Diese statistischen Daten helfen, das spanische Überseereich in die rechte Relation zu den europäischen Machtbereichen der Spanier zu setzen, wo etwa in den südlichen Niederlanden 1,5 Millionen Untertanen lebten, im Herzogtum Mailand und dem Königreich Sizilien jeweils rund eine Million und im Königreich Neapel 3 Millionen.
Die Bedeutung der spanischen Herrschaftsgebiete und Kolonien wurde durch die Stagnation der Wirtschaft im Mutterland noch vergrößert. Von der Wiederausfuhr lateinamerikanischen Silbers einmal abgesehen, bestand der hauptsächliche Beitrag Spaniens zum europäischen Binnenhandel in Rohstoffen und einigen Nahrungsmitteln. Das spanische Wirtschaftswachstum wurde durch ein System von Kartellen und Monopolen ausgebremst, durch das der Handel mit bestimmten Waren streng reglementiert wurde – eine Praxis, die sich auch auf die Kolonien erstreckte. Zugleich sorgte die Privilegierung des Hafens Sevilla seitens der spanischen Krone dafür, dass dieser auf lange Zeit das einzige Tor zur Neuen Welt blieb. Ernteausfälle und eine schwer drückende Steuerlast lösten Landflucht aus: Die Menschen zogen entweder in die Städte – oder gleich in die Kolonien. Das wiederum schwächte die Position der Überlebenden beziehungsweise Daheimgebliebenen, die sich umso schlechter gegen adlige und klerikale Übergriffe auf das verbliebene Gemeindeland zur Wehr setzen konnten. Private Investoren und Kaufleute waren auf die Silberlieferungen aus der Neuen Welt angewiesen, um den allgemeinen Konsum anzukurbeln, da Spanien allein nicht einmal seine Bevölkerung ernähren konnte und einen Großteil des Nahrungsbedarfs durch Importe aus anderen Ländern decken musste. Ihre Unfähigkeit, ausreichende Mengen gefragter Waren für den Export zu produzieren, schloss die Spanier vom Kolonialhandel, der proportional zum Wachstum der europäischen Kolonialbevölkerung in Nord- und Südamerika expandierte, in weiten Teilen aus. Stattdessen drängten niederländische und andere Kaufleute auf den Markt und sicherten sich um 1600 besondere Konzessionen, um die spanischen Atlantikhäfen nutzen zu dürfen. Fünfzig Jahre später lebten in Spanien 120 000 Ausländer, die meisten davon in Sevilla, wo sie ein Zehntel der Einwohnerschaft ausmachten.
Silber: der Lebenssaft des Riesenreiches Obwohl die Kolonialwirtschaft sich mit der Zeit durchaus diversifizierte, blieb der Silberhandel das wirtschaftliche Hauptinteresse der Spanier. Zwischen 1540 und 1700 produzierte die Neue Welt 50 000 Tonnen Silber, wodurch sich der europäische Silberbestand binnen vergleichsweise kurzer Zeit verdoppelte. Der Export des wertvollen Metalls kam richtig ins Rollen, nachdem zuerst reichhaltige Vorkommen im bolivianischen Potosí (1545) sowie im mexikanischen Zacatecas (1548) entdeckt worden waren und die Einführung deutscher Abbaumethoden im Jahr 1555 – man benutzte nun Quecksilber, um das Edelmetall aus dem Erz zu lösen – die Effizienz des Silberbergbaus erhöht hatte. Zacatecas bezog sein Quecksilber aus Almadén in Spanien, aber in Potosí schnellte die Förderrate geradezu in die Höhe, nachdem in Huancavelia in Peru Quecksilberminen eröffnet worden waren.83 Der Bergbau von Potosí beruhte auf Zwangsarbeit nach dem System der mita, nach welchem die Ureinwohner genötigt wurden, alle sieben Jahre vier Monate lang in den Minen zu arbeiten. Die Todesraten waren immens; jeden Tag starben 40 Arbeiter an Krankheiten, giftigen Dämpfen und Überarbeitung. Die Arbeitseinsätze auf 6000 Metern Höhe dauerten jeweils sechs Tage am Stück. Immer mehr indigene Dorfgemeinschaften kauften sich von der Dienstpflicht frei, indem sie einen Tribut zur Anwerbung von Lohnarbeitern entrichteten, die um 1600 schon mehr als die Hälfte der Bergleute ausmachten. Aber das System wurde noch immer von einer korrupten einheimischen Elite kontrolliert, die auch nicht davor zurückschreckte, einen königlichen Berginspektor mit einer Tasse vergifteter Trinkschokolade zu ermorden. Das Silber wurde auf den Rücken Tausender Lamas und Maultiere von den Bergen hinunter nach Arica an der Pazifikküste transportiert, wo es abgeladen wurde und im Gegenzug Quecksilber sowie Vorräte für den Rücktransport aufgeladen wurden. Während die Karawane sich wieder die steilen Andenpfade hinaufquälte, wurde das kostbare Silber nach Panama im Norden verschifft, um dort über die Landenge transportiert zu werden, damit man es schließlich mit dem Schiff nach Sevilla bringen konnte. Versuche des spanischen Vizekönigs vor Ort, die entsetzlichen Arbeitsbedingungen in der Quecksilbermine von Huancavelia zu verbessern, trugen in Potosí ab 1591 zu verstärkten Produktionsschwankungen bei; ab 1605 ist ein stetiger Rückgang der Fördermenge zu verzeichnen. Der Spitzenwert von 7,7 Millionen Pesos im Jahr war 1592 erreicht gewesen; 1650 waren es nur noch 2,95 Millionen. Dieser Einbruch wurde jedoch durch Zacatecas ausgeglichen, wo die Fördermenge sich ab 1615 durch einen Zuwachs an Arbeitskräften deutlich erhöhte. Allerdings blieb die mexikanische Silberproduktion stets von spanischem Quecksilber abhängig, was sie anfällig machte, sobald der Seeweg nach Europa aus irgendeinem Grund versperrt war.
Die Lebensader der spanischen Kolonien war ein 1564 eingeführtes Konvoisystem, das in den meisten Jahren zwei Flotten über den Atlantik führte. Die eine Flotte, galeones genannt, verließ Sevilla im August, segelte auf Kurs Südwest der afrikanischen Küste zu und passierte die Kanarischen Inseln, um den günstigen Passatwind auszunutzen, der sie – mit Kurs genau nach Westen – direkt zu den Islas de Sotavento, den karibischen „Inseln unter dem Winde“, brachte. Von dort steuerten sie in Richtung Südwesten entweder Cartagena im heutigen Kolumbien oder Portobello in Panama an. Insgesamt dauerte die Reise von umgerechnet 6880 Kilometern etwa acht Wochen. Im Normalfall wurde der Transport von einem Geschwader aus acht Kriegsschiffen begleitet, die rund 2000 Matrosen und Marinesoldaten mit sich führten; die größeren Handelsschiffe waren jedoch auch selbst bewaffnet. Nachdem sie das Silber aus Potosí abgeholt hatten, dazu Cochenille (einen wertvollen karmesinroten Farbstoff, der aus einer in Lateinamerika vorkommenden Schildlausart gewonnen wurde) und andere Kolonialerzeugnisse, überwinterte die Flotte in Havanna, bevor sie sich im Frühjahr auf den Rückweg nach Sevilla machte. Die andere Flotte, flota genannt, verließ im April oder Mai mit zwei Kriegsschiffen den Hafen von Cadiz. Bis zu den Inseln unter dem Winde verlief ihre Route wie jene der galeones; dann jedoch nahm die flota Kurs nach Nordwesten, um in Hispaniola, Kuba und dann Veracruz in Mexiko anzulegen, wo sie das Quecksilber aus Almadén ablieferte und das Silber aus Zacatecas an Bord nahm. Beide Flotten mussten auf ihrer Heimreise über Kuba auch den Bahama-Kanal passieren, wegen drohender Hurrikane und tückischer Riffe die gefährlichste Partie der gesamten Rückfahrt. Die galeones fuhren während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 29 Mal über den Atlantik und zurück, aber nur zweimal – 1628 und 1656 – fiel der Silberkonvoi feindlichen Angriffen zum Opfer. Um 1600 hatte der spanische Handel mit den beiden Amerikas ein Volumen von rund zehn Millionen Dukaten im Jahr erreicht; das war in etwa doppelt so viel, wie die Portugiesen im Handel mit ihren ostindischen Besitzungen erlösten.
Auch die Portugiesen setzten ein Konvoisystem ein, cafila genannt, um ihren Anteil an dem überaus lukrativen Gewürzhandel zu sichern, dessen Routen über den Indischen Ozean und rund um Afrika verliefen. Außerdem bauten sie Stützpunkte bei Axim (Fort São Antonio) und Elmina (São Jorge da Mina) an der westafrikanischen Goldküste (im heutigen Ghana), um auch den Handel mit Gold und Sklaven unter ihre Kontrolle zu bringen. Weitere Forts errichteten sie an der Mündung des Kongo sowie 1617 bei dem südlich von Luanda an der Küste Angolas gelegenen Benguela. Die Kommunikationswege nach Portugal waren durch den Besitz der Kapverdischen Inseln und von São Tomé gesichert. Wie im Fall anderer Kolonialmächte auch hing das Wohl und Wehe der portugiesischen Expansion ganz von einem guten Verhältnis zu den einheimischen Machthabern ab. In Angola war das etwa der König von Ndongo östlich von Luanda. Den Zugriff auf das Landesinnere eröffneten ihnen die Imbangala, von den Portugiesen „Jaga“ genannt, die fern der Küste auf Sklavenjagd gingen, um ihre grausige Beute dann an den portugiesischen Handelsstationen einzutauschen. Bereits Mitte des 15. Jahrhunderts importierten die Portugiesen mehr als 700 afrikanische Sklaven pro Jahr; 1535 begannen sie, diese auch nach Brasilien zu verschiffen. Ein Sklave kostete etwa 400 Pesos, was acht Monatslöhnen eines Indio-Arbeiters entsprach. Ab den 1570er-Jahren wurden Sklaven in großer Zahl nach Lateinamerika verschleppt, um dort Ersatz für die rapide schwindende einheimische Bevölkerung zu schaffen. Ihr Vordringen in das Innere des Kongos sowie nach Angola hinein ermöglichte es den Portugiesen, in den 1620er-Jahren 4000 Sklaven im Jahr zu verschiffen; zu diesem Zeitpunkt hatten afrikanische Arbeitskräfte auf den brasilianischen Zuckerplantagen bereits die letzten indigenen Zwangsarbeiter ersetzt. Bis zum Verbot des Sklavenhandels im Jahr 1850 sollten mindestens 3,65 Millionen Menschen auf diese Weise nach Brasilien verschleppt werden. Sklaven wurden unentbehrlich für die brasilianische Wirtschaft, die überhaupt erst mit dem Zuckerboom um 1600 zu florieren begann. Schon um 1628 wurden 300 Schiffe benötigt, um die jährliche Zuckerernte im Wert von 4 Millionen Cruzados nach Portugal zu transportieren. In der Folge verdreifachte sich die durchschnittliche Jahresproduktion bis 1650 auf 40 000 Tonnen, die neun Zehntel der brasilianischen Exporterlöse abwarfen. Bis zum Erstarken der karibischen Konkurrenz im Zuckerrohranbau zu Beginn des 18. Jahrhunderts blieb diese Situation im Wesentlichen unverändert. Die portugiesische Kolonie in Brasilien expandierte, ausgehend von ihrem Hauptstützpunkt Salvador da Bahia, entlang der Küste nach Norden, wo sich im Gebiet von Pernambuco etwa zwei Drittel des Zuckerrohranbaus konzentrierten.
So eindrucksvoll diese kolonialen Expansionsbewegungen auch waren, blieb doch Spanien mitsamt seinen europäischen Herrschaftsbereichen das wahre finanzielle Fundament des Weltreiches. Trotz einer stagnierenden Wirtschaft und ineffizienter Verwaltungsstrukturen konnte das spanische Mutterland zwischen 1566 und 1654 stolze 218 Millionen Dukaten für den Krieg in Flandern aufbringen, während die Einkünfte aus dem lateinamerikanischen Silberabbau sich in derselben Zeit auf gerade einmal 121 Millionen beliefen.84 Um 1600 warfen direkte und indirekte Steuern, welche die kastilischen cortes (Ständeversammlungen) bewilligt hatten, 6,2 Millionen Dukaten im Jahr ab. Die wichtigste dieser Steuern war die 1590 eingeführte Verbrauchssteuer millones, die zwischen 1621 und 1639 ein Gesamtvolumen von 90 Millionen Dukaten erzielte – dreimal so viel, wie in derselben Zeit die transatlantischen Silberimporte einbrachten. Im Gegensatz dazu trugen Katalonien, Valencia und Aragón so gut wie nichts zum Staatshaushalt bei, weil ihre regionalen Ständeversammlungen sich weigerten, regelmäßige Steuerzahlungen an die Krone zu bewilligen. Die Kirche zahlte drei verschiedene Steuern, die als die drei päpstlichen Gnaden (Tres Gracias) bekannt waren und sich jährlich auf etwa 1,6 Millionen Dukaten beliefen. Die spanischen Niederlande steuerten 3,6 Millionen bei, das Herzogtum Mailand rund 2 Millionen und das Königreich Neapel 4 Millionen; allerdings wurden diese Summen in den meisten Fällen durch die Kosten der Landesverteidigung am Ort gleich wieder aufgezehrt. Im Gegensatz zu den genannten Summen spülte der Silberhandel an der Schwelle zum 17. Jahrhundert gerade einmal 2 Millionen Dukaten pro Jahr in die spanische Staatskasse, da der König lediglich den Überschuss aus den Finanztöpfen der einzelnen Kolonien erhielt, zuzüglich eines gewissen Anteils an den (wesentlich größeren) privaten Warenlieferungen, die in Sevilla eintrafen. Der Realwert des aus der Neuen Welt importierten Silbers stellte die Kreditversorgung auf den spanischen Märkten sicher, denn die Geldverleiher glaubten fest, dass die Krone ihre rasch anwachsenden Schulden eines Tages mit zukünftigen Silberlieferungen würde bezahlen können. Die Kreditgeber erhielten sogenannte consignaciones, das waren Anrechte auf bestimmte künftige Einnahmen, oder juros, das waren festverzinsliche Staatsanleihen. Letztere entwickelten sich zu einer Art fundierter Schuld, weil sie durch genuesische Bankiers, die bis 1670 die meisten externen Kreditangelegenheiten der spanischen Könige managten, langfristig auf dem internationalen Finanzmarkt platziert wurden.
Das Grundmuster war bereits Mitte des 16. Jahrhunderts fest etabliert: Nur ein Bruchteil der laufenden Ausgaben konnte durch die ordentlichen Einnahmen gedeckt werden, ein wesentlich größerer Anteil stammte aus der Aufnahme von Schulden, wobei die Erträge aus dem Silberimport als Sicherheit für die Kredite eingesetzt wurden. Das politische Kalkül verdrängte das ökonomische in dem Maße, in dem das Finanzwesen ganz vom öffentlichen Vertrauen auf die zukünftige Bonität der Krone abhängig wurde – und die Schulden der Krone waren enorm. Sobald dieses öffentliche Vertrauen erschüttert wurde (was durchaus vorkam), war Bankrott die Folge – so geschehen 1559, als die Staatsschulden sich auf 25 Millionen Dukaten beliefen, oder beim Tod Philipps II. im Jahr 1598, als sie auf 85 Millionen Dukaten (das Zehnfache der durchschnittlichen jährlichen Staatseinnahmen) angewachsen waren. Die dringende Notwendigkeit, ihre Bonität aufrechtzuerhalten, zwang die spanische Krone zu einer Reihe von Notlösungen, um finanzielle Engpässe zu überbrücken. Sowohl auf der Iberischen Halbinsel als auch in den Kolonien konnte man sich Ämter und Würden ganz einfach kaufen. Das betraf zwar vor allem die Aufnahme in den untitulierten Adel, aber zwischen 1625 und 1668 wurden auch 169 neue Adelstitel geschaffen, was die spanische Aristokratie binnen Kurzem auf das Doppelte ihrer vorherigen Größe anschwellen ließ. Königliche Anrechte in 3600 kastilischen Städten und Dörfern wurden verpfändet, während so gut wie überall im Herrschaftsbereich der spanischen Habsburger weite Teile des Zollwesens privatisiert wurden. Abgesehen von der so dringend benötigten Liquidität brachten diese Behelfsmaßnahmen die Herausbildung einer neuen Elite mit sich, die ein ganz persönliches Interesse mit dem transatlantischen Silberhandel verband – schließlich waren die meisten von denen, die nun Adelstitel und Privilegien erwarben, mit Silber reich geworden. Infolgedessen wurde es immer schwieriger, Veränderungen an dem bestehenden Handelssystem vorzunehmen, ohne dabei zugleich die wichtigsten Geldgeber der Krone zu verprellen. Außerdem schmälerten die Behelfslösungen das langfristige Einkommen, zum Beispiel dadurch, dass sie den Anteil des steuerbefreiten Adels an der kastilischen Bevölkerung auf zehn Prozent anwachsen ließen. Die spanischen Könige hatten ein Monster in die Welt gesetzt, das in Afrika wie in Lateinamerika Tausende unschuldiger Leben verschlang, ihre europäischen Untertanen über Gebühr belastete – und dem letztlich auch sie selbst nicht entkommen konnten.
Wie verteidigt man ein Weltreich? All diese Wirtschaftsbemühungen dienten letzten Endes zur Aufrechterhaltung des spanischen Imperialismus. Die Militärausgaben stiegen von 7 Millionen Dukaten im Jahr 1574 auf 9 Millionen Dukaten zu Beginn der 1590er-Jahre an. Zwischen 1596 und 1600 wandten die Spanier 3 Millionen Dukaten im Jahr allein zum Unterhalt ihrer Flandernarmee auf; insgesamt verschlang der Krieg in den Niederlanden zwischen dem Tod Philipps II. 1598 und dem Waffenstillstand von 1609 satte 40 Millionen Dukaten. Im Jahr 1600 zählten die auf der ganzen Welt verteilten spanischen Truppen rund 100 000 Mann, davon allein 60 000 in der Flandernarmee, der größten aktiven Streitmacht Europas. Während der letzten beiden Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts stieg Spanien zudem zur weltweit führenden Seemacht auf. Spanische Schiffe spielten eine entscheidende Rolle beim Sieg der Heiligen Liga über die Osmanen in der Seeschlacht von Lepanto 1571. Nachdem die osmanische Mittelmeerflotte vor Lepanto zerschlagen worden war, konnten die Spanier ihre ständige Präsenz im Mittelmeer auf etwa 20 Galeeren zurückfahren, die durch kleinere Geschwader mit Heimathäfen in Sizilien, Neapel und Genua verstärkt wurden. Nachdem der gescheiterte Invasionsversuch der Spanischen Armada in England 1588 das Fehlen moderner Kriegsschiffe offenbart hatte, flossen zusätzliche Ressourcen in den Aufbau einer neuen Hochseeflotte, der Armada del Mar Océano. Die neue Millones-Steuer ermöglichte die Kiellegung von Schiffen mit einer Gesamttonnage von 56 000 Tonnen, wovon die meisten zwischen 1588 und 1609 in La Coruña an der spanischen Nordküste gebaut wurden; schon 1600 stand eine Flotte von 60 großen Kriegsschiffen bereit.85 Diese wurde in drei ungefähr gleich große Geschwader aufgeteilt, deren eines von Lissabon aus auf dem Atlantik patrouillierte, als zusätzlicher Schutz für die beiden wertvollen Silberkonvois. Ein zweites Geschwader schützte die Straße von Gibraltar und sicherte so die Zufahrt zum Mittelmeer, während das dritte in La Coruña stationiert war und von dort aus gegen Frankreich und die protestantischen Seemächte eingesetzt werden konnte. Ein kleines Pazifikgeschwader von sechs Schiffen wurde 1580 aufgestellt, um die Silbertransporte zwischen Arica und Panama zu schützen. Bemühungen um ein ähnliches Geschwader in der Karibik zerschlugen sich, da die hierfür vorgesehenen Schiffe immer wieder zu Geleitschutzaufgaben in den Atlantik abkommandiert wurden.
Der rapide Ausbau der spanischen Marine ließ deren Personalbedarf bis 1590 auf 27 000 Mann anwachsen – zu einer Zeit, in der auch die spanische Landarmee händeringend Rekruten suchte und das Bevölkerungswachstum in Kastilien stagnierte. Der frühere Strom von Freiwilligen drohte zu versiegen, was das traditionelle Rekrutierungssystem infrage stellte: Bisher hatte man einzelne Offiziere per Kommission beauftragt, sich ihre Einheiten selbst zu rekrutieren. Nun modifizierte die Krone ihr Vorgehen, indem sie zwar die Lenkung von Armee und Kriegsmarine in der eigenen Hand behielt, bei zentralen Aspekten der Rekrutierung, Logistik und Rüstungsbeschaffung jedoch Outsourcing betrieb. Philipp II. engagierte den ortsansässigen Adel und die Magistrate zur Rekrutierung von Soldaten und bemühte sich außerdem um eine Reaktivierung der zwischenzeitlich aufgelösten Milizen, um im Hinterland entlegenerer Provinzen wie Katalonien, der iberischen Levante, Andalusien oder Galicien ein gewisses Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Unterdessen wurde ab 1598 nach und nach das staatliche Monopol in der Rüstungsproduktion aufgeweicht, das immerhin seit 1562 bestanden hatte. Bis 1632 waren – mit Ausnahme der Pulvermühle von Cartagena – alle Rüstungsbetriebe in private Hände übergegangen.86 Die Privatisierung bedeutete nicht unbedingt eine Schwächung. Zum Beispiel waren private Werften um 1630 in der Lage, ein Kriegsschiff für 31 Dukaten pro Tonne zu bauen und damit vier Dukaten günstiger, als es die königlichen Werften konnten. Auf ein ganzes Schiff gerechnet, bedeutete das eine Ersparnis von 2000 Dukaten. Allerdings waren derartige Effekte offenbar eher günstiger Zufall als das Ergebnis wirtschaftspolitischer Planung. Die spanische Krone sah sich schlicht zum Handeln gezwungen, weil sie ihre wachsenden Schulden nicht mehr in den Griff bekam.
Von den spanischen Staatseinkünften des Jahres 1598 konnte die Krone nur über 5,1 Millionen Dukaten direkt verfügen, weil die restlichen 4,1 Millionen bereits durch Zahlungsverpflichtungen an Gläubiger gebunden waren oder benötigt wurden, um fällige Staatsanleihen (juros) zu bedienen. In den Folgejahren wurde ein immer größerer Anteil des Steueraufkommens ausgegeben, bevor es überhaupt eingenommen war, was den „freien“ Budgetanteil bis 1618 auf gerade einmal 1,6 Millionen Dukaten zusammenschrumpfen ließ. Zugleich stiegen die Jahresausgaben auf 12 Millionen Dukaten an. Dem standen Gesamteinnahmen gegenüber, die beim Tod Philipps II. noch 12,9 Millionen Dukaten betragen hatten, bis 1621 aber auf 10 Millionen oder weniger abfielen. Philipp III. brach mit einer langen Tradition spanischer Solidität in der Währungspolitik, indem er im Jahr nach seiner Thronbesteigung 1598 minderwertigeres Geld schlagen ließ. Obwohl der König 1608 im Austausch gegen höhere Steuerbewilligungen zusagte, die vellón genannten Münzen, die aus einer Kupfer-Silber-Legierung bestanden, nicht mehr auszugeben, tat er es 1617 und 1621 erneut, wodurch „gute“ Münzen aus dem Verkehr gedrängt wurden: Die Leute wollten sie lieber nicht mehr hergeben. Auf lange Sicht machte die Krone so ein Verlustgeschäft, denn die Spanier zahlten ihre Steuern in vellón, während die Soldaten als Bezahlung nur gutes Silber akzeptierten. Die fundierten Schulden aus juros stiegen im Verlauf der Regierungszeit Philipps III. von 92 auf 112 Millionen Dukaten an, was jährliche Zinsschulden von 5,6 Millionen oder der Hälfte der ordentlichen Einnahmen bedeutete.
All diese Probleme ließen viele Spanier zu der Ansicht gelangen, dass – in den Worten des greisen Grafen von Gondomar – „das Schiff nun sank“ („se va todo a fondo“), und spätere Historiker haben diese latente Untergangsstimmung in ihren Darstellungen aufgegriffen. Wer in den 1590er-Jahren so etwas sagte oder schrieb, der bezog sich auf die antike Vorstellung eines gewissermaßen natürlichen Lebenszyklus der Staaten, in dem Aufstieg, Reife und schließlich der Niedergang aufeinander folgten. In Spanien fürchteten nun viele, ihrem Land stehe der Eintritt in die letzte Phase dieses Zyklus unmittelbar bevor. Zwar war man sich einig, dass grundsätzlich nur Gott den besagten Prozess umkehren könne; in der Frage jedoch, ob und wie weit menschliches Eingreifen imstande sei, ihn zu verlangsamen, gingen die Meinungen weit auseinander. Der königlichen Regierung fehlte es gewiss nicht an Ideen, denn beinah täglich gingen neue Vorschläge aus der Bevölkerung ein, wie man mögliche Schwächen vermeiden und bestehende Mängel beheben könne.87 Allen lag die reputación der spanischen Krone am Herzen, nicht zuletzt, weil der gute Ruf – nicht zu Unrecht – als Grundlage der spanischen Kreditwürdigkeit angesehen wurde. Weniger besorgt zeigte man sich mit Blick auf die noch fundamentaleren Probleme von Bevölkerungsschwund, wirtschaftlichem Verfall, Agrarkrise und Handelsflaute, die erst in der späteren historischen Forschung in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt sind. Während jedoch im geschichtswissenschaftlichen Denkmodell eines „spanischen Niedergangs“ der politische Einflussverlust schnell zur notwendigen Folge wirtschaftlicher Rückschläge erklärt wird, waren die spanischen Zeitgenossen des frühen 17. Jahrhunderts nicht über Gebühr pessimistisch. Sie erkannten zwar, dass die regelmäßige Zahlungsunfähigkeit ihres Königs zu solchen „Demütigungen“ wie dem 1609 geschlossenen Waffenstillstand mit den Niederländern führte; aber einen plötzlich bevorstehenden Zusammenbruch ihre Staates scheinen sie nicht erwartet zu haben. Spanien war noch immer ein vergleichsweise reiches Land, in dem es sich sehr gut leben ließ – zumindest galt das für die wenigen Glücklichen an der Spitze der spanischen Gesellschaft: Die 115 Granden des Königreiches verfügten zusammen über ein Jahreseinkommen von fünf Millionen Dukaten, was der Hälfte des Staatshaushalts entsprach. Auch besaß Spanien noch immer zahlreiche erfahrene Soldaten, Seeleute, Beamte und Diplomaten mit weitreichenden Kontakten in ganz Europa. Es blieb stark im Verhältnis zu seinem Hauptrivalen Frankreich, das bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts von schweren Krisen erschüttert wurde. Aber vor allem hatte Spanien bis 1621 offenkundig genug politischen und militärischen Schwung aufgenommen, dass sein „Weltreichskoloss“ sich sogar noch voranschob, als der Tank schon seit zwei Jahrzehnten leer war.
Die Sorge um die reputación bedeutet, dass jede Analyse der spanischen Weltmacht bei deren Monarchie ansetzen muss. Das spanische Majestätskonzept betonte die erhabene Natur eines Königtums, dessen Monarch von Gott eigens erwählt worden war, um zu herrschen, in der Verantwortlichkeit für sein eigenes Schicksal und das seiner Untertanen. Die Stände, Ratsversammlungen und anderen Instanzen, die in älteren Vorstellungen einer monarchia mixta noch eine so große Rolle gespielt hatten, waren zwar nicht verschwunden – aber sie unterstanden nun klar der Autorität des Königs, der wichtige Entscheidungen allein treffen sollte.88 Wie so oft hinkte die Praxis der Theorie weit hinterher. Philipp II. hatte versucht, seine Berater zur Zusammenarbeit zu zwingen, indem er absichtlich keinem einzelnen von ihnen besondere Gunst erwies, doch das drängte die persönlichen Rivalitäten lediglich in den Untergrund. Die Situation wurde dadurch noch verschärft, dass der König sich jegliche verfassungsmäßige Prüfung seines Handelns strikt verbat und etablierte Kontrollinstanzen einfach umging, indem er zur Erledigung bestimmter Aufgaben Ad-hoc-Komitees (juntas) einsetzte. Das konnte durchaus zu einem Gewinn an Flexibilität führen, schuf jedoch in der Regel nur weitere bürokratische Verkrustungen – Chaos und Kompetenzstreit waren die Folge. Hauptsächliches Diskussionsforum für alle Fragen der Politik war der Staatsrat (Consejo de Estado). Aus ihm ging eine große Zahl spezialisierter juntas hervor, von denen sich viele zu einer Art ständigem Ausschuss verfestigten. So gab es juntas für Verteidigungsfragen, Finanzen, den „Kreuzzug“ (der Gegenreformation) sowie für die verschiedenen Teile der Monarchie: einen Indienrat (Consejo de Indias, für West- und Ostindien) und entsprechende Räte für Portugal, Kastilien, Aragón, die italienischen Besitzungen und Flandern. Die Existenz etwa eines Flandernrates deutet bereits darauf hin, wie sehr das spanische Weltreich Stückwerk blieb, ein bunt zusammengesetzter Flickenteppich, in dem einzelne Vizekönige oder Gouverneure in den Niederlanden, dem Herzogtum Mailand, den Königreichen Neapel, Sizilien und Sardinien oder auch den Kolonien die Macht in Händen hielten. Um dem Nationalstolz der Portugiesen Genüge zu tun, gab es auch in Lissabon weiterhin eine Lokalregierung. Die Gouverneure, denen Beratergremien aus örtlichen Notabeln gegenüberstanden, waren in der Tat gut beraten, in Ausübung ihrer Pflicht die provinzeigenen Interessen und die Anweisungen aus Madrid gleichermaßen zu berücksichtigen, insbesondere da ihr eigenes Salär wie das ihrer Berater und Soldaten ganz vom örtlichen Steueraufkommen abhing.
Wenig überraschend kam der Verteidigung ihres Weltreichs in der Gesamtstrategie der Spanier die überragende Rolle zu.89 Die schiere Ausdehnung des spanischen Herrschaftsbereichs bedeutete eine Vielzahl potenzieller Feinde, während die Ausbreitung der protestantischen „Ketzerei“ das Gespenst innerer Unruhen heraufbeschwor – ein Gespenst, das nach dem Ausbruch des Niederländischen Aufstands schreckliche Wirklichkeit gewann. Auch der Aufwand zur Verteidigung des Handelsmonopols mit West- und Ostindien stieg nach dem Erwerb Portugals merklich an, denn nun bedurften die vormals portugiesischen Kolonien ebenfalls des spanischen Schutzes. Was den Spaniern allerdings ihr charakteristisches Sendungsbewusstsein verlieh, war das Gefühl, sie seien zur Verteidigung des Katholizismus berufen, ein Gefühl, das schon bald untrennbar mit dem spanischen Nationalbewusstsein verschmolzen war. Den Abschluss der Reconquista hatte 1492 die Zerschlagung des Emirats von Granada markiert, des letzten muslimischen Territoriums auf der Iberischen Halbinsel. Die spanischen Monarchen Isabella I. und Ferdinand II. durften sich dafür mit dem vom Papst verliehenen Titel einer „Allerkatholischsten Majestät“ schmücken. Durch ihre Eroberungen in Übersee fanden die Spanier sich unversehens in der Rolle von Missionaren wieder, die die Neue Welt christianisierten und „zivilisierten“. Der Seekrieg gegen die Osmanen auf dem Mittelmeer erhielt derweil das alte Kreuzzugsideal lebendig, das jedoch mit dem Kampf gegen die Häresie in ganz Europa eine neue Ausweitung erfuhr.
Die Mission zur Rettung des Katholizismus umfasste schließlich sogar die Eingliederung Roms selbst in das „informelle Imperium“ der Spanier, sprich: in jenen Einflussbereich, in dem sie zwar nicht nominell herrschten, aber doch hinter den Kulissen die Fäden zogen.90 Alles begann 1492 mit der Wahl des Borgia-Papstes Alexander VI., der zwei Jahre darauf im Vertrag von Tordesillas die Neue Welt zwischen Spanien und Portugal aufteilte. Diese Zweiteilung entwickelte sich zu einer regelrechten Symbiose der beiden Kolonialmächte, aus der Spanier wie Portugiesen ihren Vorteil zogen – wenngleich Spanien stets der dominante Partner blieb. In einer Zeit, in der andere Monarchen sich von Rom abwandten, blieb der spanische katholisch: Ferdinand respektierte den Papst. Die päpstliche Lehnsherrschaft über das Königreich Neapel erkannte Spanien formal an, indem die Spanier dem Heiligen Stuhl einen jährlichen Tribut von 7000 Dukaten und einem prächtigen Schimmel zollten; auch Einkünfte aus vakanten Bistümern im ganzen spanischen Machtbereich leitete man anstandslos an die Apostolische Kammer, die Staatskasse des Papstes, weiter. Rom war in wachsendem Maße auf Getreideimporte aus Sizilien und anderen spanischen Territorien angewiesen, und die Mildtätigkeit der Spanier finanzierte Armenkassen, Hospitäler und Kirchen auch in Rom selbst. Die spanische Gemeinde in Rom wuchs im späten 16. Jahrhundert auf ein Viertel der gesamten Einwohnerschaft an und gewann bald großen Einfluss im politischen und gesellschaftlichen Leben der Ewigen Stadt. Der spanische Botschafter beim Heiligen Stuhl veranlasste, dass die jährliche Übergabe des Tributpferdes aus Neapel ab 1560 im Rahmen der Feierlichkeiten zum Hochfest der Heiligen Peter und Paul stattfand, was Spanien symbolisch im Herzen der päpstlichen Politik verankerte. Zahlungen von bis zu 70 000 Dukaten im Jahr sorgten dafür, dass der spanische Botschafter im Kardinalskollegium immer auf offene Ohren traf und, wenn nötig, mit einem Abstimmungsergebnis nach dem Interesse seines Königs rechnen durfte. Obwohl die starke spanische Präsenz in Rom bei der Bevölkerung, gelinde gesagt, nicht auf Gegenliebe stieß, wussten die Päpste die Vorteile zu schätzen, die ihnen daraus erwuchsen. Unter Spaniens Schutz und Schirm konnten sie die eigenen Verteidigungsausgaben drastisch reduzieren: von über der Hälfte des päpstlichen Jahresbudgets auf weniger als ein Fünftel. Solange ein steter Geldstrom von Spanien nach Rom floss, floss sogar noch mehr Geld geradewegs in die spanischen Schatzkammern, und das mit ausdrücklichem Einverständnis des Papstes: Die „Drei Gnaden“ und andere Kirchensteuern brachten der spanischen Krone um 1621 satte 3,68 Millionen Dukaten im Jahr ein, was einem Drittel der ordentlichen Jahreseinnahmen entsprach.
Die engen Verbindungen zur römischen Universalkirche bekräftigten das globale Sendungsbewusstsein der spanischen Könige, das sich nicht hinter dem Herrschaftsanspruch der römisch-deutschen Kaiser zu verstecken brauchte. Obgleich der Kaisertitel Karls V. auf seinen Bruder in Österreich, nicht seinen Sohn Philipp in Spanien übergegangen war, schärfte dieses Vermächtnis doch das spanische Empfinden für (Welt-)Macht und Größe, und bis ins 17. Jahrhundert hinein wehte über spanischen Schiffen und Armeen die Fahne mit dem doppelköpfigen Reichsadler. Während der österreichische Familienzweig der Habsburger auch weiterhin den römisch-deutschen Kaiser stellte, verfolgten zeitgenössische spanische Autoren die Wurzeln ihrer eigenen Monarchie bis weit in vorrömische Zeiten zurück: Ein Sohn Noahs sei der erste König von Spanien gewesen.91 Den Kritikern erschien das spanische Machtstreben als ein Gespenst, das nicht nur in Europa umging und die Religion dabei als Deckmäntelchen zur Errichtung einer Universalmonarchie missbrauchte. Die Feinde Spaniens wussten so gut wie nichts von den zahlreichen Problemen, die das Land im Inneren plagten, und glaubten vielmehr, die Reichtümer der Neuen Welt würden den Spaniern bald eine Aufrüstung ermöglichen, vor der ihre eigenen Heere in einem großen Krieg zugrunde gehen müssten. Dies empfand man besonders stark in Frankreich, wo viele sich umzingelt fühlten: von Spanien im Süden, dem spanisch beherrschten Herzogtum Mailand und der Freigrafschaft Burgund (der Franche-Comté) im Osten, Luxemburg und Flandern im Norden, während die Spanische Armada im Westen den Atlantik abriegelte. In den Augen des protestantischen Europa symbolisierte die Fahrt der Armada gegen England 1588 die doppelte Bedrohung durch Willkürherrschaft und religiöse Verfolgung, und dieses Bild eines aggressiven Spanien hat in der späteren Geschichtsschreibung deutliche Spuren hinterlassen.
Spanien und das Reich Tatsächlich intervenierten die Spanier erst dann in anderen Ländern, wenn ihnen ihre Kerninteressen bedroht schienen, und in der Regel tendierte die Konsensmeinung im Staatsrat eher zu Vorsicht und Zurückhaltung. Das wird auch deutlich, wenn man sich die spanische Haltung dem Heiligen Römischen Reich gegenüber einmal genauer ansieht, die sich ganz entscheidend auf das Engagement der Spanier im Dreißigjährigen Krieg auswirken sollte.92 Philipp II. hatte die Jahre 1548–51 in Deutschland verbracht und kannte viele Fürsten des Reiches persönlich, ebenso Rudolf von Habsburg und seine Brüder Ernst und Albrecht, die er bei deren Aufenthalten in Spanien kennengelernt hatte. Diese persönlichen Kontakte bildeten auch in der Zeit nach der Spaltung des Hauses Habsburg 1558, als Spanier und Österreicher je eigene Interessen entwickelten, eine solide Grundlage für die spanische Diplomatie. Selbst Philipps stark ausgeprägter Katholizismus konnte eine gute Zusammenarbeit mit konservativ-lutherischen Fürsten wie etwa Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel oder dem sächsischen Kurfürsten August nicht verhindern. Zum Herzog von Bayern und anderen führenden Katholiken des Reiches unterhielt Philipp gleichfalls gute und produktive Beziehungen. Der spanische König hatte allerdings kein Interesse daran, im Reich eine permanente Präsenz aufzubauen. Eher versuchte er – wie schon im Fall des Heiligen Stuhls –, seine Beziehungen spielen zu lassen, um ein möglichst reibungsloses „Durchregieren“ der mit ihm verbündeten Fürsten zu ermöglichen, etwa indem er durch Geldzahlungen oder andere Geschenke die öffentliche Meinung am Ort zu deren Gunsten beeinflussen ließ. Insbesondere konzentrierte er sich darauf, im Reich eine pro-spanische Partei unter der Führung Bayerns und Kurkölns zu etablieren, die mobilisiert werden konnte, um kaiserliche Initiativen zu blockieren, wenn diese den spanischen Interessen zuwiderliefen. Auch bei der Platzierung oder Anwerbung von Fürsprechern an Rudolfs Prager Hof hatte Philipp einigen Erfolg. Der böhmische Oberstkanzler Fürst Lobkowitz war mit Hurtado de Mendoza verschwägert, dem vormaligen spanischen Botschafter am Kaiserhof, während der Kardinal Franz Seraph von Dietrichstein nicht nur in Spanien geboren, sondern auch mit der einflussreichen katalanischen Adelsfamilie Cardona verwandt war. Wie wir gesehen haben (in Kapitel 3), waren solche Verbindungen von höchstem Nutzen, als es darum ging, von 1598 an Rudolf zu einer Unterstützung der militanten Katholiken in Böhmen und Ungarn zu bewegen.
Die Protestanten argwöhnten damals, eine finstere Intrige unter spanischpäpstlicher Federführung sei im Gang, aber die meisten derer, die damals als Angehörige der „spanischen Partei“ gebrandmarkt wurden, wollten in Wirklichkeit nur die Machtposition Österreichs stärken und kooperierten mit Madrid daher auch nur so weit, wie es ihren eigenen Interessen entsprach. Als der Kaiserhof nach Rudolfs Tod 1612 wieder von Prag nach Wien zog, nahm auch der spanische Einfluss ab. Der neue spanische Botschafter Zúñiga knüpfte zwar Beziehungen zu dem steirischen Erzherzog Ferdinand, doch die innerösterreichische Linie der Habsburger blieb München enger verbunden als Madrid. Sowohl Ferdinands Mutter als auch seine erste Frau waren bayerische Prinzessinnen gewesen, während in kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht das nahe gelegene Italien einen stärkeren Einfluss auf den Grazer Hof ausübte, als Spanien es gekonnt hätte. Dies änderte sich auch nicht, als 1619 der Kaisertitel auf die innerösterreichischen Habsburger überging, und obwohl die spanische Ehefrau Ferdinands III. ein gewisses Interesse an der iberischen Kultur wach werden ließ, blieb Italien das ganze 17. Jahrhundert hindurch in Wien tonangebend.93 Dazu passte, dass auch die österreichische Präsenz in Spanien immer weiter abnahm. Noch Maximilian II. hatte gleich drei seiner Söhne nach Madrid geschickt, damit sie dort eine spanische Erziehung genössen; und ausgerechnet Albrecht, der als Einziger zu Hause geblieben war, wurde im Urteil seiner Zeitgenossen „mehr Spanier als Österreicher“. Weder Rudolf noch Matthias hatten Kinder, die sie ihrerseits nach Spanien hätten schicken können, und beiden war die spanische Einflussnahme im Reich ein Dorn im Auge. Die Österreicher unterhielten zwar eine Vertretung in Madrid, aber im Gegensatz zu ihrer Gesandtschaft bei der Hohen Pforte in Konstantinopel war jene nicht ständig besetzt. Margarete von Österreich, eine Schwester Ferdinands von Steiermark, heiratete 1599 Philipp III. von Spanien. Durch acht Schwangerschaften hindurch wusste sie sich die Aufmerksamkeit ihres Gatten zu sichern, aber nach ihrem frühen Tod 1611 reduzierte sich die österreichische Präsenz in Spanien auf eine weitere Habsburgerin namens Margarete, genannt „Margarete vom Kreuz“, die jüngste Tochter Maximilians II. und damit jüngste Schwester Matthias’ von Habsburg, die als Nonne im Kloster Descalzas Reales in Madrid lebte und den Kindern der ersten Margarete zur Ersatzmutter wurde.
Ironischerweise nahm das spanische Interesse am Heiligen Römischen Reich ab, weil Philipp II. glaubte, Rudolf sei ein verlässlicher Katholik, der seine Sache besser machen werde als sein Vater Maximilian II. vor ihm. Bayern und Steiermark schienen ebenso zuverlässige Verbündete, während ein 1587 mit den katholischen Schweizer Kantonen geschlossenes Abkommen die strategische Bedeutung Tirols reduzierte, da den Spaniern nun eine Alternativroute über die Alpen zur Verfügung stand; eine mögliche Bedrohung der Kommunikationswege zwischen den verschiedenen spanischen Einflussbereichen gab immer Anlass zur Sorge. In den Ratschlägen, die für Philipp III. zu seiner Thronbesteigung 1598 vorbereitet worden waren, nahm Deutschland nur eine marginale Rolle ein und wurde außerdem auf eine Weise dargestellt, die den Analysen späterer Historiker radikal widerspricht.
Die protestantischen Reichsfürsten, hieß es etwa in dem Dokument, seien viel zu uneins, um gefährlich zu werden, während die Österreicher unfähig seien, auf eigene Faust zu handeln. Sie mochten zwar den Kaisertitel führen, seien aber inzwischen doch zu „Juniorpartnern“ innerhalb der Casa de Austria geworden. Vorausgesetzt, der spanische König lasse sie in Frieden, würden die Deutschen keinen Ärger machen. Nationale Vorurteile verstärkten die spanische Tendenz, sich lieber nicht in die inneren Angelegenheiten des Reiches einzumischen. Die Berichte der spanischen Botschafter zeichneten das Bild eines Landes, das im moralischen Verfall begriffen war. Die katholischen Fürsten des Reiches, hieß es, liebäugelten bereits mit der Heterodoxie und hätten es überdies versäumt, ihren vollen Anteil der Kosten des Türkenkrieges zu bezahlen. Die Deutschen überhaupt seien rückständig und bäurisch, könnten nichts, als fettes Essen in sich hineinzustopfen und Bier gleich fassweise zu saufen; die lichten Höhen der kastilischen Zivilisation würden sie niemals erreichen. Aber sie lebten ja auch in einem verregneten Land voller düsterer Wälder, schlammiger Straßen und völlig überteuerter, dabei aber ungastlicher Wirtshäuser.
Anders als sein Vater besaß Philipp III. keinerlei persönliche Kenntnis des Heiligen Römischen Reiches, und entsprechend noch weniger Raum nahm das Reich im politischen Kalkül des Sohnes ein. Man hat den jungen Monarchen den faulsten Herrscher, den Spanien jemals hatte, genannt, worin wohl der Stoßseufzer Philipps II. nachklingt: „Gott, der mir so viele Königreiche gegeben hat, hat mir keinen Sohn gegeben, der fähig wäre, sie zu regieren.“94 Nach anfänglichem Interesse, das jedoch nur von kurzer Dauer war, legte Philipp die Regierungsverantwortung – so die vorherrschende Meinung – in die Hände seines Favoriten, des Grafen (und späteren Herzogs) von Lerma, und zog sich in eine Privatwelt aus Selbstverherrlichung und Narzissmus zurück. Dies führte in den Worten eines neueren Historikers dazu, dass „in Madrid überhaupt niemand regierte; ein ganzes Weltreich lief auf Autopilot“.95 Eine solche Kritik ist nicht nur ungerecht, sie unterstellt auch einen Unterschied – den es so aber nicht gegeben hat – zwischen einem angeblich tatkräftigen und durchsetzungsstarken Spanien unter Philipp II. und einem verfallenden Königreich mit dessen Sohn an der Spitze. Dabei nahm Philipp III., seit er 15 war, fast täglich an den Sitzungen des Staatsrats teil und zeichnete für seinen immer kränklicheren Vater schon seit 1597 wichtige Dokumente. Von seinem Vater geerbt hatte er dessen ausgeprägtes Majestätsgefühl und wollte deshalb bei allen Entscheidungen von Gewicht das letzte Wort behalten. Der wahre Unterschied zwischen Vater und Sohn lag jedoch in der realistischeren Herangehensweise Philipps III., als es darum ging, diesen absolutistischen Anspruch auch in die Tat umzusetzen. Als König konzentrierte er sich ganz auf die symbolische Repräsentation von Macht, indem er die ohnehin schon strengen Vorstellungen seines Vaters von Unnahbarkeit, Erhabenheit und Stolz eines Monarchen noch einmal steigerte – und zwar dadurch, dass er den leibhaften König einfach aus der Regierungsgleichung strich. Alle tagespolitischen Aufgaben wurden dem Herzog von Lerma übertragen, der sich nun mit den verschiedenen Ministern und juntas auseinanderzusetzen hatte.
Lerma war auf einem klassischen Weg an die Macht gelangt, indem er sich dem Gefolge des Thronerben angeschlossen und dann alles darauf angelegt hatte, sich unverzichtbar zu machen. Seine Karriere veranschaulicht all die typischen Schwachstellen eines Favoriten am Königshof, mithin eines Mannes, der viele Klienten, aber kaum Freunde hat. Lerma betonte seine eigene Größe, um sich von seinen Rivalen abzusetzen und die angeblich einzigartige Befähigung hervorzustreichen, die ihn zur rechten Hand Philipps III. hatte werden lassen. Das war jedoch ein schmaler Grat, denn sein arrogantes Auftreten ließ Lermas Feinde schnell behaupten, dieser wolle wohl dem König selbst den Rang ablaufen. Sein Einfluss wurde bereits zwischen 1606 und 1608 geschwächt, als sukzessive seine wichtigsten Verbündeten starben, sich aufs Altenteil zurückzogen oder arretiert wurden wie der Graf von Villalonga, der als Sündenbock für den Staatsbankrott von 1607 herhalten musste. Sogar der Dominikanermönch Luis de Aliaga, der Lermas Beichtvater gewesen war, wandte sich gegen ihn, als er 1608 Beichtvater des Königs wurde. Die Kritik wurde stärker, als Lerma 1609 den Zwölfjährigen Waffenstillstand mit den Niederländern schloss, wodurch auf absehbare Zeit alle Versuche, deren Aufstand niederzuschlagen, eingestellt waren.