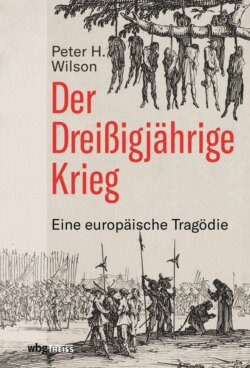Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Peter H. Wilson - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Verteidigung von Heim und Herd übernahmen städtische Bürgerwehren, „Schützen“ (schutters) genannt, die in den 1570er-Jahren neu organisiert wurden und sich aus den Bürgern und anderen wohlhabenden Einwohnern der Städte rekrutierten. Zwar konnte man sich vom Dienst in diesen Einheiten freikaufen, doch es wurde bald zur Ehrensache jedes aufrechten Republikaners, „gedient“ zu haben – männerbündische Geselligkeit und Verbrüderung spielten gewiss auch eine Rolle. Die Schützengilden beauftragten oft namhafte Künstler, ihre Gruppenporträts zu malen; das berühmteste Beispiel ist wohl Rembrandts Die Kompanie des Hauptmanns Frans Banning Cocq, besser bekannt als Die Nachtwache. Im Feld wurden statt dieser Kompanien allerdings reguläre Truppenverbände der einzelnen Provinzen eingesetzt, die unter dem Oberbefehl ihres Generalkapitäns, des Fürsten von Oranien nämlich, zu einer Armee vereint wurden.
Die oranische Heeresreform Obwohl diese Vereinigung der Provinztruppen bereits im November 1576 geschah, nahm die so geschaffene Gesamtarmee doch erst ein Jahrzehnt später, unter dem Befehl Moritz’ von Nassau, tatsächlich Gestalt an.108 Der junge Prinz war nach der Ermordung Wilhelms von Oranien völlig unerwartet als Statthalter von Holland und Zeeland an die Macht gelangt, weil sein älterer Bruder Philipp Wilhelm sich in spanischer Geiselhaft befand und deshalb nicht die Nachfolge antreten konnte. Der Titel eines Generalkapitäns blieb ihm verwehrt, weil Friesland, Utrecht und Gelderland sich für andere Statthalter entschieden, wodurch das nominell auf eine Person vereinigte Oberkommando der niederländischen Armee aufgespalten wurde. Dennoch erhielt Moritz die politische Unterstützung Hollands, weil Johan van Oldenbarnevelt sich für ihn einsetzte, und ging aus dieser Übergangsphase als der dominierende Heerführer und Vertreter des Hauses Oranien in der niederländischen Politik hervor. Sein Name wird für immer mit einer Reihe von Militärreformen verbunden sein, die nicht nur die niederländische Kriegführung dauerhaft prägten, sondern auch beträchtlichen Einfluss auf die Heeresorganisation in Deutschland und Schweden ausübten. Zwar sollten diese Reformen ein Problem beheben, das in ganz Europa verbreitet war; weil sie in den Niederlanden aber früher zum Erfolg führten als ähnliche Bemühungen in anderen Ländern, wurde die oranische Heeresreform zum Vorbild der Zeitgenossen, später dann zum Bezugspunkt für die historische Forschung.109
Moritz war bestrebt, sich den disziplinierten Zusammenhalt von Söldnerverbänden zunutze zu machen, wollte sie zugleich jedoch einer festen politischen Kontrolle unterwerfen. Seine Maßnahmen stellten den Versuch dar, alte und neue Erkenntnisse aus Philosophie, Naturwissenschaft und Medizin zur Lösung gegenwärtiger Probleme praktisch anwendbar zu machen. Die Denker und Gelehrten des späten 16. Jahrhunderts waren von der Vorstellung fasziniert, die Aufdeckung verborgener Gesetzmäßigkeiten in der Natur werde ihnen Einblick in die innersten Geheimnisse von Gottes Schöpfung gewähren. Diese frühmoderne Form der Rationalität verband sich mit der späthumanistischen Relektüre antiker Autoren, denn auch in den Schriften der Griechen und Römer vermutete man Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart. Ihre deutlichste Ausprägung fanden diese beiden Denkansätze im Werk von Justus Lipsius, der an der Universität Leiden lehrte, wo Moritz von Oranien studiert hatte, und der dem Fürsten 1589 sein Werk Politicorum sive civilis doctrinae libri sex („Sechs Bücher über Politik“) präsentierte.110 Wie viele Europäer seiner Generation war Lipsius entsetzt über die konfessionelle Gewalt, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts immer wieder aufflackerte. Er durchforstete die antike Literatur auf der Suche nach einem „Heilmittel“ und stieß schließlich auf die Philosophie der griechischen und römischen Stoa, die er zum Neustoizismus weiterentwickelte. Lipsius glaubte, dass ihre Leidenschaften die Menschen blind für ihr gemeinschaftliches Bestes machten, woraus dann irrationale Gewaltausbrüche folgten. Folglich sei es geboten, jegliche Emotion zu unterdrücken: am besten durch eiserne Selbstdisziplin; falls das jedoch nicht gelinge, durch äußeren Zwang. Mit einer Interpretation der römischen Geschichte – namentlich der Kaiserzeit und des Imperium Romanum – erweiterte Lipsius seine Philosophie zu einem Plädoyer für einen entschlossenen, zugleich aber verantwortungsbewussten Regierungsstil, der dem Herrscher die Verpflichtung auferlegte, seine Untertanen von gegenseitiger Schädigung abzuhalten und äußere Gefahr von ihnen abzuwenden. Ihre besondere Schlagkraft bezogen solche Ideen aus dem Umstand, dass sie mit hohen Dosen genau jener christlichen Moralvorstellungen kombiniert wurden, deren umfassende Geltendmachung protestantischen wie katholischen Reformern ein Herzensanliegen war.
Auf dieser Basis also formulierte Lipsius sein Konzept von Disziplin, das sich in vier Elemente gliederte. Deren erstes war der Drill. Drill hatte die römischen Legionen unbesiegbar gemacht, und Drill sollte auch jetzt angewandt werden – nicht nur bei der Ausbildung an der Waffe, sondern ganz allgemein, um Soldaten den Gehorsam innerhalb einer disziplinierten Einheit zu lehren. Eine solche Denkweise musste sich auf andere Lebensbereiche ebenfalls auswirken. Tatsächlich veränderte sich etwa die Tanzmode, weg vom Formationstanz in Reihen, bei dem die Tanzpartner geschwind miteinander interagierten, hin zu kreisförmigen oder anderen geometrischen Bewegungsmustern, bei denen die einzelnen Tänzer den ihnen zur Verfügung stehenden Raum besser ausnutzten. Unnötige Bewegungen sollten vermieden werden, indem der Tänzer – oder der Soldat – nur Teile seines Körpers bewegte; der Rest verblieb in einem stabilen Gleichgewicht. So trichterte man etwa den Pikenieren ein, sie sollten, wenn sie ihren Spieß nach vorn stießen, den Kopf nicht rühren, sondern starr geradeaus blicken, genau auf einer Linie mit ihren Nebenmännern. Ordnung bildete das zweite Element, denn man brauchte eine hierarchische Befehlsstruktur, um die Bewegungen einzelner Soldaten und Truppenteile zu lenken und sicherzustellen, dass alle Rädchen im Getriebe der großen Militärmaschine funktionierten. Entscheidend war hierbei, dass die Geltung dieser neuen Ordnung sich auch auf die höheren Ränge erstreckte, die ihre Untergebenen nun nicht mehr behandeln sollten, wie es ihnen gerade passte. Drittens sollte der regelmäßige militärische Drill als Teil einer weiter gefassten Zwangsstrategie dazu dienen, die autonomen Strukturen der bestehenden Söldnerkultur aufzubrechen und die Verinnerlichung einer neuen Selbstdisziplin voranzutreiben. Das vierte und letzte Element zielte auf Strafen und Belohnungen. Die sogenannten Kriegsartikel, in denen der rechtliche Rahmen des Kriegsdienstes abgesteckt wurde, waren nun nicht mehr Ausdruck einer kollektiven Selbstorganisation der Soldaten, sondern wurden zu einem Mittel, die neue Militärkultur rasch zu institutionalisieren. Die neuen Kriegsartikel wurden von gelehrten Juristen formuliert und gingen mit neuen Zeremonien für Musterung und Fahneneid einher. Ihr Ziel war, an die Stelle der bisherigen Soldverhandlungen zwischen einzelnen Befehlshabern und ihren Truppen standardisierte Dienstverträge zu setzen, die alle Mannschaften in einen einheitlichen Rechtsrahmen einbanden.
Solche proto-absolutistischen Vorstellungen passten hervorragend zu der von geistlichen wie weltlichen Autoritäten verfolgten Sozialdisziplinierungs-Agenda; was Lipsius damit im Sinn hatte, war aber tatsächlich, den Krieg in Zukunft weniger grausam und schädlich zu machen. Seine Ideen machten die Heeresreform Moritz’ von Nassau intellektuell respektabel und fanden weite Verbreitung, weil die Niederlande – neben ihrer Bedeutung als Handelsmacht – auch ein Zentrum des frühneuzeitlichen Druck- und Verlagswesens waren. Der aus Antwerpen gebürtige Kupferstecher Jacob de Gheyn veröffentlichte 1607 eine später berühmt gewordene, illustrierte Gebrauchsanleitung für alle Arten von Waffen, die noch im selben Jahr in dänischer Übersetzung und im Jahr darauf auf Deutsch erschien, Letzteres unter dem Titel Waffenhandlung; Von den Röhren Mußquetten undt Spiessen; … Mit beygefügter schrifftlicher Vnterrichtung, wie alle Hauptleute und Befehlshabere ihre jungen vnd vnerfahrne Soldaten zur vollkommenen Handlung derselben Waffen desto besser abrichten köndten. Weitere praktische Handbücher folgten, so etwa drei aus der Feder von Johann Jacobi von Wallhausen, die 1615/16 erschienen und das ganze 17. Jahrhundert hindurch vielfach nachgedruckt oder wiederveröffentlicht wurden.111 Für eine noch größere Ausstrahlung sorgten die zahlreichen Freiwilligen, die von überall her in die Niederlande strömten, um in den Diensten Moritz’ von Nassau die Kriegskunst zu erlernen. Durch das Bündnis mit England und die Gründung der Republik war das Stigma der Rebellion beseitigt und der Dienst in den Niederlanden attraktiver geworden. Wie im Fall der Flandernarmee sollte das Netzwerk persönlicher Beziehungen, das auf diese Weise entstand, im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges noch große Bedeutung erlangen. Wieder schafften es einige von ganz unten nach ganz oben. So etwa Peter Eppelmann, Sohn eines reformierten Bauern aus dem nassauischen Hadamar, der dank guter Familienbeziehungen ein Universitätsstudium genossen und seinen ursprünglichen Namen in der Folge gegen das kultiviertere „Melander“ – griechisch etwa „Äpfelmann“ – eingetauscht hatte. Melander diente Moritz von Oranien als persönlicher Sekretär, bevor er als Fähnrich in die Armee des Statthalters eintrat, später in venezianische und hessen-kasselsche Dienste wechselte und schließlich, auf dem Höhepunkt seiner Karriere als kaiserlicher General und Graf von Holzappel, 1648 tödlich verwundet wurde. Viele Angehörige des protestantischen deutschen Adels traten in niederländische Dienste, darunter Johann (von) Geyso, der wie Melander aus einfachen Verhältnissen stammte und diesen 1640 als hessen-kasselscher Generalleutnant ablöste. Der Freiherr Dodo zu Knyphausen wurde 1603 zum niederländischen Hauptmann, später zum schwedischen General ernannt. Andere kamen noch weiter herum, wie etwa der Waliser Charles Morgan, der ein britisches Expeditionsheer in Norddeutschland kommandieren sollte, oder der Schotte Alexander Leslie, der 1602–08 als Hauptmann unter Moritz von Oranien diente, bevor er in schwedische Dienste übertrat und schließlich – inzwischen zum Earl of Leven erhoben – in den Kriegen der Drei Königreiche kämpfte, zunächst aufseiten der Covenanters, später für die Royalisten. Der Franzose Gaspard de Coligny kommandierte derweil zwei hugenottische Regimenter in niederländischen Diensten und half so mit, das Gedankengut der oranischen Heeresreform auch in Frankreich zu verbreiten.
Politische Verbindungen boten einen dritten Weg, auf dem sich niederländischer Einfluss geltend machte, insbesondere durch Graf Johann VII. von Nassau-Siegen, einen Neffen Wilhelms von Oranien, der unter Moritz gedient hatte und dessen Reformideen dann in seinen eigenen Territorien umsetzte. Das von Jacob de Gheyn illustrierte Exerzierbuch hatte Johann VII. verfasst, und Johann Jacobi von Wallhausen amtierte in den Jahren 1616–23 als Direktor der Militärakademie, die der Graf in seiner Residenz Siegen unterhielt. Johann von Nassau-Siegen verband niederländische Ideen mit deutschen Traditionen und brachte die oranischen Methoden auf diese Weise in eine Form, die der Situation im Reich angemessener war. Der Vormarsch des Herzogs von Alba entlang ihrer Grenzen versetzte die rheinischen Fürsten 1567 in große Aufregung, allen voran die Grafen von Nassau als Vettern der Männer an der Spitze des Aufstands. Aus der Befürchtung heraus, die regulären spanischen Verstärkungstruppen, die hinter Alba herzogen, könnten in ihre eigenen Gebiete einfallen, schlossen die Grafen von Nassau ein Bündnis mit dem Adel der benachbarten Wetterau. Sie alle herrschten über kleine, vergleichsweise dünn besiedelte Territorien, die keine großen stehenden Heere unterhalten konnten. Johann erkannte, dass zwar bei Offensivoperationen Milizionäre kein Ersatz für professionelle Soldaten sein konnten, glaubte aber doch, dass man sie sehr wohl zur Verteidigung ihrer Heimat würde motivieren können. Ohnehin bestand für die Untertanen die Verpflichtung, im Notfall Waffendienste zu leisten; dann freilich traten sie mit einer kuriosen Mischung aus rostigen Schwertern, landwirtschaftlichem Gerät und bloßen Knüppeln an. Was diese Männer brauchten, dachte Johann, war eine ordentliche Dosis oranischer Disziplin, die ihnen Entschlossenheit einflößen und ihre Kampfkraft mit modernen Waffen optimieren würde.
Die Amtleute vor Ort erhielten den Auftrag, die männliche Bevölkerung zu erfassen und nach Alter, Familienstand und körperlicher Tauglichkeit in Gruppen einzuteilen; die unverheirateten jungen Männer wurden dann zum regelmäßigen Drill durch professionelle Ausbilder eingezogen. Die Rekruten wies man Kompanien einer zuvor festgelegten Größe zu, wobei größere Dörfer und Städte komplette Einheiten stellten, während kleinere zur Mobilisierung einer gemeinsamen Kompanie beitrugen. Diese als „Auswahl“ bezeichneten Truppen exerzierten jeden Sonntag auf dem Dorfplatz oder im freien Feld, wurden in regelmäßigen Abständen aber auch in Übungslagern zusammengezogen, um in größeren Formationen Manöver abzuhalten. Im Bedarfsfall wurden sie durch das Läuten der Kirchenglocken mobilisiert, woraufhin sie sich im Haus des Dorfvogts ihre Waffen abzuholen und gemeinsam anzutreten hatten; den Befehl führten ihre Ausbilder sowie etwaige Angehörige des örtlichen Adels mit Militärerfahrung. Bis 1595 waren alle Elemente des neuen „Landesdefensionswesens“ in Nassau eingeführt und wurden in der durch Johann VII. von Nassau-Siegen verschriftlichten Form unter den protestantischen Fürsten des Reiches verbreitet, die um 1600 vielfach ähnliche Milizen einführten.112
Die beschriebenen Reformen machten einen entscheidenden Aspekt im sich wandelnden Verhältnis von Herrschern und Beherrschten greifbar. Die deutschen Reichsfürsten und anderen Grundherren waren auch vorher schon berechtigt gewesen, ihre Untertanen bei Invasionen oder Naturkatastrophen im Rahmen der Landfolge zu Wehr- und Hilfsdiensten heranzuziehen; zur Aufklärung und Ahndung von Verbrechen bestand zudem die Pflicht der Untertanen zur Gerichtsfolge. Die Herausbildung der Reichslandfriedensordnung (siehe Kapitel 2) hatte diese herrschaftlichen Dienstansprüche bis etwa 1570 noch gestärkt, denn nun konnten die Landesherren ihre Untertanen auch mobilisieren, um das Reichsrecht zu wahren und das Reich zu verteidigen. Allerdings äußerten die Stände in den einzelnen Territorien starke Zweifel daran, dass die entsprechenden Befugnisse auch zur Verpflichtung der Untertanen zu Angriffskriegen gebraucht werden durften, und weigerten sich in der Regel, für derartige Ansinnen Steuern zu bewilligen.113 Die Fürsten sahen die neue Miliz als eine Möglichkeit an, die Autorität über ihre Untertanen zu stärken und auszuweiten, und glaubten, dass das regelmäßige Exerzieren einen gesellschaftlichen Wandel vorantreiben werde – und zwar ganz im Sinne des Disziplinierungs- und Moralisierungsdrangs, der durch die Konfessionalisierung spürbar wurde. Wie deren Maßnahmen hing allerdings auch die erfolgreiche Einführung des Landesdefensionswesens von einem ganzen Netzwerk aus Gemeindeseelsorgern, Dorfvorstehern und grundherrlichen Vögten ab. Die Landesfürsten stießen dabei nicht selten auf den Widerstand ihres Territorialadels, der „seine“ Pachtbauern nicht zum Dienst in der Auswahl hergeben wollte. Das Ergebnis war ein Kompromiss, weil die Umsetzung der Reformen zumindest teilweise von der Bereitschaft der Stände abhing, die Ausbilder und Waffen zu bezahlen sowie Bier und andere Anreize zur Verfügung zu stellen, damit die Rekruten auch zum Training erschienen. In Brandenburg beschränkte sich das Milizwesen auf jene Städte, die unmittelbar dem Kurfürsten unterstanden, während von den rund 93 000 als tauglich gemusterten Untertanen des sächsischen Kurfürsten gerade einmal 9664 verpflichtet wurden – unter den 47 000 Tauglichen aus den Territorien der Reichsritterschaft wurden sogar nur 1500 Pioniere ausgehoben. Die Angehörigen des Adels konnten dem System jedoch nicht ganz entgehen, da zu ihren Lehnspflichten auch die Leistung von Militärdienst zählte. Diese traditionsreichen persönlichen Verpflichtungen wurden nun in das neue Landesdefensionswesen eingegliedert, indem man aus dem adligen Heerbann einfach Kavallerieeinheiten bildete. Die kursächsische Ritterschaft wurde zur Stellung von zwei Regimentern mit insgesamt 1593 Mann verpflichtet, während andernorts der Anteil des Adels an der Streitmacht in der Regel etwa zehn Prozent betrug. Generell wurde etwa einer von zehn tauglichen Männern zum Milizdienst herangezogen, das entsprach etwa 2,5 Prozent der Gesamtbevölkerung.114
Die Milizen sollten reguläre Truppen keineswegs in der Schlacht ersetzen, wie mancher spätere Historiker spekuliert hat. Stattdessen sollten sie eine Art von militärischer Erster Hilfe leisten und ihre Dörfer und Städte gegen Eindringlinge und Marodeure verteidigen sowie bei Bedarf die Besatzung strategisch wichtiger Festungen verstärken. Letzterer Aspekt erwies sich als das Kostspieligste an dem neuen System überhaupt, da die Landesfürsten nun begannen, neue Verteidigungsanlagen nach niederländischem Vorbild errichten zu lassen, oder bestehende Befestigungen auf den neuesten Stand bringen ließen. Vor allem die Kurpfalz, deren Landesfürst wegen der Verstreutheit und Verwundbarkeit seiner Territorien ein ambitioniertes Festungsbauprogramm auflegte, stach in dieser Hinsicht hervor. So wurde zwischen 1606 und 1622 Mannheim um ein älteres Dorf herum erbaut, inklusive einer Zitadelle mit sieben Bastionen (der Friedrichsburg) sowie sternförmigen Befestigungsanlagen nach neuestem Standard (mit sechs Bastionen und zwei Halbbastionen) für die eigentliche Stadt. Eine weitere Festung wurde 1608 in Frankenthal errichtet und 1620/21 verstärkt; das bereits bestehende Heidelberger Schloss wurde ebenfalls erweitert. Im Allgemeinen unterhielten die Landesherren kleine Kontingente von Berufssoldaten als Leibwachen und Garnisonen. Es war ebendiese Kombination von Milizen, Festungen und kleinen, hochprofessionalisierten Leibwachen, die die Grundlage der Militärorganisation in den deutschen Territorien um 1600 bildete.
Man sieht leicht, warum die Stände den Beteuerungen ihrer Landesfürsten, dies alles seien reine Defensivmaßnahmen, von Anfang an misstrauten. Schließlich konnten die Berufssoldaten auch eingesetzt werden, um die Schlagkraft der Milizen im Feld zu erhöhen. Die Untertanen sahen das regelmäßige Exerzieren als eine weitere lästige Pflicht an, die sie neben immer umfangreicheren sonstigen Diensten nun eben auch noch erfüllen sollten; und die Saufgelage, die mit dem Training nicht selten einhergingen, widerlegten schon bald die Vorhersagen der Theoretiker, der militärische Drill werde gleichsam automatisch in christliche Moralvorstellungen einmünden. Die brandenburgischen Städte überzeugten ihren Kurfürsten 1610, den Milizdienst wieder abzuschaffen und zu der vorherigen Sitte zurückzukehren, nach welcher der Kurfürst Soldaten zu seiner Unterstützung dann anwarb, wenn er sie brauchte. Solche Rückschläge verlangsamten die Umsetzung der Reformen im Reich als Ganzem; in der Kurpfalz seit 1577 bestehende Pläne waren erst 1600 vollständig umgesetzt, während die kursächsischen Stände die Aufstellung einer Miliz in ihrem Territorium bis 1613 herauszögerten.
Die historische Bewertung all dieser Maßnahmen sowie der niederländischen Reformbemühungen überhaupt ist nicht selten dadurch getrübt worden, dass man – ohne Rücksicht auf Anachronismen – spätere Anliegen und Absichten dort hineinprojizierte, wo sie eigentlich noch gar nicht vermutet werden konnten. Konservative deutsche Historiker sahen das Landesdefensionswesen als Meilenstein auf dem Weg zu einer allgemeinen Wehrpflicht aus patriotischer Verpflichtung; als eine Errungenschaft, welche die politische Zersplitterung des Alten Reiches schließlich zunichtegemacht habe, weshalb die Fürsten nach 1618 gezwungenermaßen wieder auf Söldner hätten zurückgreifen müssen. Andere interpretierten die Milizen als Volksarmeen avant la lettre und wiesen darauf hin, dass Bauern sich die Milizstrukturen wiederholt bei ihren Aufständen zunutze machten. Keine dieser beiden Perspektiven enthält die ganze Wahrheit. Sowohl die Gilden der niederländischen schutters als auch das deutsche Milizwesen beruhten auf unverkennbar frühneuzeitlichen Rollenverständnissen: jene auf dem Selbstbild privilegierter Stadtbürger in einer dezentralisierten Republik, diese auf einer Verpflichtung von gehorsamen Untertanen ihres Landesherrn. Der niederländische Einfluss war ohnehin nur eine Quelle der deutschen Maßnahmen. Fabian von Dohna, der 1602 für die Heeresreform in Preußen verantwortlich zeichnete, hatte unter Moritz von Oranien gedient und zuvor bereits bei der Aufstellung der kurpfälzischen Miliz geholfen. Dennoch nannte man die Milizionäre in Preußen „Wibranzen“, nach dem polnischen Wort wybrańcy, was „die Erwählten“ bedeutet. Andernorts wurden die Reformen unter dem Eindruck der Türkengefahr nach 1593 begonnen. Außerdem begannen auch die katholischen Territorien, ihr traditionelles Landesaufgebot nach einem ähnlichen Muster neu zu organisieren, wobei sich insbesondere Bayern hervortat: Die hier 1593–1600 umgesetzten Maßnahmen brachten schließlich 22 000 Mann in 39 Land- und fünf Stadtregimentern zusammen.
Viele der Ideen, die in der oranischen Heeresreform und dem deutschen Landesdefensionswesen umgesetzt werden sollten, waren hochtheoretisch und befassten sich mit komplizierten geometrischen Formationen ohne großen praktischen Nutzen. Und selbst diejenigen Reformvertreter, deren Herangehensweise eine praktischere war, stellten sich oft gegen den technischen Fortschritt: so Wallhausen, der den Niedergang der Lanze als Hauptwaffe der Reiterei bejammerte. In zahlreichen Punkten unterschieden sich die Methoden der Niederländer kaum von der Herangehensweise ihrer Gegner, etwa in der Zurückstufung der Kavallerie auf einen Bruchteil der Gesamtarmee. Ihre Vorliebe für dünnere Linien in der Schlacht zielte nicht allein auf die Maximierung der Feuerkraft ab, sondern war zugleich die Notlösung für ein ernstes Problem: Zahlenmäßig waren die Niederländer meist unterlegen. Vor allem hing der niederländische Erfolg in der Schlacht aber nicht von neuartigen Waffen oder avancierter Militärtheorie ab, sondern von der finanziellen Stabilität ihres Landes und einer spezifischen Geschäftsmentalität seiner Bewohner. Die Spanier verließen sich, trotz ihres großen Reichtums, noch immer auf Ehrgefühl und Loyalität gegenüber gesellschaftlich Höherstehenden, um die Soldaten auch dann „bei der Stange zu halten“, wenn das Geld einmal knapp wurde. Eine solche Herangehensweise war für die Niederländer vollkommen indiskutabel, denn für sie ging der einmal geschlossene Vertrag als Verpflichtung über alles. Wie hätte es in einer sich stetig weiter kommerzialisierenden Wirtschaft, deren fortgesetztes Wachstum ganz von der Bonität einzelner Akteure abhing, anders sein können? Soldaten waren Angestellte und hatten als solche Anrecht auf regelmäßige Bezahlung.
Seit der allgemeinen Ausbreitung des Söldnerwesens um die Wende zum 16. Jahrhundert war es üblich geworden, den Soldaten monatlich ihren Sold auszubezahlen, ihnen ein oder mehrere Monatssolde zusätzlich als Anwerbeprämie in die Hand zu drücken und einen weiteren Bonus, wenn sie ihren Abschied nahmen. In den fünf Jahrzehnten vor 1530, als die Landesherren begannen, Soldobergrenzen für die einzelnen Rangstufen festzuschreiben, waren die Monatssolde zwischen 50 und 100 Prozent gestiegen. Durch die Androhung von Meutereien zwangen die Soldaten ihre Obrigkeiten jedoch auch nach 1530, ihnen immer größere Monatsbeträge in Silbermünzen auszuzahlen, obwohl der Sold etwa eines Fußsoldaten offiziell auf vier (Gold-)Gulden im Monat begrenzt war. Als die Spanier und die Niederländer anfingen, stehende Heere aufzustellen, stiegen ihre Kosten noch einmal deutlich an, weil sie diese Soldaten nun das ganze Jahr über bezahlen mussten und nicht mehr nur während der sommerlichen Kampfsaison, wie es noch Anfang des 16. Jahrhunderts gang und gäbe gewesen war. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurde 1576 der „holländische Monat“ eingeführt: Das Jahr zerfiel fortan in acht Blöcke von je 42 Tagen plus einen mit 29 Tagen, wodurch die Anzahl der Soldzahlungen, die die Regierung pro Jahr leisten musste, auf neun reduziert wurde. Andere kopierten dieses Vorgehen, etwa die Österreicher, die 1607 ebenfalls ein System mit neun Soldmonaten einführten (wobei in zweien dieser Monate der Sold in Tuch ausgezahlt wurde, von dem Uniformen anzufertigen waren). Diese österreichische Maßnahme provozierte allerdings nur noch mehr Meutereien, da im kaiserlichen Heer ohnehin schon riesige Soldrückstände aufgelaufen waren. Dagegen kamen die Niederländer mit ihrem Vorgehen durch, weil sie wenigstens den gedrückten Sold pünktlich zahlten. Die gute Zahlungsmoral der Niederländer war es, die in einer Armee, deren Angehörige zu mehr als 50 Prozent Landesfremde waren, Zusammenhalt schuf und trotz regelmäßiger Niederlagen für Loyalität sorgte – zumal die Kreditwürdigkeit der Republik trotz allem unerschüttert blieb. In Böhmen und im protestantischen Deutschland konnte man von einer solchen finanziellen Solidität nur träumen, weshalb die dortigen Versuche, nach 1618 niederländische Taktik und Organisationsformen zu kopieren, unweigerlich auf tönernen Füßen stehen mussten.
Die Verteidigung der Republik (1590–1609) Während die niederländischen Truppen also auf einer solideren finanziellen Grundlage operierten, blieben sie doch deutlich in der Unterzahl. Moritz von Oranien konnte 1588 rund 20 500 Mann aufbieten, die Spanier etwa dreimal so viele. Allerdings profitierte Moritz davon, dass Philipp II. seine Ressourcen gleich mehrmals anderweitig einsetzte: erst zum gescheiterten Invasionsversuch in England 1588, nach 1590 dann bei einer ähnlich fruchtlosen Intervention in die französischen Hugenottenkriege. Der Herzog von Parma leistete diesen Befehlen aus Madrid jeweils nur zögerlich Folge, und Erzherzog Albrecht, der ihm 1593 als Statthalter nachfolgte, musste die Kampagnen im Artois zur Unterstützung der katholischen Franzosen dann wohl oder übel fortführen. Das erlaubte es Moritz von Oranien, zum Angriff überzugehen und in einer Reihe von Vorstößen, welche die südliche Grenze der Republik festigen sollten, gleich mehrere strategisch wertvolle Städte einzunehmen. Die Eroberung von Breda im März 1590 vergrößerte die niederländische Gebietszunge im Südwesten bis nach Brabant hinein und schuf so einen Brückenkopf für weitere, tiefere Vorstöße in die spanisch beherrschten Gebiete. Das eroberte Territorium wurde nicht als neue, gleichberechtigte Provinz unter die sieben Provinzen der Republik aufgenommen, sondern unterstand – unter der Bezeichnung „Generalitätslande“ – direkt den Generalstaaten. Ab den 1620er-Jahren sollte es zu dem am heißesten umkämpften Gebiet der Region werden. Im Folgejahr 1591 erbrachte ein dreifacher Vorstoß der Niederländer, bei dem auch das nur 16 Kilometer von Antwerpen entfernte Hulst eingenommen wurde, zusätzliche Landgewinne. Zutphen und Deventer waren weitere Städte, die bei dieser Gelegenheit wieder unter niederländische Herrschaft gelangten, was die Ijssel-Linie sicherte, während die Eroberung von Nimwegen an der Waal die Kampflinie in Richtung Südosten arrondierte. Nachdem auf diese Weise die gesamte südliche Front gesichert worden war, wandte Moritz sich 1592 nach Norden, um die katholische Rebellion in den nördlichen Provinzen niederzuschlagen, die sieben Jahre zuvor ausgebrochen war. Mit der Einnahme von Groningen 1594 kam auch diese Kampagne an ihr Ende. Nun waren alle sieben Provinzen wieder vollständig in den Händen der Republik.
Nachdem er seine Kräfte 1595/96 neu formiert hatte, stieß Moritz im August 1597 über die Ijssel auf das verbliebene Territorium der Spanier vor – ein schicksalhafter Schachzug, der für das Reich noch schwere Folgen haben sollte, da er den Krieg in Richtung der Reichsgrenze vorantrug. In schneller Folge nahmen die Niederländer noch sieben weitere befestigte Städte ein und erweiterten ihr Territorium damit so weit, dass es nunmehr an den Westfälischen Reichskreis grenzte. Außerdem nahmen sie den strategisch bedeutsamen Übergang über den Niederrhein bei Rheinberg ein und besetzten die Stadt, die zum Kurfürstentum Köln gehörte.115 Die katholische Bevölkerung der nördlichen Niederlande war nun völlig von den Spaniern abgeschnitten, es sei denn Madrid wäre bereit, die Neutralität des Heiligen Römischen Reiches zu verletzen, um die niederländische Flanke mit einem Marsch durch Westfalen im Osten zu umgehen. Und genau das taten die Spanier auch, reagierten allerdings zu spät und entsandten erst im September 1598 ein Expeditionsheer von 24 000 Mann nach Münster, Recklinghausen und in die vier niederrheinischen Herzogtümer Jülich, Kleve, Mark und Berg, um sich diese Städte und Territorien zu sichern, bevor die Niederländer es tun konnten. Die dezentralisierte Struktur der Reichslandfriedensordnung erlaubte es den betroffenen Landesherren, die Reichsverteidigungsmaschinerie in Gang zu setzen, wenngleich Kaiser Rudolf darauf nicht reagierte. Die fünf westlichen Reichskreise mobilisierten schließlich 16 000 Mann, aber diese konnten effektiv nicht vor Juli 1599 aufgeboten werden – drei Monate, nachdem die Spanier abgezogen waren und lediglich ein paar kleine Garnisonen zurückgelassen hatten, die sich gerade noch so auf deutschem Gebiet befanden. Der Versuch, eine dieser spanisch besetzten Städte zu erobern, scheiterte kläglich, und das Heer der Reichskreise zerstreute sich, als es im September nicht mehr weiter bezahlt werden konnte.116 Diese Episode, die als „Spanischer Winter“ in die Geschichte eingegangen ist, verstärkte den Wunsch der deutschen Anrainer, sich möglichst aus dem spanisch-niederländischen Konflikt herauszuhalten, und Köln, Münster sowie andere Territorien in der Umgebung nahmen Gespräche mit beiden Kriegsparteien auf, um sie zu einer Beschränkung ihrer Grenzverletzungen zu bewegen.
Der spanische Vorstoß nach Deutschland hinein war eine direkte Folge des im Mai 1598 geschlossenen Friedens von Vervins, der den Zweifrontenkrieg für die Spanier beendete und es dem Statthalter Albrecht von Habsburg ermöglichte, wieder die gesamte Flandernarmee gegen Moritz von Oranien einzusetzen. Er richtete seine Aufmerksamkeit nun wie zuvor ganz auf den Westen und eröffnete erneut eine spanische Offensive auf die schwer befestigten Grenzstellungen der Niederländer rund um das Mündungsgebiet der Schelde. An der niederländischen Verteidigungslinie kam der Vorstoß bald zum Erliegen und brach dann sogar völlig in sich zusammen, als im spanischen Heer aufgrund von wachsenden Soldrückständen eine Meuterei ausbrach. Moritz von Oranien stieß von der brabantischen Gebietszunge entlang der flämischen Küste in Richtung Süden vor, um den spanischen Kriegshafen Dünkirchen auszuschalten. Der Versuch Albrechts, ihn daran zu hindern, führte am 2. Juli 1600 zur Schlacht bei Nieuwpoort, dem ersten größeren Aufeinandertreffen der verfeindeten Parteien im Feld seit Mitte der 1570er-Jahre. Im Schlachtverlauf traten die Nachteile der „flämischen Schule“ des Stellungskrieges klar zutage.
Obwohl die Flandernarmee zum damaligen Zeitpunkt 4000 Kavalleristen und 60 000 Mann Infanterie zählte, hatte Albrecht alle Mühe, 1500 Reiter und 8000 Fußsoldaten aufzubieten, weil der Rest entweder als Garnison der befestigten Städte im Einsatz war oder die Befehle des Statthalters aufgrund der Meuterei noch immer ignorierte.117 Zugleich machte Nieuwpoort aber auch die Grenzen einer aggressiveren Strategie deutlich, die andauernd die Entscheidung in der Schlacht suchte. Obwohl es ihm gelang, das spanische Heer zu besiegen, konnte Moritz doch Dünkirchen nicht einnehmen und musste seinen Feldzug dort beschließen, wo er ihn begonnen hatte.
Albrecht entschied sich, etwaigen weiteren Vorstößen auf Dünkirchen dadurch zuvorzukommen, dass er im Juli 1601 die englisch-niederländische Garnison von Ostende angriff. Dieser Eroberungsversuch sollte für das 17. Jahrhundert das werden, was die Schlacht um Verdun für den Ersten Weltkrieg gewesen ist. Beide Seiten warfen enorme Mengen an Soldaten und Kriegsgerät in die Schlacht, und der Kampf um diesen einen Hafen wurde zum Symbol, dessen Strahlkraft in keinerlei Relation zu seiner tatsächlichen strategischen Bedeutung stand. Die Niederländer sahen sich gezwungen, ihre Armee von 35 000 Mann im Jahr 1599 auf 51 000 im Jahr 1608 zu vergrößern, nicht zuletzt, weil Moritz’ frühere Erfolge der Republik eine wesentlich längere Grenze beschert hatten, die nun auch verteidigt sein wollte.
Dennoch verschaffte die spanische Fixierung auf Ostende Moritz eine weitere Chance, seine Stellungen nach Osten hin vorzuschieben. Diesmal konzentrierte er sich dabei auf die Sicherung der nordöstlichen Grenze zum Schutz der gerade erst zurückeroberten Gebiete um Groningen. Es handelte sich dabei um eine jener zahlreichen durchlässigen Grenzregionen in Europa, in denen es den anliegenden Territorialmächten noch nicht gelungen war, feste Landesgrenzen zu etablieren. Entlang der gesamten Nordseeküste dominierte eine einzige Landschaftsform, herrschten ähnliche Gesellschaftsformen und politische Kulturen vor, wiewohl der östliche Teil dieser Region innerhalb der Reichsgrenzen lag, während der Rest nun zur Republik der Vereinigten Niederlande gehörte. Die Menschen beiderseits der Grenze schätzten die weitgehende Autonomie ihrer bäuerlichen Dorfgemeinschaften, die sie als „friesische Freiheit“ hochhielten. Die Friesen am östlichen Rand der Region verloren diese Freiheit, als Mitte des 16. Jahrhunderts der dänische König ihre Dörfer im heutigen Holstein seinem Reich einzuverleiben begann. Die Friesen im äußersten Westen bemühten sich, sie in einer eigenen Provinz der neuen Republik der Vereinigten Niederlande zu bewahren. Zwischen diesen beiden Rändern lag die Grafschaft Ostfriesland, die erst 1464 Teil des Heiligen Römischen Reiches geworden war und von dem aus bescheidenen Anfängen hervorgegangenen Geschlecht der Cirksena regiertwurde, das 1660 in den Reichsfürstenstand aufsteigen sollte. Wie so viele deutsche Territorien im späten 16. Jahrhundert – namentlich Jülich-Kleve, Hessen, Baden, Kurköln und Straßburg (siehe Kapitel 7) – wurde auch Ostfriesland von inneren Streitigkeiten erschüttert. Obschon keine dieser Auseinandersetzungen zu einem ausgewachsenen Krieg führte – weder in Ostfriesland noch in den anderen genannten Gebieten –, so betrafen sie doch allesamt auch Streitpunkte, die die Interessen ausländischer Mächte berührten, weshalb sich eine oder andere der beteiligten Parteien um Unterstützung an diese wandte. Die Geschichte dieser Konflikte haben vielerorts Lokalhistoriker geschrieben – oder auch solche, die das große Panorama der europäischen Beziehungen in den Blick nehmen wollten und dazu neigten, lokale Auseinandersetzungen nur als Auslöser oder Brennpunkte für Konflikte zwischen den Großmächten zu betrachten. Diese beiden Perspektiven müssen aber kombiniert werden, denn die tatsächliche Bedeutung jener Lokalkonflikte lag in ihrer Neigung, auswärtige Großmächte Schritt für Schritt immer tiefer in die inneren Angelegenheiten des Heiligen Römischen Reiches hineinzuziehen. Die Intervention von außen war stets nur als zeitlich begrenzt gedacht und sollte andere, verfeindete Parteien von einer Einmischung abhalten. Auf eine „Ausstiegsstrategie“ verschwendete man wenig Gedanken, und wenn man erst einmal in die Sache hineingeraten war, konnte man schwerlich den Rückzug antreten, ohne dass das entstehende Machtvakuum von verfeindeten Kräften aufgefüllt wurde.
Die Entwicklungen in Ostfriesland veranschaulichen erstens diese allgemeine Problematik; zweitens bilden sie aber auch den Hintergrund für andere wichtige Geschehnisse im deutschen Nordwesten, auf die Kapitel 10 noch genauer eingehen wird. Wie viele weltliche Herrscherdynastien in Norddeutschland nahm die Familie Cirksena schon im frühen 16. Jahrhundert den lutherischen Glauben an. Dies blieb auch der Glaube des ärmsten Drittels ihrer Untertanen, die in einer kargen Moor- und Heidelandschaft unter der direkten Herrschaft des Grafen lebten. Die restlichen zwei Drittel Ostfrieslands waren wohlhabender, weil das dortige Marschland mit seinen fruchtbaren Böden einen marktorientierten Ackerbau über die reine Subsistenz hinaus erlaubte. Die Marschbauern sicherten sich schließlich Sitz und Stimme in den Landständen und zwangen den Grafen, jegliche künftige Pachtzinserhöhung zu verbieten. Zusammen mit den wenigen ansässigen Adligen konvertierten diese selbstbewussten Bauern zum Calvinismus und schlossen ein Bündnis mit den Bürgern von Emden, der einzigen größeren Stadt in ganz Ostfriesland. Strategisch günstig an der Mündung der Ems in die Nordsee gelegen, war Emden der am weitesten westlich gelegene Nordseehafen und wickelte einen großen Teil des westfälischen Außenhandels ab. Nach dem Ausbruch des Niederländischen Aufstandes erlebte die Stadt einen wahren Boom, da viele Kaufleute einen sichereren Standort für ihre Handelshäuser suchten, aber auch viele Flüchtlinge in Emden ein neues Leben beginnen wollten. Nach und nach verband sich der calvinistische Glaube immer enger mit der Opposition der Emdener Bürger und ihrer Verbündeten, der reicheren Bauern, gegen die Versuche der lutherischen Cirksena, ihrer landesherrlichen Autorität größere Geltung zu verschaffen.
Als 1599 Enno III. Cirksena in Amt und Würden kam, begannen die Niederländer, sich Sorgen zu machen, denn der neue Graf von Ostfriesland schien fest entschlossen, seinen Willen durchzusetzen – wesentlich entschlossener, als seine Vorgänger es gewesen waren. Außerdem hatte er Verwandte in spanischen Diensten. Der gescheiterte Versuch Moritz’ von Nassau, Dünkirchen einzunehmen, beschwor das Schreckgespenst einer neuen spanischen Seekriegsstrategie herauf, die den Handel und mit ihm das Fundament der niederländisch-republikanischen Unabhängigkeit bedrohte. Schon längst waren Freibeuter von Dünkirchen aus im Ärmelkanal unterwegs und brachten immer wieder niederländische Handelsschiffe auf. Wenn sie auch noch den Hafen von Emden würden nutzen können, fürchtete man in Den Haag, dann wäre womöglich der Ostseehandel bedroht. Die Generalstaaten überredeten deshalb 1602 die Emdener Bürgerschaft, eine niederländische Garnison in ihrer Stadt zuzulassen, die später noch durch den Vorposten Leerort ergänzt wurde, eine Festung, die ein Stück weit die Ems hinauf gegenüber der Stadt Leer gelegen war, den einzigen Zugang nach Ostfriesland aus Richtung Südwesten – über Marsch und Heide – abriegelte und den Niederländern ab 1611 als Stützpunkt diente.
Emden wurde nun zu einem Zentrum des politischen und religiösen Radikalismus und einem der wenigen Orte in Deutschland, an dem die Calvinisten jene presbyterial-synodale Kirchenverfassung mit ihren flachen Hierarchien einführten, die für ihre Glaubensbrüder im europäischen Ausland so typisch war. Die Stadt Emden stellte 1604 den Juristen Johannes Althusius als ihren Stadtsyndikus ein, wobei ausdrücklich dessen berühmt-berüchtigtes Werk Politica den Ausschlag gegeben hatte, in dem Althusius die These vertrat, Magistraten stehe gegenüber „tyrannischen“ Fürsten ein Widerstandsrecht zu – das hatte weithin für Aufsehen gesorgt.118
Ein Zermürbungskrieg Die Spanier steckten vor Ostende in ihren Gräben fest. Der Krieg in den Niederlanden hatte sie seit 1582 jedes Jahr 1500 gefallene Soldaten gekostet, von den Verlusten unter ihren wallonischen, italienischen und deutschen Söldnern ganz zu schweigen. Bei der vierjährigen Belagerung von Ostende starben noch einmal 40 000 Mann. Erst unter dem Kommando von Ambrogio Spinola gelang es den Spaniern im September 1604, die Stadt einzunehmen. Spinolas im Vorjahr erfolgte Berufung auf diesen Posten war symptomatisch für die finanziellen und militärischen Probleme der Spanier. Er stammte aus Genua, dem Zentrum des spanischen Kredit- und Logistiknetzes. Sein jüngerer Bruder hatte beim Aufbau der spanischen Flandernflotte nach der Eroberung von Dünkirchen 1583 eine entscheidende Rolle gespielt, aber Ambrogio war in der Heimat geblieben, hatte geheiratet und das Bankhaus der Familie geführt. Wie viele Bankiers verdankte er seinen Erfolg einer Diversifizierung der Geschäftsbereiche: Einem seiner Söhne verschaffte er den Kardinalshut, indem er Truppenaushebungen finanzierte, ebenso war er aber auch stark im spanischen Mittelmeerhandel involviert.
Das Bankhaus Spinola häufte so ein Betriebskapital von zwei Millionen Dukaten an, was es Ambrogio erlaubte, für seinen König bis 1602 13 000 Soldaten anzuwerben und auszurüsten. Seine eigenen Interessen waren mit jenen der spanischen Krone verschmolzen: Der König war angesichts der großen Kriegsanstrengungen auf Finanziers wie ihn angewiesen, während Spinola den militärischen Erfolg auch deshalb suchte, weil jede Niederlage auf dem Schlachtfeld ein Risiko für seine Bonität bedeutete. Die Eroberung Ostendes bestätigte, dass seine Ernennung zum Befehlshaber keine Fehlentscheidung gewesen war; 1605 wurde er offiziell der Nachfolger Albrechts von Habsburg als Oberkommandierender der Flandernarmee. Was im Desaster hätte enden können, wurde zu einer effizienten Partnerschaft. Beide waren vernünftige Männer, und dank seines Taktgefühls und seiner Befähigung erwarb sich Spinola bald den Respekt seiner routinierteren Untergebenen.
Spinola kehrte zu der alten Strategie zurück, die Niederländer an ihrem östlichen Flügel zu umgehen, indem er mit 15 000 Mann in das Ijsselgebiet vorstieß, um viele der dort 1597 verlorenen Städte zurückzuerobern, darunter 1606 auch Rheinberg. Es gelang ihm allerdings nicht, den inneren Verteidigungsgürtel der Republik zu durchbrechen, während die Niederländer auf ein im November 1598 seitens der Spanier gegen sie verhängtes Handelsembargo mit der Eröffnung eines uneingeschränkten Freibeuterkrieges reagierten. Tatsächlich trifft die Wortwahl es genau, denn das niederländische Vorgehen war durchaus dem „uneingeschränkten U-Boot-Krieg“ des Deutschen Reichs im Ersten Weltkrieg vergleichbar, und wie dieser war es heftig umstritten. Kleine Schiffe wurden mit Kaperbriefen ausgestattet, was sie zum Aufbringen feindlicher Handelsschiffe ermächtigte. Dazu tarnten sie sich als harmlose Fischkutter oder spanische Schiffe in Seenot, um die fremden Kapitäne zu täuschen. Zwischen einem solchen Vorgehen und unverhohlener Seeräuberei war es nur ein schmaler Grat, und die Piraten wüteten ohnehin schlimm genug – so schlimm, dass die Schiffe der Barbaresken-Korsaren von Algier regelmäßig bis in den Ärmelkanal vordrangen und sogar Dorfbewohner aus Cornwall in die Sklaverei verschleppten. Die Niederländer beruhigten freilich ihr frommes Bürgergewissen, indem sie Bestimmungen erließen, die zwischen patriotischen Freibeutern und gottlosen Piraten unterscheiden sollten. Wenn diese Bestimmungen dann aber verletzt wurden, drückten sie nicht selten ein Auge zu. Die Freibeuterei war nicht nur eine effektive Kriegswaffe, sie war auch tief in der niederländischen Kultur verwurzelt. Als Seefahrernation feierten die Niederländer noch immer die Heldentaten der freibeuterischen Wassergeusen aus den ersten Jahren des Aufstands gegen die spanische Herrschaft: In der Zeit zwischen den Repressalien Albas und der Eroberung des holländisch-zeeländischen Rückzugsgebiets 1572 waren sie es gewesen, die der Sache der Aufständischen den Rücken gestärkt hatten. Wie im Fall des deutschen U-Boot-Kriegs wurde der Seekrieg gegen die Spanier mit der Zeit jedoch immer mehr zum Abnutzungs- und Zermürbungskrieg, in dem die Niederländer selbst unter den von Dünkirchen ausgehenden Plünderfahrten der spanischen Flotte zu leiden hatten.119 Die niederländischen Verteidigungsausgaben hatten sich über zehn Jahre hinweg verdoppelt und erreichten 1604 eine Höhe von zehn Millionen Gulden. Es gab deutliche Anzeichen dafür, dass das fiskalisch-militärische System der Republik trotz seiner Effizienz kurz vor dem Zusammenbruch stand. Die Gesamtschuld der niederländischen Regierung stieg auf zehn Millionen Gulden, während die inländischen Provinzen in Zahlungsverzug gerieten und die Armee bis 1607 auf einen Mannschaftsstand von 51 000 zusammenschmolz, der deutlich unter ihrer Sollstärke von 62 000 Soldaten lag.
Da also beide Seiten in ein langwieriges Kräftemessen zur See und an Land hineingezogen waren, wurde die Logistik zum entscheidenden Faktor. Das Erstarken der regulären niederländischen Flotte machte es den Spaniern – vor allem im Zusammenspiel mit den Kaperfahrten der Freibeuter – sehr schwer, die Flandernarmee von See aus zu versorgen. Zwar hatten die Spanier 1585 Antwerpen zurückerobert, aber die niederländische Präsenz auf den Inseln vor Zeeland bewirkte de facto eine völlige Blockade der Scheldemündung, während die zahlreichen Sandbänke, die Dünkirchen schützten und es zu einem derart tauglichen Freibeuternest machten, zugleich die Einfahrt größerer (Transport-)Schiffe verhinderten. Diese Probleme waren im Zuge der Armada-Kampagne von 1588 schlagartig zutage getreten, als die spanische Flotte vergeblich einen sicheren Hafen suchte, um ihren englischen Verfolgern zu entkommen und Parmas Truppen an Bord zu nehmen.120 Die Schwierigkeiten der Versorgung auf dem Seeweg erhöhten die strategische Bedeutung jener Marschroute, die der Herzog von Alba 1567 eingeschlagen hatte und die inzwischen als „Spanische Straße“ zu allgemeiner Bekanntheit gelangt war.