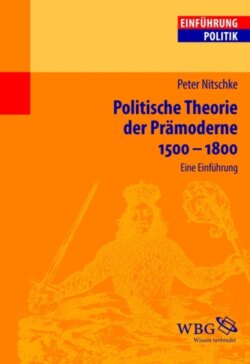Читать книгу Politische Theorie der Prämoderne 1500-1800 - Peter Nitschke - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Diskurse
ОглавлениеDie Betrachtung der politischen Theorie der Prämoderne unter diskursanalytischen Gesichtspunkten verweist auf die einzelnen maßgeblichen Denker nicht nur im Sinne ihrer jeweils spezifischen Theorie, sondern eben auch im Sinne ihrer Antworten auf die wesentlichen Fragestellungen innerhalb der Logik eines Diskurses. Der Denker, zumal der Klassiker in der politischen Theorie, steht also nie allein, sondern hat eine Referenzfunktion in einem ganz bestimmten Diskurs – mitunter auch in mehreren gleichzeitig.
Selbstverständlich ist die Prämoderne keineswegs (wie auch die Moderne nicht) von reinen Diskursformen beherrscht. Letztendlich sind alle Diskurse mehr oder weniger Konstrukte im Sinne der eingangs formulierten Überlegungen. Trotz aller sich überschneidenden Mischdiskurse oder Querverbindungen zwischen den einzelnen Autoren lassen sich aber doch insgesamt sechs relativ gefestigte oder sich festigende Diskurse aufzeigen, die man als Mainstreams in der Prämoderne bezeichnen kann. Es sind dies:
1 Politica Christiana
2 Machiavellismus
3 Utopismus
4 Kontraktualismus
5 Skeptizismus
6 Republikanismus
Die prämodernen Diskurse
Die Einteilung in dieser Reihenfolge soll dabei keine Wertigkeit oder gar chronologische Abfolge anzeigen, denn alle sechs Diskurse treten in der Prämoderne zeitgleich auf, in unterschiedlicher Intensität zwar und mit länderspezifischen Abweichungen bzw. Schwerpunkten, doch insgesamt um die Wahrheitsansprüche von politischer Theorie im positiven Sinne alternierend. Das hier mit dem Diskurs zur christlichen Politik begonnen wird, liegt didaktisch darin begründet, dass dieser Diskurs die besten Referenzkriterien zum mittelalterlichen Weltbild aufweist, von daher also die Sicht auf das Politische trotzt aller substantiellen Transmissionen noch am ehesten traditionell vermittelt. Der Bruch im Sinne der Kuhnschen Paradigmenwechsel kommt somit nicht unmittelbar zustande, weil auch die übrigen Diskurse in der einen und anderen Weise von dieser Tradition profitieren. Nichts ist vollständig neu unter der Sonne, schon gar nicht Begrifflichkeiten, wohl aber ihre Zusammensetzung oder aber die Referenzbilder, auf die sie sich beziehen. Insofern ist gerade der hier zum Schluss vorzustellende Diskurs zur Republik nicht nur der sicherlich modernste, sondern zugleich auch der älteste Diskurs überhaupt, verweist er doch über das Mittelalter hinaus auf seinen antiken Ursprung. Aber dies gilt, so werden wir sehen, auch für die übrigen fünf Diskurse in unterschiedlicher Weise.
Charakteristika der Diskurse
Ein Kennzeichen der prämodernen Diskurse ist es, dass sie bei der Auseinandersetzung um die Substanz von politischer Theorie Pluralität aufweisen, um nicht zu sagen (aus heutiger Sicht) ausgesprochen interdisziplinär formulieren können. Das bedeutet: der Dominikanermönch liest auch die Schriften reformatorischer Autoren, wie umgekehrt; der Theologe antwortet auf Gedanken des Politikers, der Philosoph liest Theologisches und der Jurist Philosophisches; der Praktiker macht sich Gedanken über eine Theorie der Politik wie umgekehrt auch ein Theoretiker Ausflüge in die Praxis unternimmt. Kurzum, die prämodernen Diskurse zur Politik unterscheiden sich von denen der Moderne in zweierlei Hinsicht sehr deutlich:
a) Es existiert (noch) keine starre Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis, beides geht vielmehr ineinander über; es gilt im Prinzip das Motto von Leibniz – theoria cum praxi. Insofern sind es oft gerade Autoren mit praktischer Politikerfahrung, die eine Systematisierung der Spielregeln und der normativen Legitimation von Politik anstrengen. Folglich ist ein Kennzeichen aller prämodernen Diskurse zur politischen Theorie, dass sie keine reinen Universitätsdiskurse darstellen. Die Mehrzahl aller Klassiker zur politischen Theorie dieser Epoche kommt bezeichnenderweise mit ihren Argumenten eben nicht von universitären Lehrstühlen. Insofern sind die Diskurse auch nicht selbstreferentiell im Sinne einer bestimmten Klientel, sondern richten sich an alle, die sich überhaupt in Europa für Politik interessieren.
b) Aufgrund der interdisziplinären Kommunikation zur Sache der Politik fehlt damit auch eine hermetische Abgrenzung der Diskurse untereinander, wie sie bei den Diskursen der Moderne, insbesondere im 20. Jahrhundert festzustellen ist. Das heißt, die prämodernen Diskurse sind noch keineswegs ideologisch geschlossen, sondern bei den zentralen Theoremen durchaus offen für verschiedene Adaptionen in der Interpretation. Deshalb kommt es auch zu den Diffusionseffekten zwischen den einzelnen Diskursen, die im Folgenden beschrieben werden. Das heißt, manche Denker wie Machiavelli und Rousseau sind in mehr als nur einem Diskurs zu finden. Grundsätzlich gilt hier festzustellen: je weitreichender ein Autor mit seiner Theorie in den Einzelaussagen formulieren kann, desto öfter tritt eine Brechung und Mischung seiner Argumente auch in ein oder zwei anderen Diskursen auf.
So lange die Frage, was eigentlich die beste Politik und die beste Regierungsform ist, die metaphysische Rückkoppelung auf den Gottesgedanken offenbleibt, so lange sind die prämodernen Diskurse insofern Versatzstücke für ein und die gleiche Frage. Ab dem Diskursmoment, wo rein instrumentelle Aspekte unter dem Deckmantel des Vernunft-Prinzips in die Debatte einrücken und stärkeres Gewicht bekommen, verändern allerdings auch die prämodernen Diskurse ihren offenen Horizont und mutieren zu systemisch und damit auch hermetisch abgezirkelten Gebilden. Das ist spätestens mit der Kantianischen Wende in der Logik der Fall, die daher auch sinnvollerweise den Endpunkt für diese Einführung in die Politische Theorie bildet.