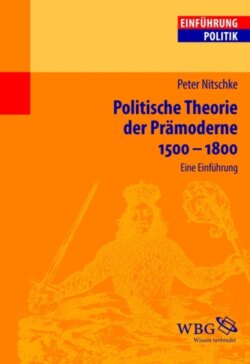Читать книгу Politische Theorie der Prämoderne 1500-1800 - Peter Nitschke - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Francisco de Vitoria und die Begründung staatlicher Gewalt
ОглавлениеNeoscholastik
Die Begründung christlicher Politik ist in der Prämoderne keineswegs nur durch die protestantische Perspektive erfolgt. Auch wenn für eine Vielzahl an modifizierenden Argumenten und neuen Theoremen im Bereich des Politischen Autoren der Reformation Pate stehen, so bleibt doch lange Zeit das katholische Argumentationslager ebenso wichtig. Jedoch sind die Autoren auf katholischer Seite oft sehr viel stärker als ihre protestantischen Kollegen dem scholastischen Traditionsdiskurs verpflichtet und dem entsprechend auch in rituellen Kodifizierungen zum Thema Politik befangen. Unabhängig davon ob man diese Perspektive nun als Spätscholastik oder Neoscholastik bewertet, der Sinnzusammenhang mit den Lehren eines Thomas von Aquin oder eines Augustinus bleibt hier deutlich gewahrt. Dennoch kommt es gerade auch in der katholischen Sinndeutung von Politik zu bemerkenswerten innovativen Interpretamenten (vgl. Ottmann 2006: 106ff.).
Einer der signifikantesten Vertreter der neuen Form von Scholastik ist der Spanier Francisco de Vitoria (1592–1546). In der programmatischen Abhandlung einer seiner Vorlesungen, die er um 1528 unter der Überschrift De Potestate Civili stellt, wird ersichtlich, inwieweit die katholische Interpretationsstrategie, auch wenn sie scheinbar fundamentalistisch vorgetragen wird, dennoch interessante Variationen zum Thema präsentiert.
Schon der erste Punkt der Vortragsabhandlung von Vitoria zeigt ein geradezu klassisches Bestimmungsbild des Politischen an, welches enorme Spannungen in sich birgt: „Alle Gewalt“, so behauptet Vitoria (1992: 29), „durch die ein weltlicher Staat verwaltet wird, sei sie öffentlich oder privat, ist nicht allein gerecht und rechtmäßig, sondern hat Gott auf eine solche Weise zum Urheber, daß sie selbst durch eine Übereinkunft des gesamten Erdkreises weder aufgehoben noch abgeschafft werden kann.“
Politik als Herleitung aus der Natur Gottes
Mit anderen Worten: Keine von Menschen gemachte Gewalt kann die Urgewalt Gottes, von der jegliche Legitimation politischer Ordnung ausgeht, absolut ersetzen, geschweige denn auflösen. Die Urgewalt Gottes bleibt in den jeweiligen menschlichen Gewaltverhältnissen und deren Legitimationsansprüchen stets existent. Als Grundessenz aller menschlichen Gewalt ist somit die eine, unmittelbare Urgewalt lediglich adaptierbar im Sinne einer Nachahmung, jedoch in ihrer Dignität und vor allem Notwendigkeit nicht ersetzbar. Mit dieser zentralen Prämisse teilt Vitoria die aristotelische Einschätzung einer ontologischen Qualität politischer Herrschaft (ebd.): „Die Quelle und der Ursprung der Städte und Staaten [rerum publicarum] ist keine Erfindung der Menschen, sondern stammt gleichsam von der Natur ab.“
Wenn es demnach naturbedingt ist, wie und auf welche Weise sich Menschen ihre politische Ordnung gestalten, dann funktioniert eine jegliche politische Ordnung nur nach ganz bestimmten Grundsätzen. Verlässt man diese ontologischen Grundsätze, dann scheitert Politik bereits an dem Basisbedürfnis, um dessentwillen überhaupt Politik für die Menschen nötig ist – nämlich zur Generierung und Absicherung von Ordnung. Die Ordnung und deren Legitimation werden somit für den ontologischen Politikanspruch des spanischen Scholastikers zum zentralen Kriterium. Als Dominikaner beantwortet Vitoria diese Frage mit theologischen Formeln. Jedoch räumt er der Beschäftigung mit Fragen der Politik einen durchaus eigenständigen Stellenwert innerhalb der Untergliederungen durch die Theologie ein und – anders als Luther – hält er die Politik sogar für ein „äußerst gewichtiges Thema“ (ebd.: 33).
Darin manifestiert sich das Neue in der Argumentation Vitorias. Zwar sieht er aufgrund der ontologischen Bindung an die Natur der Dinge klassischerweise die Frage des Staates (Respublica) als eine Angelegenheit an, die nur von einer Person, nämlich dem Monarchen, sachgerecht betrieben werden kann. Insofern existiert auch bei Vitoria noch die spätmittelalterliche Dialektik zwischen dem Körper des Königs als Amtsperson und dem Körper des Staates als materielle Form, für die das Amt überhaupt notwendig ist. Die eine Form des Körpers wird für die jeweils andere repräsentativ genommen. Versagt der eine Körper (z.B. der des Königs) personell, dann hat dies Konsequenzen auch für den Staat – und umgekehrt (Vitoria 1992: 29): „Der gesamte Staat kann zu Recht für eine Verfehlung eines Königs bestraft werden.“
Öffentliche und private Gewalt
Dennoch ist die Herleitung von politischer Ordnung bei Vitoria nur noch zum Teil von der traditionellen organologischen Argumentation mit dem Körper des Königs bestimmt. Vitoria weist vielmehr mit der Unterteilung zwischen einer öffentlichen Gewalt (potestas publica) und einer privaten Gewalt (potestas privata) zugleich auch auf argumentative Standards hin, die der römischen Rechtslehre entspringen und die mit dem organologischen Bild der scholastischen Interpretation nur noch bedingt kompatibel sind. Interessanterweise werden beide Sphären im Gesamtaspekt einer potestas civilis verdichtet. Erst die Zusammenführung von öffentlicher und privater Gewalt macht demnach die politische Ordnungsgewalt aus. Diese so generierte politische Herrschaft ist erst das Kennzeichen dessen, was wir modern als Staat bezeichnen – eine Gewalt, die Ordnung unter den Menschen schafft. Bei Vitoria ist dies das Kennzeichen für jene Welt, die neben der Spirituellen besteht, die aber auch hier zutiefst als von Gott generiert erscheint. Die Legitimation von politischer Ordnung (und damit auch die hinsichtlich ihrer Verwaltungs- und Führungsqualität) ist somit apriori von Gott gegeben. Eine Hinterfragung dieser Legitimation würde zugleich auf einen Gottesbeweis hinauslaufen. Dem stellt man sich wohlweislich nicht. Was aber zu behandeln ist, das ist die Logik der Politik – und sei es auch nur in der Ableitungsfunktion ihrer spezifischen Legitimation. Das heißt, die göttliche Dignität des Staates muss quasi materiell sichtbar gemacht werden.
Zur Kennzeichnung und Verifikation der Funktionslogik des Politischen als einer eigenständigen Sphäre wendet Vitoria das Beweisverfahren aus der Physik des Aristoteles an, indem er zwischen den bekannten Ursachenformen von einer causa materialis über formalis und efficiens bis hin zur Finalursache (causa finalis) unterscheidet. Letztendlich interessiert ihn hierbei nur das Kriterium der Finalursache selbst.
Der natürliche Bedarf nach Sozialität
Weil ontologisch gesehen alles Dasein seinen Sinn hat, gilt es den Sinn von politischer Ordnung zu entschlüsseln. Hierbei setzt Vitoria beim klassischen Ausgangspunkt der Aristotelischen Lehre an, wie er auch von der scholastischen Tradition übernommen worden ist: Der Mensch ist aufgrund seiner Triebstruktur ein äußerst schwaches Wesen, aber es gleicht seine natürliche Schwäche aus durch die Fähigkeit der Vernunft. Mittels Vernunft wächst der Mensch aus seiner ursprünglichen natürlichen Schwäche und Devianz heraus und wird somit zu einem recht starken Lebewesen. Dies gilt besonders dann, wenn sich der Mensch zu seinesgleichen kooperativ verhält. Erst in der Gemeinsamkeit mit Anderen erfährt das Mensch-Sein seine eigentliche Sinnhaftigkeit. Insofern ist nach der Aristotelischen Lehre die gesellschaftliche Existenz das Basisprinzip für menschliche Handlungen überhaupt. Als vereinzeltes Individuum ist der Mensch nicht überlebensfähig.
Die Notwendigkeit von Herrschaft
Nun besteht das wesentliche Problem darin, wie sich der Zusammenhalt einer jeweiligen Ansammlung von Menschen ordnungssoziologisch formieren lässt. Als geeignetste Herrschaftsform erscheint Vitoria hier die Monarchie. Aber gerade der Monarch bedarf, wenn er richtig lenken will, bestimmter Prinzipien, die in einer christlich strukturierten Gesellschaft keineswegs beliebig sein können. Die substantiellen Bedingungen für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft sind für den Gelehrten von Salamanca die Freundschaft (amicitia) und die Gerechtigkeit (iustitia). Ohne die Beachtung dieser beiden Prinzipien kann keine Gesellschaft existieren. Beide Prinzipien sind untereinander verschränkt, das eine kommt ohne das andere nicht aus, obwohl sie beide unterschiedlichen Sphären angehören: denn während das Freundschaftsprinzip in der Gesellschaft waltet, ist die Frage der Gerechtigkeit ohne eine Form von politischer Ordnung schlechthin nicht denkbar. Die Freundschaft basiert somit auf der natürlichen wechselseitigen Hilfe zwischen den Individuen, die Gerechtigkeit vermittelt hingegen der Staat als eine koordinierende und auch reglementierende Institution. Diese Dechiffrierung von Gesellschaft und Staat ist eine ontologische, weil Vitoria wie Aristoteles und die Kirchenväter darauf abhebt, das Herrschaft existentiell und immer sein muss, damit es so etwas wie Volk überhaupt geben kann. Herrschaft ist eine „zwingende Notwendigkeit“ im Leben der Menschen, weil alle durch die Anwendung und Funktion der Herrschaft ihren wechselseitigen Nutzen haben (ebd.: 51). Ohne Herrschaft existiert kein Volk.
Die Ursache von politischer Ordnung ist somit zugleich ihr Zweck selbst. In dieser Bestimmung manifestiert sich das ontologische Politikverständnis am deutlichsten. Es ist ein in sich geschlossenes Zirkelsystem der Begründung, das einzig und allein durch denjenigen, der es generiert hat, nämlich Gott, eine externe Position aufweist. Diese aber ist nicht hinterfragbar und so bleibt es beim ontologischen Zirkel, demzufolge „die Menschen mit einer solchen Natur und solchen Lebensumständen geschaffen“ worden sind, „daß sie nur in Gesellschaft leben können“ (ebd.).
Mit diesem Verweis, der geradezu klassisch an scholastische Interpretationsstandards des Mittelalters anknüpft, hätte es Vitoria bewenden lassen können und wäre auf einem etwas anderen Interpretationsweg somit auch nicht weiter gekommen als zeitgleich Luther. Er gibt sich jedoch mit diesem Modell nicht zufrieden. Wenn auch Gott die Lebewesen und ihre Formen generiert hat, so ist doch die Art und Weise, in der man sich politisch bewegt, für Vitoria eine Form der Existenz, die die Menschen selbst in der Hand haben (vgl. auch Brieskorn 2008: 148ff.). Denn es ist der Staat selbst, „dem es von sich aus zukommt, sich selbst zu beherrschen und zu verwalten sowie alle seine Gewalten auf das Gemeinwohl hin auszurichten“ (Vitoria 1992: 53). Auch wenn Gott hierbei als Ursprungskraft für die Existenz von politischer Ordnung normativ die Legitimation für Gesetze und Gewaltausübung gibt, so sind es dennoch positive Willenshandlungen von Menschen, die sie faktisch in Erscheinung treten lassen. Mit dieser formallogischen Anerkennung der empirischen Bedingungen menschlicher Existenz positiviert Vitoria die politische Sphäre zugunsten der menschlichen Optionen. Er geht jedoch noch nicht so weit, diese radikal nur noch als positivistische Setzungen zu dechiffrieren. Normativ bleibt alles gekoppelt an den Aussagen des Evangeliums, und das bedeutet: politische Ordnung kann nur dann als Ordnung funktionieren, wenn sie eine christliche ist.
Der Tyrann als Antimodell
Das politologische Gegenmodell zur Monarchie – der Tyrann – scheitert gerade deshalb stets, weil er seine Herrschaftsgewalt lediglich selbstbezogen, eigennützig, eben nicht an Gerechtigkeit und Freundschaft orientiert, ausübt. Vitoria sieht hierbei die Konsequenz, dass jeder Staat dazu verpflichtet sei, seine „Gewalt nur jemanden zu geben, der die Gewalt gerecht ausübt und einsetzt“; „andernfalls begibt er [der Staat] sich in Gefahr“ (ebd.: 73).
Hier bestätigt sich erneut die ontologische Struktur in der Argumentation: Da nichts von Zufall ist, wird die Ursache für eine politische Ordnung auch zu ihrem Scheitern beitragen. Jede Sache „wird durch dieselben Ursachen vernichtet, durch die sie hervorgebracht wird“ (ebd.: 125). Das impliziert die zeitliche Unbeständigkeit von politischer Ordnung, die auch für die christliche Politik gilt. Selbst die beste christliche Herrschaft ist nicht von (ewiger) Dauer, weil die menschlichen Akteure aufgrund ihrer Triebstruktur allzu oft die normativen Bedingungen und Vernunftkriterien außer Acht lassen. Gegenüber den nichtchristlichen Ordnungen, insbesondere der Tyrannis, hat sie aber den Vorteil, die Stabilität noch am besten herzustellen.
In diesem Punkt, dem Stabilitätskriterium von politischer Ordnung, übernimmt Vitoria ebenfalls die Augustinische Zwei-Reiche-Lehre: Während das Reich Christi für die Gegenwart und Zukunft da ist, existiert das weltliche Regime einzig und allein für die Anforderungen der Gegenwart. Darin kommt ihm aber funktionale Notwendigkeit zu – und deshalb muss man jeder politischen Herrschaft auch gehorchen. Selbst der Tyrann ist in diesem Gehorsamsmodell noch naturrechtlich legitimiert, „denn menschliche Gesetze verpflichten in derselben Weise, als ob sie von Gott gemacht wären, wenn auch nicht so fest“ (ebd.: 115). Vitoria kann so argumentieren, weil er das Naturrecht in zwei Gehorsamsebenen unterteilt: 1) einen Gehorsam gegenüber Gott, was zweifellos die höhere Dignität hat, 2) einen Gehorsam gegenüber den Gesetzen des Staates, die – auch wenn sie willkürlich ausfallen – dennoch befolgt werden müssen!
Allerdings steht auch der Monarch unter den Bindungen des göttlichen Naturrechts und damit in der Verantwortung zur Befolgung der Gesetze, „selbst auch dann, wenn sie vom König gemacht worden sind“ (ebd.: 123).
Christliches Naturrecht
Es gibt somit für den christlichen Alleinherrscher keine legitime Entscheidungsfreiheit außerhalb des Naturrechts. Wenn er diese doch beansprucht, wird er nach Auffassung von Vitoria nicht nur normativ, sondern auch funktional scheitern. An den von Gott implementierten Gesetzen kommt keine politische Ordnung vorbei, so weltlich sie sich zu Recht auch geben mag.
Man erkennt an dieser Auslegung von staatlicher Gewalt eine sehr viel strengere Rückkoppelung an das Naturrecht, als dies bei Luther gegeben ist. Gleichwohl bleibt die Berechtigung für ein eigenständiges Operationsfeld im Bereich des Politischen bestehen und wird in der Lehre Vitorias weitaus klarer formuliert. Durch die Hereinnahme der Prinzipien, was gerecht und im Sinne der Freundschaft überhaupt menschenwürdig ist, enthält seine Interpretation zudem eine sehr viel deutlichere Festlegung für die Finalursache des Staates. Politische Ordnung ist nun nicht einfach nur ein notwendiges Übel zur Bezwingung der Triebstruktur des Menschen, sondern muss normativ wie funktional die Verbesserung der irdischen Existenz der Christen anstreben.
Auch wenn vieles in der Argumentation Vitorias noch signifikant den Kriterien einer politischen Theologie des Mittelalters verpflichtet ist, eröffnet seine Interpretation dennoch die Perspektive zur Abtrennung theologischer Interpretamente von den innerweltlichen Bedürfnissen. Es wird nun möglich, die Prinzipien und Mechanismen der menschlichen Existenz, die das christliche Naturrecht aufzeigt, für den Bereich politischer Ordnungslehren nutzbringend zu formulieren. Andere Autoren aus der Schule von Salamanca, wie Juan de Mariana (1536–1623) und etwa Francisco Suárez (1548–1617), der Begründer einer neuen Völkerrechtslehre, sind Vitoria hierin gefolgt (vgl. García 1993: 27ff.).