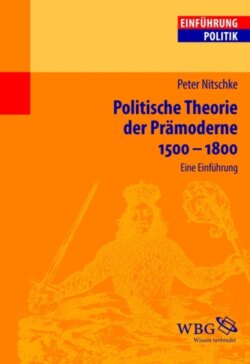Читать книгу Politische Theorie der Prämoderne 1500-1800 - Peter Nitschke - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Jean Bodin und die Souveränität des Monarchen
ОглавлениеFürstenspiegel
Die christliche Politiktheorie ist jedoch nicht nur auf dem Feld einer politischen Begründung der menschlichen Anthropologie vorangeschritten, sie hat auch hinsichtlich der institutionellen Legitimation von Herrschaft überhaupt eine ganz wesentliche Begründung erbracht – und zwar in Bezug auf die Herrschaftsspitze. Zwar ist es immer schon ein allgemeines Kennzeichen der politischen Theologie des Mittelalters gewesen, in der Person des Monarchen als dem einen wahren, weisen und gerechten Lenker des Volkes die Dignität der Führungsfunktion normativ wie auch funktional zu untermauern. Die Fürstenspiegelliteratur seit dem 12. und 13. Jahrhundert ist voll von derartigen Zuweisungen. Doch erfolgt die Bestimmung der politischen Leitungsaufgaben im Wesentlichen noch nach theologischen Prämissen und Standards. Seit Vitoria beginnt die allmähliche Loslösung davon, auch wenn der Endbezug zur Gottesfrage nach wie vor evident bleibt. Nicht geklärt, jedoch seit dem Spätmittelalter heftig diskutiert, ist die Frage, welchen funktionalen Stellenwert der Monarch hat. Ist er z.B. lediglich Gleicher unter Gleichen – ein etwas privilegierter Adliger im Adel – oder ist er mehr? – Hat der König gar eine Suprematiestellung, die ihn unanfechtbar macht gegenüber den konkurrierenden Interessen der Stände? – Und vor allem: wie ist seine Position gegenüber der Kirche?
All diese Fragen sind geradezu mustergültig gebündelt und beantwortet worden in der Souveränitätstheorie des Jean Bodin (1529/30–96), der, was meist übersehen wird, nicht einfach nur eine säkulare, positivistische Wendung zur Staatslehre vorgenommen hat, sondern diese zugleich immer noch in einen metaphysischen Gesamtrahmen platziert. Der traditionelle Diskurs des mittelalterlichen Fürstenspiegels wird hier nur noch formal aufgenommen, inhaltlich geht der französische Rechtsgelehrte und Politiker weit über die erbaulich-mahnende Betrachtung hinaus. Dennoch findet sich in allen Argumenten immer noch ein Restbezug auf Gott. So ist der rettende Hafen für ein jeweiliges Staatsschiff stets der, „den uns der Himmel weist und den wir zu erreichen hoffen dürfen, wenn wir es nur wollen“ (Bodin 1981–86: 93).
Genau dies aber müssen Christen um ihrer selbst willen stets wollen, weil sie sonst im Strudel der Triebstrukturen und Leidenschaften zwangsläufig untergehen. Hier steht Bodin ganz auf dem Fundament der neoscholastischen Politikauslegung, die er mit christlicher Referenz für antike Autoren wie Platon und Aristoteles zugunsten einer lex aeterna Dei abzusichern sucht. Die verderbliche Triebstruktur des Menschen kann durch den Vernunft-Anspruch im Zaum gehalten werden. Das ist besonders für den Fürsten der maßgebliche Punkt überhaupt: er muss sich der Erkenntnis der ewigen Gesetze Gottes stellen und versuchen, die Implikationen, die daraus erfolgen, möglichst konsequent anzuwenden.
Dieser Grundsatz gilt vor allem im Hinblick auf das höchste Staatsziel, der Herstellung und Gewährleistung von Gerechtigkeit, die von Bodin als „Fähigkeit zum Befehlen in Rechtschaffenheit und Anstand“ definiert wird (ebd.: 96).
Radikal neu an der Bodinschen Lehre ist seine Kerndefinition von Staatlichkeit (ebd.: 98): „Unter dem Staat versteht man die an Recht orientierte, souveräne Regierungsgewalt über eine Vielzahl von Haushaltungen und das, was ihnen gemeinsam ist.“
Souveränität
Besonders die Bezeichnung von der souveränen Regierungsgewalt ist es, die hier heraussticht und Aufmerksamkeit verdient. Die Frage ist, ab wann oder wodurch eine Regierungsgewalt souverän genannt werden kann?
Bodin beantwortet diese Frage mit einem regelrechten Programm von axiomatischen Aussagen, die stets gekoppelt werden mit empirischen Beweisstücken aus der eigenen bzw. früheren Epochen. Anders als die bisher genannten Vertreter einer Politica Christiana werden nun auch historische Beispiele für die Evidenz der behaupteten Aussagen zu Rate gezogen. Die Theorie von der Souveränität der Regierung illustriert sich fortlaufend am zeitgenössischen wie historischen Datenmaterial, ein Verfahren, welches Bodin zweifellos vom Florentiner Skandalautor Niccolò Machiavelli (1469–1527) übernommen hat. Allerdings benutzt Bodin nur die Methode Machiavellis (vgl. Kapitel II), in der politischen Perspektive und im normativen Ergebnis stimmt er mit ihm nicht überein.
Gegenüber Machiavellis simpler Konstruktion von Politik und Macht fordert Bodin erneut die Beachtung der rechtlichen Grundlagen „nach Maßgabe der Naturgesetze“ ein (Bodin 1981–86: 100). Wie Augustinus verweist er darauf, dass der einzige Unterschied zwischen einem Staat und einer Räuberbande der sei, dass der Staat von Gesetzen und eben nicht von Willkür regiert werde. Die Souveränität des Staates bedingt somit bei Bodin die Legitimation des Rechts und daraus folgend auch die Legitimation der Gesetze selbst. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann gibt es auch keine sinnvolle Politik.
Hier zeigt sich erneut eines der Spezifika der christlichen Politiktheorie: Sie stellt nicht nur die Frage nach der Legitimation von Politik, sondern formuliert diese Frage zugleich als Wahrheitsfrage. Der praktische Vollzug von Normen ist in dieser Hinsicht kein Akt der funktionalen Beliebigkeit, sondern ergibt sich zwingend aus den naturrechtlichen Grundsätzen Gottes. Hierbei ist der Appell an die Vernunft für Bodin nur Mittel zum Zweck. Der Zweck besteht darin, die richtige Relation zwischen Weisheit, Wissen und Gläubigkeit zu ermitteln. Erst diese drei Kategorien der Seinserkenntnis bilden das Kriterium der wahren Weisheit, die Bodin als „den Gipfel der Glückseligkeit dieser Welt“ auffasst (ebd.: 102).
Die Glückseligkeitskonzeption des Staates
Das Kriterium der Glückseligkeit wird somit zu einem Endzweck, der über den Staat hinaus verweist. Es ist dies zugleich das theopolitische Leitmotiv der Bodinschen Doktrin von der Souveränität. Das Hauptargument zugunsten einer staatlichen Souveränität enthält demnach nicht nur einen klassischen Reflex auf die Aristotelische Glückseligkeits-Konzeption, sondern vollzieht zugleich deren metaphysische Einbettung in ein kosmologisches Gesamtverhältnis von Welt. Eben deshalb ist auch „das menschliche Handeln der Kontemplation als seinem Ziel untergeordnet und […] in ihr das höchste Gut zu sehen“ (ebd.: 104). Jegliche Positionierung und Legitimierung staatlicher Macht muss diesen Sinnbezug vermitteln und zentral dabei im Auge behalten, dass der Staat für die Herstellung der Glückseligkeit nur Mittel zum Zweck sein kann.
Indem der Staat mittels seiner spezifischen Kompetenz a) die „täglichen Geschäfte“, b) den „Lauf der Gerechtigkeit“ und c) „Schutz und Verteidigung der Untertanen“ sowie d) deren materielle Grundversorgung operationalisiert (ebd.: 105), schafft er überhaupt erst die notwendigen Voraussetzungen für das Streben nach Glückseligkeit. Auffallend ist, wie sehr Bodin mit diesen vier Leistungsparametern staatliche Funktionen auf funktionale Grundgüter beschränkt. Im Prinzip wird hiermit der ganze Katalog des prämodernen Wohlfahrtssystems angesprochen, wie er historisch zu dieser Zeit gerade in der Entstehung begriffen ist. Nur in der Kategorie (b), dem Lauf der Gerechtigkeit Genüge tun, orientiert sich Bodin noch an einem klassischen normativen Kriterium der älteren Scholastik. Jedoch hat selbst dieses Kriterium in der Lehre des französischen Hofberaters, der Bodin eine Zeitlang auch gewesen ist, eine funktionale Komponente, zielt doch die Gerechtigkeitsfrage hier eindeutig auf die distributiven Verfügungs- und Zuteilungschancen für die Souveränität des Staates.
Der Staat als Metafamilie
Diese Souveränität wird im Grunde durch die Analogie mit dem Status der Familie definiert. Herrschaft, hier zunächst noch soziologisch betrachtet, findet sich bereits in der natürlichen Form der Vereinigung zwischen Mann und Frau, die sexuell zustande kommt. Moralisch wird diese Vereinigung von der Religion legitimiert und positiv-rechtlich im Ehegelöbnis öffentlich dokumentiert. Aus dieser natürlichen Kontraktsituation heraus versteht Bodin in Analogie auch den Staat: dieser ist im Grunde eine Zusammensetzung von familiaren Einheiten und Verbänden – eine Metafamilie (vgl. auch Kapitel IV).
Insofern kann der Monarch im Staat genauso agieren wie der Familienvater (pater familias) in seiner Statuseinheit. Die Entscheidungsfreiheit, die dem Familienoberhaupt zukommt, kann der Monarch auf der Bühne des Staates für sich in gleicher Weise reklamieren. Der einzige, aber wesentliche Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass der Familienvater nur innerhalb der Familie bestimmen darf, der Monarch hingegen für das Feld des Allgemeinen, der Öffentlichkeit schlechthin zuständig ist.
Mit dieser Analogie orientiert sich Bodin an der römisch-rechtlichen Unterscheidung zwischen öffentlicher und privater Sphäre. Dieses Differenzmodell, welches schon bei Vitoria auftaucht, wird nun explizit zugunsten der staatlichen Sphäre ausgebaut: „Denn von Staat kann keine Rede sein, wo es keine öffentlichen Einrichtungen gibt“ (Bodin 1981–86: 110). Umgekehrt kann auch von Privatbesitz keine Rede sein, sofern nicht eine öffentliche Sphäre vorhanden ist. Beide Sphären bedingen sich somit wechselseitig. So wie der Pater Familias seine natürliche Freiheit hat, die Spielregeln in der Familie zu gestalten, so verfügt auch der Monarch über die Kompetenz der Selbstbestimmung in Sachen des Staates. Beide Formen der Selbstbestimmung sollten jedoch mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Das theopolitische System im Sinne einer auf Gott bezogenen politischen Legitimation rundet sich hier erneut durch die naturrechtliche, metaphysische Dimension ab.
Der Monarch als Stellvertreter Gottes
Für den Monarchen bedeutet dies, dass seine Gewalt autark sein muss, will er souverän sein. Als Stellvertreter Gottes (vicarius Dei) hat er „außer Gott keinen Höheren über sich“ anzuerkennen (ebd.: 207). Im Gegensatz zu einem gewählten Amtsträger, etwa einem römischen Konsul, ist der christliche Monarch als Souverän keineswegs rechenschaftspflichtig gegenüber dem Volk. Er handelt, weil Gott ihn dazu legitimiert hat (vgl. auch Neschke-Hentschke 2008: 196).
Allerdings gibt es bei Bodin eine wichtige Einschränkung dieser Souveränität: Da der Souverän nach wie vor ein Mensch ist, muss er sich wie alle anderen Menschen auch nach dem „göttlichen Gesetz oder dem Naturrecht“ richten (Bodin 1981–86: 210). Das bedeutet, dass er keine Handlungen vornehmen darf, die dem naturrechtlichen Status des Mensch-Seins zuwiderlaufen (ebd.: 214): Denn den „Gesetzen Gottes und der Natur dagegen sind alle Fürsten der Erde unterworfen und es steht nicht in ihrer Macht, sich über sie hinwegzusetzen“!
Die Einschränkung der monarchischen Souveränität
Hieraus folgt eine ganz wesentliche Einschränkung des Souveränitätsprinzips, welches in der rein juristischen Betrachtung der Bodinschen Lehre oft übersehen wird: Zwar mag der Fürst sich an seine eigenen Gesetze nicht halten müssen, denn auch diese sind letztendlich souverän-subjektiv formuliert worden. Er muss sich aber an all das halten, was rechtmäßig und vernünftig in Verträgen formuliert ist (Bodin 1981–86: 215). Das Kriterium einer Betrachtung des Gemeinwohls (bonum commune) gilt auch und zuallererst für den Souverän selbst. Der Souverän kann also nicht machen, was er will, er verbleibt stets in der ontologischen Obhut Gottes, der über die wirkliche Allmacht der Dinge gebietet.
Bodin bezieht sich hier extra auf den Vertragsstatus, um den bindenden Unterschied zum Gesetz darlegen zu können (ebd.: 216): „Denn ein Gesetz hängt vom Willen dessen ab, der die Souveränität innehat und damit zwar alle seine Untertanen, nicht aber sich selbst binden kann. Ein Vertrag dagegen begründet wechselseitige Beziehungen zwischen den Fürsten und den Untertanen und bindet beide Parteien gegenseitig.“ Der Fürst ist in solch einem Fall per Vernunft und einmal erzielten Konsens eingebunden in seiner Verpflichtung. Er kann sich dem nicht mehr entziehen. Insofern ist auch die Natur der politischen Ordnung für den Souverän unantastbar: Was die Ordnung konstituiert, ist für den Souverän nicht hintergehbar.
Gleiches gilt selbstverständlich auch für die Stände. Folglich darf es von dieser Seite gegen die Souveränität desjenigen, der die Konstitution der politischen Ordnung garantiert und aufrechterhält, erst recht keinen Widerstand geben. Sowenig, wie in der Familie gegen die Anordnungen des Familienvaters aufbegehrt werden darf, so sehr gilt das Widerstandsrecht auch gegenüber der Regierung als disqualifiziert. Ein Aufstand gegen den Fürsten wäre ein Aufstand gegen die natürliche, von Gott gewollte Ordnung. Da der Monarch keine von Menschen verliehene Würde hat, sondern ein Amt bekleidet, das aufgrund seiner Vicarius-Dei-Funktion normativ ewig wirkt, können nur andere, weitere Amtsinhaber gegen einen Fürsten vorgehen, wie das z.B. innerhalb einer aristokratischen Regierung der Fall wäre. Ansonsten aber ist die Qualität der Souveränität des Amtes durch die Prinzipien der Ordentlichkeit und Unbefristetheit gekennzeichnet (ebd.: 432). Diese Prinzipien verhelfen der Souveränität des Staates zum einheitlichen Ganzen, das über die diversen Statusgruppen der Einzelglieder triumphiert. Der Staat ist folglich mehr als nur die Summe seiner Teile: Er unterscheidet sich von diesen zusätzlich dadurch, „daß er eine mit souveräner Gewalt regierte Gemeinschaft ist, die so klein sein kann, daß sie überhaupt keine Korporationen und Kollegien aufweist, sondern ausschließlich aus einer Anzahl von Familien besteht“ (ebd.: 521).
Der Geist der Freundschaft im Staat
Die familiare Existenz ist demnach der Ursprung aller Dinge. Auch die Kollegien und Korporationen „haben ihren Ursprung in der Familie als ihrem Wurzelstamm“ (ebd.). Der Staat als übergeordnete Familiengemeinschaft bzw. Korporationsstruktur ist für die Freiheit und den Schutz der einzelnen Glieder zuständig. Der Staat sichert die Freundschaft unter den Familien. Denn es ist jene „grenzenlose Freiheit“ gewesen, „ungestraft auf Raub ausgehen zu können“, welche die Menschen ursprünglich dazu gezwungen hat, als sie noch keine Fürsten und Magistrate kannten, „sich in Freundschaft zu verbinden, um sich gegeneinander zu verteidigen und Gemeinschaften und Brüderschaften einzugehen“ (ebd.: 522). Da erst Freundschaft eine politische Ordnung generiert und die Bürger zusammenhält, ist die Ständegesellschaft unmittelbare Anwendung dieses natürlichen Prinzips. Jeder Mensch ist im Freundschaftskreis seines Standes zu begreifen. Die Ständegesellschaft vermittelt nach dieser Doktrin natürlicherweise die unterschiedlichen Bedarfs- und Statusebenen für die soziale Existenz. Die einzelnen Statusgruppen müssen folgerichtig „durch feste Bande untereinander und mit dem Staat verbunden“ sein (ebd.: 547). Einhergehend mit der jeweiligen Statusfunktion besteht nicht nur ein materieller Rahmen, der nicht überschritten werden darf, sondern auch eine normative Daseinsberechtigung, aus der sich die Ordnung der Dinge selbst ergibt. Diese ontologische Ordnung ist das tragende Element in der Souveränitätstheorie des Jean Bodin (ebd.): „Nichts aber ist schöner anzuschauen als Ordnung, nichts bereitet dem Geist größeres Vergnügen, nichts eignet sich mehr zur praktischen Nachahmung.“
Politische Ordnung
Das Herbeiführen einer organologischen Ordnungsstruktur ist somit das zentrale Gebot für eine erfolgreiche politische Herrschaft. Da die Menschen in ihrem jeweiligen Status verschieden sind, müssen sie sozial differenziert betrachtet und gruppiert werden. Insofern kann es keine sozialpolitische Gleichheit geben. Eine formale soziale Gleichheit würde den ontologischen Politikbegriff nominal wie funktional ad absurdum führen. Denn „wenn jeder Bürger Adliger ist, kann keiner als adelig angesehen werden“ (ebd.: 550).
Man ist nicht nur einfach zufällig in einem Stand, sondern man leistet auch etwas. Diese Leistung unterscheidet das jeweilige Standesdasein dann zu Recht von dem anderer Stände. Insofern kann Bodin ganz konsequent eine dezidierte Standeslehre der politischen Ordnung formulieren, die – angefangen vom König an der Spitze – über den Klerus, den Senat, das Militär, Beamte und Richter, Ärzte, Studenten und Professoren, Kaufleute und Bauern bis hin zum Stand der Handwerker reicht (vgl. ebd.: 566f.).
Die Handwerker stellen in diesem Ordnungsgefüge deshalb die unterste soziale wie politische Statusgruppe dar, weil sie keine eigenständige Erwerbstätigkeit ausführen, sondern auf die Produktionszufuhr anderer Gruppen originär angewiesen sind. Mit diesem Modell folgt Bodin dem griechischen Arbeitsbegriff, indem er Arbeit als eine originäre Tätigkeit auffasst, für die man auch eine spezifische Wesensgrundlage haben muss. Wie Platon schließt er hierbei „Maler Bildhauer […], Flötenspieler, Schauspieler, Tänzer […]“ etc. aus oder möchte sie auf die absolut unterste Stufe degradiert sehen (ebd.: 567). Geradezu klassisch männlichkeitsorientiert formuliert er dann im Sinne des Patriarchats all das, was bis weit in die Moderne hinein politische Praxis bleibt (ebd.: 570): „Was die Frauen anbelangt, so sei nur das eine gesagt: Ich bin der Meinung, sie sollten von allen Magistratsämtern, Befehlsfunktionen, Richterstellen und öffentlichen Ratsversammlungen so weit wie möglich ferngehalten werden, damit sie sich mit Hingabe ihren Aufgaben als Gattinnen und Hausfrauen widmen.“
Hier schließt sich der organologische Kreis. Es wäre jedoch müßig, den französischen Rechtsgelehrten des 16. Jahrhunderts wegen der frauendiskriminierenden Aussagen für patriarchalisch borniert zu halten, denn auch Klassiker der politischen Theorie der Moderne wie etwa Karl Marx haben ähnliche Reflexionen an den Tag gelegt.
Bodin führt zweifellos den Grundgedanken der Politica Christiana sehr systematisch auf ein neues Feld. Die ursprüngliche, theologisch besetzte Souveränitätsthematik wird nunmehr für den Bereich des Politischen nutzbar gemacht – und zwar sowohl in Bezug auf die Person des Monarchen als auch seiner Funktion als staatlicher Träger überhaupt. Damit geht Bodin den konsequenten Weg einer stringenten Formalisierung der Rechte und Kompetenzen zugunsten der Alleinherrschaft, dies auch und gerade gegenüber der Kirche. Diese Bestimmung hat Schule gemacht, wenn auch mit ungeahnten Folgen.