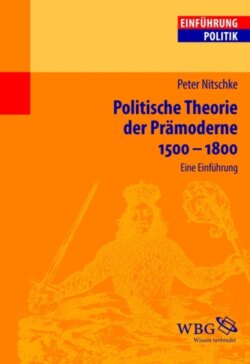Читать книгу Politische Theorie der Prämoderne 1500-1800 - Peter Nitschke - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Justus Möser und die prämoderne Bürgergesellschaft
ОглавлениеDie Vertreter der Politica Christiana sind besonders auf dem europäischen Kontinent, und hier vor allem in Mitteleuropa, auffällig stark und nachhaltig bis ins 18. Jahrhundert hinein vertreten. Insbesondere deutschsprachige Autoren haben sich immer wieder an den normativen Grundlagen orientiert und diese vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen territorialen oder zeitlichen Bezüge etwas modernisiert. Einer der letzten großen Vertreter im Zeitalter der Aufklärung ist der Osnabrücker Staatsmann und Literat Justus Möser (1720–94), der in einer ganz eigentümlichen Mischung Aufklärung und Moderne mit prämodernem Denken verbindet.
Das Modell der begrenzten Monarchie wird von Möser im Kontext einer allgemeinen Debatte zur respublica mixta, einer Mischverfassung, an der sich auch Autoren wie Johann Jakob Moser (1701–85), Christian Wolff (1679–1754) und Johann Heinrich Gottlieb von Justi (1720–71) zentral beteiligt haben (vgl. Dreitzel 1991: 786ff.), unter dem Aspekt der Reformmöglichkeiten begriffen und thematisiert. Möser liefert dabei allerdings keine dezidierte Staatstheorie, sondern lediglich Fragmente für ein in bestimmten Eckpunkten differenzierteres Verständnis von Politik und Gesellschaft. Die Existenz des Staates, die er anhand der Herrschaftsverhältnisse im Hochstift und Fürstbistum Osnabrück begreift, in dem er jahrelang in unterschiedlichen Regierungsfunktionen tätig war, ist ein Spezifikum – und keine Universalität. Möser hat eine klare Abneigung gegen Verallgemeinerungen der Aufklärung, in denen abstrakte Prinzipien die konkreten Bedürfnisse und das Verständnis des Lebens in seiner Alltagspraxis ersetzen. Dies gilt besonders in der Frontstellung zu Jean-Jacques Rousseau (1712–78), den Möser wegen seiner idealistischen Prämissen im Menschenbild und in den Folgerungen zur Entstehung des Staates ablehnt. Gegen die Lehre des französischen Aufklärers erinnert Möser daran, dass die Entstehung jeder politischen Ordnung historisch betrachtet ohne die Macht der Waffen nicht ausgekommen sei. Nur mit der „Macht, viele Köpfe zu vereinigen, sie auf den Notfall zu zwingen, zu züchtigen, zu strafen, zu henken, zu brennen, ganze Rotten von ihnen zu vertilgen“ kommt so etwas wie politische Ordnung zustande (Möser 1937: 84).
Eine solche Argumentation erinnert an Luthers Pamphlete über die aufständischen Bauern. Tatsächlich hat Möser Luthers Weltbild in wichtigen Teilen übernommen und den Reformator auch gegen zeitgenössische Kritik, wie sie etwa von Voltaire (1694–1778) kam, verteidigt (vgl. Beyme 2009: 164). Wie bei Luther, so ist auch bei Möser die Macht des Staates, so notwendig sie auch sei, kein Selbstzweck. Die Legitimation der politischen Macht bleibt auf das christliche Bekenntnis ausgerichtet. Mit reiner Säkularität hat Möser nichts im Sinn: auch die „Religion ist eine Politik, aber die Politik Gottes in seinem Reiche unter den Menschen“ (Möser 1937: 87, Hervorh. v. dems.). Denn der Endzweck des Menschen liegt immer jenseits des Staates. Der Staat erscheint hierbei nur als das Medium, das heißt konkret als irdischer Körper, zum Zwecke der Realisierung des christlichen Glaubens auf Erden.
Das Volk als Pöbel
Notwendig ist die staatliche Gewalt, weil die Menschen an sich vor irgendwelchen Dummheiten nicht gefeit sind. Die anthropologische Beschränktheit bringt Möser auf den Punkt, wenn er formuliert „Wir sind alle Pöbel“ – und geradezu nietzscheanisch hinzufügt (ebd.: 92): „Was ist der Mensch? Ein Tier, das an der Kette seiner Einbildung liegen soll.“
Vor dem Staat kommt die Religion
Staatliche Gewalt und der Glaube führen zur vernunftorientierten Anleitung im gesellschaftlichen Zusammenhang. Ohne den Glauben, das hieße nur mit Gewalt, ist ein bürgerliches, geordnetes Leben nicht möglich. Möser insistiert auf diesen fundamentalen Sinnzusammenhang: Wenn man das christlich intendierte Gewissen schwächen oder überhaupt gänzlich abstreiten würde, „so heben wir den bürgerlichen Nutzen jeder Religion auf“ (ebd.: 97). Die Prädisposition der religiösen Kultur ist der Dimension des Staates vorgelagert, ohne sie kann er in diesem bürgerlichen Sinne nicht existieren. Im Grunde handelt es sich hierbei um eine intrinsische Zuspitzung der Lutherischen Zwei-Reiche-Lehre, nunmehr mit einer modernen Hervorhebung in Bezug auf das handelnde Subjekt, den Bürger als Garant des Staates.
Bevor der moderne Staat heraufzog, waren die bürgerlichen Tugenden schon vorhanden. Der Staat konnte (und kann) nur das verstärken, was an zivilisierten Werten bereits existent ist und artikuliert wird. Die nicht hintergehbare Dignität der religiösen Dimension in der vorpolitischen Sphäre begrenzt zugleich den Machtanspruch der öffentlichen Gewalt (vgl. auch ebd.: 103).
In seiner Abhandlung Staat mit einer Pyramide verglichen wird das Herrschaftsmodell aus der Lehre Bodins erneuert und zugleich modifiziert: Der Monarch wird gewählt, gleichwohl arbeitet die Natur „gerade nach den Regeln“ der Pyramide (ebd.: 306), ist also grundsätzlich herrschaftsorientiert. Staatlichkeit entsteht demnach generativ, ist mitnichten das Einzelwerk irgendeines „kühnen Reformators“ (ebd.: 309).
Gemeinschaft durch Naturerfahrung
Das Modell, mit dem Möser diesen historischen-generativen Prozess von Staatlichkeit beschreiben will, leitet er aus den Anforderungen der Natur ab. Die Menschen werden im Kampf gegen die Naturgewalten um ihrer nackten Existenz willen zur gemeinsamen Arbeit und damit zur Sozialität schlichtweg gezwungen. Sie können, etwa beim Schutz ihrer Felder gegen die Überflutungen an der Nordseeküste, nur dann bestehen, wenn sie nicht als Einzelne handeln, sondern gemeinschaftlich (vgl. Möser 1768: 477). Politik gründet sich demnach auf eine gemeinsame Naturerfahrung bzw. Herausforderung. Hierbei geht es zunächst nur um die Organisation von Arbeitsabläufen zur Herstellung und Gewährleistung der Existenzsicherung. So unterschiedlich die geografischen Bedingungen vor Ort sind, so unterschiedlich kann und darf politische Herrschaft ausfallen. Möser erweist sich hier als Verfechter des Konkreten und der spezifischen Differenzen von Politik.
Die Aktientheorie
Das hindert ihn allerdings auch daran, ein systematisches Profil für die Politische Theorie zu präsentieren. Die Detailfreude, in die er sich zugunsten von Handelsfragen oder der Viehwirtschaft im Osnabrücker Hochstift verlieren kann, verbleibt in der Deskription. Immerhin ist die so genannte Aktientheorie, die ein genossenschaftliches System beschreibt, ebenso originell wie innovativ (vgl. Möser 1774: 143ff.). Nach diesem Modell liefert das jeweilige Land mit seinen natürlichen Eigenschaften und Ressourcen die Grundlagen für die sozialen Lebensformen der Menschen und Völker. Was die Menschen konkret aus den natürlichen Raumressourcen realisieren, entscheidet sich nach ihren kognitiven und sozialen Fähigkeiten. Die Bündelung dieser Fähigkeiten geschieht in Form einer Aktie. Aus der Zusammenführung verschiedener Aktien für differente Arbeitsabläufe kommt schließlich der Staat zustande. Da die Aktien jedoch qualitativ different bleiben, weil sie unterschiedlichen Arbeitsprozessen und Leistungsvermögen entsprechen, sind auch die Individuen als Bürger nicht gleich in ihren bürgerlichen Rechten. Eigentum und Ehre bedeuten in der nach wie vor ständisch geprägten Ordnungsvorstellung von Möser, dass die Bürger nur im Rahmen ihrer jeweiligen Genossenschaft, als Mitglied einer Standeskorporation, in gleicher Weise Rechtssubjekte sind. Freiheit gibt es nur innerhalb der Mitgliedschaft einer Genossenschaft. Man mag dies als mittelalterliche Sicht abtun (vgl. Schröder 1995: 300), dahinter kommt jedoch auch ein historisches Bewusstsein zum Tragen, bei dem Anleihen an das germanische wie das römische Recht zu einer Synthese für Land und Herrschaft gebracht werden.
Die Freiheitsrechte im Staat
Im Besitz von Land manifestiert sich für Möser nicht nur ein (römisches) Eigentumsverständnis, sondern ebenso auch ein (germanisches) Freiheitsbewusstsein. Freiheit ist nur dann gegeben, wenn sie per Gesetz rechtmäßig geordnet ist. Eine prinzipielle, das heißt universale Freiheit, wie sie etwa im Naturrecht der Aufklärung angezeigt wird, gilt für den Osnabrücker Staatsmann nicht. Wie bei allen Vertretern einer christlichen Politikauffassung bleibt der Freiheitsbegriff an die Ordnungskonzeption des Ganzen angebunden. Eine Freiheit für den Einzelnen ist hier nicht möglich, die Autorität des Staates gewährt Freiheitsrechte, aber nicht der einzelne Bürger von sich aus. Insofern ist es zwar eine Anlehnung an mittelalterliche Theoreme, jedoch zugleich auch eine Modernisierung und Loslösung, die Möser in seiner Auffassung von Politik hier betreibt. Den Absolutismus lehnt er ebenso ab wie den radikalen Republikanismus der jakobinischen Revolutionäre. Der Staat ist in der Vorstellung Mösers nicht die allein seligmachende Instanz, die Gerechtigkeit vermittelt, mitnichten also der moralische Endzweck im Leben der Menschen. Die Notwendigkeit und Wirkungen seiner Funktionsbedingungen lassen sich auch nicht einfach nur idealerweise abstrakt analysieren, sondern kann man nur (aber das ist nicht wenig) historisch konkret beschreiben.
Politica Christiana als deutsches Politikverständnis
Justus Möser, der als Literat und Historiker mindestens ebenso viel geschrieben hat wie als Advokat und Staatsmann (vgl. Welker 2007), ist der Denker des Lokalen. Politik findet hier zunächst und ganz überwiegend in einem lokalen bis regionalen Bezugsrahmen statt. Es geht also nicht (mehr) um die Theorie zugunsten imperialer Gestaltungsräume, um die großen Reiche, sondern um die kleinen Leute und die kleinen Lebenswelten. Das mag am Ende eines drei Jahrhunderte überspannenden Diskurses christlicher Politik zwar typisch deutsch sein, aber in dieser bewusst von Möser gewollten Beschränkung zur Provinzialität schimmert auch eine innerweltliche Skepsis durch, die sich berechtigterweise vor dem idealen System der Welterfahrbarkeit verweigert.