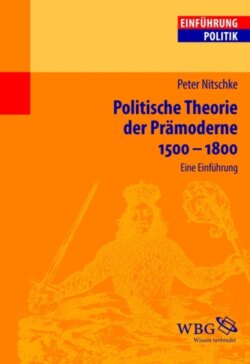Читать книгу Politische Theorie der Prämoderne 1500-1800 - Peter Nitschke - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Diskursansatz
ОглавлениеDie Herleitung von politischer Theorie geschieht zweifellos immer durch einen vorgegebenen historischen Kontext, der selbst nicht beliebig ist. Das heißt, politische Theorien sind nicht einfach nur abstrakte Statusanzeigen von Wirklichkeitsverständnis, sondern sie gehen einher mit Bedeutungsmustern nominaler wie ontologischer Art quer durch Zeit und Raum. In diesem Sinne sind politische Theorien selbstverständlich in einen jeweiligen historischen Kontext eingebunden. Was wiederum bedeutet, dass eine jeweilige politische Theorie nicht beliebig interpretiert werden kann. Sie muss vielmehr vor der Folie ihrer jeweiligen historischen Raum-Zeit-Relation gelesen werden. Wenn sie diese dann doch auch transzendiert, indem sie in den Bedeutungsmustern ein hermeneutisches Überschusspotential bereithält, welches historische Kontexte und Zeit- und Raumgebundenheit sprengt, dann ergibt sich die Perspektive auf Aussageebenen, die theoretisch universal sein können, folglich auch ahistorisch gelesen werden können.
Politische Ideengeschichte
Ein solches Wechselspiel zwischen historisch immanenten und zugleich auch transzendierenden Interpretamenten von politischer Theorie ist kognitiv nicht leicht zu fassen. Die hierbei entstehenden Schwierigkeiten begründen sich im Wesentlichen schon durch das Verständnis dessen, was Geschichte überhaupt ist und an Aussagen bereitstellen kann. Die oft für die Ebene der politischen Ideengeschichte bemühte Formel von der Dialektik zwischen Idee und historischer Wirklichkeit ist genau genommen noch weitaus dialektischer anzusehen. Denn es geht nicht einfach nur um die Ambivalenz von Idee und Wirklichkeit, die man mittels einer Umfeldanalyse der maßgeblichen sozial-ökonomischen oder kulturpolitischen Faktoren meint aufzeigen zu können, wie etwa in der Konzeption von Fetscher und Münkler in Pipers Handbuch der politischen Ideen (vgl. Fetscher/Münkler 1985). Auch wäre es sicherlich nicht ausreichend, lediglich zu vermuten, dass Theorien über das Wesen der Politik irgendwie auch praktische Relevanz für die konkrete Politik haben (so Sabine 1971). Offenkundig ist das so, aber warum? – Warum sind Begriffe der politischen Theorie tatsächlich mehr als nur Instrumente des Denkens, was macht sie zu Produkten der Problembearbeitung von jeweils historisch fundamentalen Konflikten? – Warum ist ein systematisches Denken über Politik nicht nur die bloße Subsumtion der Wirklichkeit unter neuen oder alten Begriffen, sondern durchaus auch deren evolutionären Aufbrechung und Vorantreiben auf Veränderung hin?
Problem der (historischen) Wirklichkeit
Die logische Antwort, die hierauf zu geben ist, hängt im Wesentlichen vom Verständnis dessen ab, was wir überhaupt als je historische Wirklichkeit zu begreifen in der Lage sind. Genaugenommen ist es nämlich die Frage nach dem Verständnis von Geschichte selbst. Ist das, was uns geschichtlich begegnet, die je historisch formulierte Wirklichkeit oder ist dies vielmehr nur eine unter bestimmten Gesichtspunkten ausgesuchte – und solchermaßen immer schon strukturierte Wirklichkeit?
Historische Hermeneutik und ihre Idealisierung
Geht man vom Letzteren aus, dann ist Geschichte im Wesentlichen ein Konstrukt, welches sehr stark abhängt von der Phantasie des Jeweiligen, der da die Quellen (= Texte) überhaupt befragt. Die Konstruktion besteht allein schon darin, dass sie in einer Sprache die Aussagen der Quellen wiedergeben muss, die ihrerseits bestimmte (historisch kontingente) Voraus-Setzungen nötig hat, um überhaupt rekonstruieren zu können, was da eigentlich gewesen sein soll. Die scheinbaren Fakten sind so gesehen keine richtigen Fakten, sondern nur Artefakte im Bereich einer unendlichen Vielzahl von denkbaren Variationsformen des jeweiligen Themas. Zum Faktum wird etwas erst durch die Art der Perzeption, in der man etwas aus den Quellen heraus liest. Was unverständlich ist bzw. gar nicht gelesen (oder auch: symbolisch gesehen) werden kann, hat so gesehen auch keine Realität. Das heißt, die Realität wird erst durch eine Deutung erschlossen. Eine jede Deutung wiederum bedingt eine jeweils ideale Voreingenommenheit in Bezug auf das, was man überhaupt zur Kenntnis nehmen will. Im Bereich der vorgefassten idealen Einschätzung gibt es selbstverständlich nicht nur eine, sondern immer mehrere Möglichkeiten. Das Entscheidende hieran aber ist, dass nicht jede Variation zum Thema stimmig ist. Das heißt, man kann nicht beliebigen Unsinn für sinnig erklären. Aus der politischen Theorie des Karl Marx kann man beim besten Willen keine Mars-Geschichte machen. Umgekehrt gilt aber auch, dass der positivistischste Bezug auf die sogenannten Fakten, den man sich überhaupt denken könnte, noch erst recht keine bessere Form von Wahrheit ergibt. Das Konstruieren ist nötig aufgrund der Paradoxie, dass die historischen Welten, die mittels der Quellenlektüre erforscht werden, nur durch die Sprachperspektive ihres Mediums, des Historikers, sprechen (vgl. auch Pocock 1987). Hierbei ist das Medium Rezipient wie Generator ein- und desgleichen Vorgangs – nämlich der Konstruktion von Geschichte. Eine Geschichte per se gibt es daher nicht – obwohl es die Vergangenheit gibt. Aber welche Geschichten die Vergangenheit birgt – und welche überhaupt mitgeteilt werden –, ist eine Frage der Konstruktion.
Kontra Cambridge-School
Insofern versteht sich der hier vorgelegte diskursanalytische Ansatz als eine klare Abgrenzung zur kontextualisierenden Lehre der so genannten Cambridge School (vgl. hier u.a. Skinner 1969 u. Pocock 1972). Denn trotz aller hermeneutischen Verbesserungsmöglichkeiten durch die Rekonstruktion von historischen Kontexten, sei es im Verständnis von Rhetorik, politischer Polemik in Pamphleten oder auch durch Bildbetrachtungen (vgl. als Beispiele Skinner 1996 oder Bredekamp 2003), bleibt die Analyse der Aussageebenen von politischer Theorie immer noch eine Konstruktion – nur eben sehr viel anspruchsvoller. Sie setzt die Konstruktion von Geschichte voraus – und abstrahiert zugleich von dieser. Somit ist die politische Theorie gegenüber der Konstruktion des rein historischen Erzählens nicht nur wirklichkeitsimmanent gemessen an dem, was die historischen Texte aussagen, sondern mehr noch auch transzendent im Hinblick auf ihre jeweilige Bedeutung. Diese kann differieren nach Raum und Zeit, somit auch ahistorisch gelesen werden. Und das ist eigentlich das Interessanteste an der politischen Theorie: ihre zeitsprengende Unabhängigkeit für bestimmte Theoreme.
Der Diskursansatz
Das bedeutet: es gibt so etwas wie eine Wahrheitsfrage in der Auseinandersetzung mit politischer Theorie. Allerdings – und das ist das ebenso Problematische wie Reizvolle – lässt sich diese Wahrheitsfrage nie vollständig, sondern nur relativ erschließen. Es existieren in der Analyse von politischer Theorie somit keine abschließenden, unumstößlichen Gewissheiten, wohl aber eine Menge sinnvoller Aussagen über menschliche Wirklichkeit im Bereich des Politischen. Wenn die Aussage 1 + 1 = 2 logischerweise gültig ist, dann bleibt Mord auch dann ein Mord, wenn die Tat uns als Notwendigkeit verkauft wird. Das Beispiel demonstriert aber auch, dass die Stimmigkeit der Aussagen in der Interpretation nicht zuletzt von bestimmten Vorannahmen abhängig ist, die selbst wiederum auf Prämissen basieren, deren Endgültigkeit man unter der Berücksichtigung konträrer oder alternativer Prämissen durchaus in Frage stellen kann. Die jeweilige Entscheidung, um welche Prämissen es sinnvoller gehen könnte oder sollte, ist selbst schon ein konstruktiver Akt. Und hängt nicht unwesentlich davon ab, wie die Konstruktion des Prozesses ausfällt, in dem sich der Diskurs bewegt. Natürlich ist die Geschichte eines bestimmten Diskurses von politischer Idee von der Form her textual. Aber dies wiederum schon als das Gegebene aufzufassen, käme einer Banalisierung des Banalen gleich. Die historischen wie ontologischen Statusaussagen in ihrem jeweiligen Bedeutungskontext sind es, die bei der Dechiffrierung von Texten der politischen Ideengeschichte das eigentlich Interessante ausmachen. Hierin unterscheidet sich der politiktheoretische Ansatz in der Analyse auch von dem des Historikers der politischen Ideen. Der Historiker liest lediglich die historische Sprache (vgl. Pocock 1987: 27), er reformuliert sie nicht im neuen, jeweils aktuellen Kontext zeittranszendent. Jedenfalls versucht der historische Ansatz dies stets bewusst zu vermeiden. Insofern setzt sich der vorliegende politikwissenschaftliche Erkenntnisansatz von vornherein von der hermeneutischen Differenz, die der Historiker meint gegenüber seinen Texten aufbringen zu können, ab. Sprachsymbolische Referenzen bleiben zweifellos, sind aber der sachontologischen Ebene untergeordnet. Diese zielt auf Aussagen in der Legitimationsebene von politischer Ordnung – unabhängig von Zeit und Raum. Welche Referenzkriterien werden hierfür gemacht, mit welchen historisch kontingenten Attributen und mit welchen ontologisch-immanenten Kriterien?
Bei der Beantwortung dieser Fragestellung kann man sich von den einschlägigen Perspektiven der historischen Diskursanalyse im Bereich der politischen Ideengeschichte leiten lassen. Das impliziert als Ausgangspunkt die Annahme, dass jede politische Gemeinschaft über ein strukturell spezifisches und an sich stabiles Vokabular des Politischen verfügt. Dieses Vokabular verändert sich allerdings in Zeiten einer enormen sozialen wie normativen Destabilisierung der bestehenden Ordnung (vgl. u.a. Ball 1988 u. Hunter 2007). Die dann einsetzenden z. T. sehr eklatanten Bedeutungstransformationen im Verständnis auf das Politische lassen sich mit dem Aufkommen neuer (oder mitunter auch alter) Diskurse festmachen. Die Delegitimierung des Bestehenden bei gleichzeitiger Einführung eines neuen Paradigmas von Politik ist somit ein beherrschendes Prinzip für Diskurse in der politischen Theorie.
Die Aussageebenen
Um nun einen Diskurs angemessen zu verstehen, ist es nicht nur notwendig, sich den jeweiligen historischen Kontext zu erschließen, sondern mehr noch auf die Bedeutungsdifferenzen innerhalb der Theoreme zu achten, die da diskursiv verhandelt werden. Schließlich und endlich geht es vor allem um die Implikationen, die ein Diskurs über Politik beinhaltet – und zwar auch jenseits des historischen Horizontes. Wir können ohnehin den ganzen Deutungshorizont, in dem sich ein Autor wie Hobbes oder Leibniz historisch bewegt hat, heuristisch nicht mehr überblicken. Alles, was wir hierzu festlegen, sind hermeneutische Rekonstruktionen. Ob z.B. Hobbes oder Leibniz gesehen haben, welches Theorem in welcher Weise seine Wirkung im Diskurs entfalten wird, ist eigentlich irrelevant. Wichtiger ist, dass sie überhaupt ein bestimmtes Theorem oder Axiom neu in die Theorie eingeführt haben. Das heißt, gerade die hermeneutische Überschussfunktion, die ein neu entwickeltes Theorem in einem bestimmten Diskurs hat, ist zeit- und raumtranszendierend. Insofern kann der historisch-kontextualisierende Interpretationsstandpunkt nur einer unter mehreren analytischen Aspekten sein. Jegliche Priorisierung eines historischen Ansatzes würde sonst zwangsläufig zu einem Historismus führen und damit nur eine untergeordnete Erkenntnisebene der politischen Theorie dokumentieren. Gerade in Bezug auf die prämodernen Autoren, um die es hier geht, wäre dies ein hermeneutischer Missgriff, argumentieren sie in der Mehrzahl eben nicht strikt historisch, sondern vielmehr ontologisch. Das heißt, man muss drei Aussagebenen in der Rekonstruktion der Diskurse zur politischen Theorie der Prämoderne (wie überhaupt ganz grundsätzlich in der politischen Theorie) unterscheiden:
1 die textuale Aussage selbst, die historisch fixiert ist,
2 die Bedeutung, die diese Aussage beinhaltet, die nicht mehr nur historisch, sondern bereits transzendierend sein kann,
3 die Wirkung der Bedeutung von der Aussage, die transzendent ist.
Spielt man diese drei hermeneutischen Varianten am textualen Material durch, dann ergibt sich ein dialektisches Bild, was gerade der Diskursrekonstruktion zugute kommt. Man darf sich allerdings dabei nichts vormachen: der so dechiffrierte Diskurs ist und bleibt eine Konstruktion. Ob die Zeitgenossen der Prämoderne ihn tatsächlich so gelesen haben, entzieht sich der absoluten Bestimmung. Offenkundig gibt es so etwas wie einen utopischen Diskurs in der Prämoderne oder einen machiavellistischen. Doch dies ist schon zwischen 1500 und 1800 eine Konstruktion gewesen. Man darf sich also bei der hier angestrebten Dialektik zwischen den drei hermeneutischen Ebenen nicht einbilden, dass man damit den jeweiligen Denker besser verstehen würde als dieser sich selbst. Wer weiß schon, wie sich ein Kant verstanden hat oder ein Machiavelli? Die Konstruktion von Identität (vgl. auch Bevir 1997: 231), die die beiden genannten Autoren von sich und ihren Texten formuliert haben, kann vielleicht unter dem Gesichtspunkt der Jetztzeit auch etwas anders gesehen werden – nur eben nicht beliebig. Das Phänomen der Relativität von Theoremen innerhalb und außerhalb eines bestimmten Diskurses führt so gesehen zur wichtigsten Frage der politischen Theorie überhaupt: Mit welcher Logik wird die Legitimation von politischer Ordnung betrieben? – Was sind die Begründungsprämissen?
Die Angemessenheit der Erklärungen
Die Frage nach den Begründungsprämissen ist die Wahrheitsfrage. Mit welcher Wahrheit wird operiert zugunsten welcher politischen Ordnung? Nicht jeder politische Diskurs formuliert und verträgt den gleichen Wahrheitsanspruch. Genau genommen unterscheiden sich Diskurse zur politischen Theorie gerade darin radikal. Insofern ist es auch logisch und geradezu natürlich, dass es bei Diskursen über politische Theorie Paradigmenwechsel gibt. Nicht jeder Diskurs ist zeit- und raumunabhängig, manche verschwinden so schnell wieder, wie sie gekommen sind. Allerdings gibt es auch Diskurse, die in ihren wesentlichen Wahrheitsansprüchen eine wenn auch nicht immer lineare, so doch nachhaltige Wirkung entfalten. Grundsatzfragen zur Monarchie, zur Aristokratie, zur Tyrannis oder auch zur Demokratie werden zwar nicht zu allen Zeiten, aber in vielen Jahrhunderten doch mit beachtlicher Konsistenz gestellt. Das trifft vor allem auf die prämodernen Diskurse zur politischen Theorie zu. Sie formulieren aber auch, wie das bei wissenschaftlich betriebenen Aussagen zur menschlichen Wirklichkeit notwendig ist, nicht nur die eine Wahrheit, sondern mehrere Wahrheiten von ein und der gleichen Sache. Allerdings ist das kein relativer Erkenntnisvorgang, sondern es geht dabei immer um ein Weniger oder Mehr im Hinblick auf die Angemessenheit der Erklärungen. Die Perspektive auf die Angemessenheit ist aber keine Perspektive, die man einfach mit einem Wechselspiel von Idee und Wirklichkeit, Theorie und Praxis kompensieren kann. Das heißt, es bleibt eine hermeneutische Überschussfunktion bei manchen Theoremen bestehen. Gerade deswegen transzendieren sie dann auch eine theoretische Aussage von Zeit und Raum. Gleiches gilt für die Bedeutungsebenen zwischen zwei unterschiedlichen Diskursen. Ihre jeweiligen Wahrheitsansprüche können inkommensurabel sein, das heißt sie alternieren nicht miteinander. Eine Verkehrssprache zwischen den Diskursen findet dann nicht statt. Diese systemisch produzierte Inkommensurabilität führt oft in Zeiten des fundamentalen sozialen Umbruchs zur Kreierung neuer Begrifflichkeiten, um ein neues Paradigma sachgerecht anzeigen zu können – auch wenn es dieses Paradigma in der bestehenden Wirklichkeit so noch nicht gibt. Thomas S. Kuhn hat dieses konstruktivistische Muster in Diskursen folgendermaßen veranschaulicht (Kuhn 1995: 42): „Einen neuen Begriff zu formulieren kann einen dazu bringen, eine neue Wortgruppe zu schaffen. Es gibt nämlich Begriffe, die die existierende Sprache nicht assimilieren kann. Etwa können wir eine Katze von einem Hund unterscheiden. Tauchte in der Natur nun ein Tier auf, das man Katzenhund nennen müßte, so bräche der Teil der Sprache zusammen, mit dem wir [diese] Tiere klassifizieren.“
Genau dieses epistemologische Phänomen tritt bei den Theoremen von politischer Wirklichkeit auf. Sie zeigen jeweils Statusaussagen an, die immer auch ideologisch besetzt sind. Das heißt, sie unterliegen selbstreferentiellen Deutungsaspekten, die von der je unterschiedlich besetzten Wahrheitsfrage herrühren. Ändert sich nun in einem Diskurs zu einer bestimmten Aussageform von politischer Theorie – etwa der der Monarchie – ein maßgebliches Theorem, wie das der Legitimation der Herrschaft des Einen durch Gott, dann produziert ein solcher Transmissionsakt in der Verkehrssprache der politischen Theorie enorme Erschütterungen – bereits lange bevor faktisch der erste Monarch deswegen wohlmöglich seinen Kopf verliert. In der Zwischenzeit, vom ersten Auftauchen einer neuartigen Bewertung des traditionellen Theorems bis hin zum faktischen Ereignis, bricht zwar nicht gleich die Sprache zusammen, aber es herrscht doch produktive Verwirrung im Diskurs bei der Frage der Angemessenheit der Klassifikation vor. Genau dieser Vorgang der epistemologischen Unschärfen, die ein jeweiliger Diskurs bekommt, ist für die Veränderung und damit für die Progression von politischer Theorie überhaupt substantiell. Im Übrigen mag auch die faktische Enthauptung eines Monarchen noch keineswegs die Theorie der Monarchie erschüttern. Da die Referenzkriterien ambivalent bleiben, kann mit einer solchen politischen Tat die Legitimation der Monarchie wohlmöglich auch erhärtet werden.
Ambivalenzen und retardierende Dechiffrierungen dieser Art weist jeder Diskurs auf. Somit veranschaulicht gerade die Diskursanalyse von politischer Theorie, dass es keineswegs eine lineare Entwicklung von Theoremen gibt, erst recht nicht in der Prämoderne, sondern vielmehr einen dialektischen, bis weilen auch dezidiert antagonistischen Prozess im Disput über die maßgeblichen politischen Theoreme, die allesamt in der Wahrheitsfrage münden, damit aber nicht nur z. T. inkommensurabel wirken, sondern vielmehr auch eine antinomische Ergebnisstruktur produzieren. Die politische Theorie der Prämoderne ist daher grundsätzlich nicht nur synthetisierend in ihren Basistheoremen, sondern auch im zeitlichen Verlauf der maßgebenden Diskurse zunehmend inkongruent und antinomischer Art.