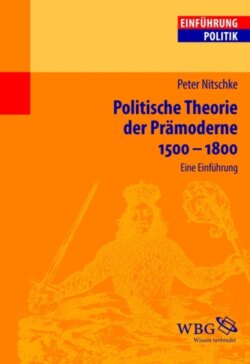Читать книгу Politische Theorie der Prämoderne 1500-1800 - Peter Nitschke - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Gottfried Wilhelm Leibniz und der wahrhaft christliche Regent
ОглавлениеNeoaristotelismus in der Politischen Theorie
Das Programm der Politica Christiana hat schließlich im 17. Jahrhundert eine sehr starke Ausdifferenzierung in alle möglichen Einzelaspekte der politischen Führung, der Legitimation von politischer Ordnung und der praktischen Gestaltung von Politik erfahren. Zentral bleibt bei allen Überlegungen die Rückbindung an die Aristotelischen Maximen, demzufolge die politische Ordnung eine Ordnung sui generis ist, die als solche aber auch nicht künstlich erscheint, sondern ontologisch als ein Gegebenes immer schon vorhanden ist. Auf der Grundlage des christlichen Naturrechts bezieht die politische Ordnung der Menschenwelt ihre wesentlichen Antriebsfunktionen aus der Kenntnis und Befolgung des biblischen Dekalogs. Die Orientierung an Gottes Gebote beinhaltet nun aber keineswegs eine rein formale Sicht auf die politische Gestaltungswelt, sondern bezieht vielmehr ganz wesentliche Motive aus der Praxis für eine Theorie von der Politik mit ein. Nirgends wird das vielleicht so deutlich, wie bei den deutschen Autoren des Barockzeitalters, die wie Dietrich Reinkingk (1590–1664) oder Veit Ludwig von Seckendorff (1626–92) das Konzept einer christlichen Politik dezidiert für die Alltagsbelange politischer Verwaltungspraxis umsetzen (vgl. Nitschke 1995: 196ff.).
Zweifellos brillant wie kein zweiter in Europa hat das Konzept der christlichen Politik in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) vertreten. Spätestens in seinen Schriften zeigt sich dann, dass sich der gläubige Christ im Bereich der Politik keineswegs nur mit passiver Kontemplation zufrieden geben darf. Allen Idealisierungen zum Trotz ist der wahre Christ ein wehrhafter Zeitgenosse und muss sich der moralischen Dimensionen seines politischen Handelns deutlich bewusst sein (vgl. auch Redding 2009: 25ff.). Wie Leibniz an Seckendorff in einem Schreiben formuliert hat (Leibniz 1992: 10): „Wenn wir wahrhaft Christen sein wollen, müssen wir sicherlich nicht nur in der Kirche, sondern auch im Rathaus, auf dem Markt und auf dem Schlachtfeld Christen sein.“
Christen als die wahren Politiker
Auch im Rathaus wohlgemerkt ist der Platz des wahrhaften Christen. Die Dinge der Politik sind nichts, was man allein kriminellen Subjekten oder machiavellistischen Politikern überlassen sollte. Es geht demnach um die politische Partizipation des Einzelnen am Gesamten. Leibniz hat diesen geradezu republikanischen Anspruch durch die Zwei-Reiche-Lehre begründet. Das Reich Gottes ist in der Leibnizschen Philosophie nicht als wirkliches Endstück menschlicher Existenz auf Erden zu begreifen, sondern mehr im Sinne einer Analogie zur Lebenswelt. Damit wird deutlich gemacht, dass im Reiche Gottes – wenn es denn einmal so weit ist – alle Menschen gleich sind. Auch der König wäre dann nur noch ein einfacher Mensch!
Faktoren für eine erfolgreiche christliche Herrschaft
Somit muss sich auch der Monarch, eigentlich er sogar an erster Stelle, dem christlichen Naturrecht unterwerfen, das heißt die Regelgrundsätze menschlicher, christlicher Existenz anerkennen und begreifen. Das beinhaltet einen konkreten kognitiven wie auch inhaltlichen Gestaltungsauftrag für den christlichen Regenten. Dieser muss nach Leibniz folgende vier Faktoren stets befolgen (ebd.: 237):
1 den Glauben,
2 das Wohl des Vaterlandes,
3 die Ökonomie,
4 die Verwaltung.
Hält sich der Regent an die Beachtung dieser Faktoren, kann er nach Leibniz davon ausgehen, dass seine Herrschaft nicht nur gesichert, sondern auch von Dauer ist. Unzweideutig versteht der Hannoveraner Universalgelehrte dieses Politikkonzept – wie alle Vertreter der Politica Christiana vor ihm auch – organologisch (ebd.: 238): „Ich pflege die Politiker mit dem Kopf, die Militärs mit dem Herzen, aber die Finanzen mit dem Magen zu vergleichen, dessen schlechte Konstitution ziemlich schnell die Nahrung des ganzen Körpers verdirbt und die Funktionen der edelsten Teile behindert.“
Auffallend ist, wie sehr hier der Bereich des Ökonomischen in den Blick der politischen Theorie gelangt. Das ist aber für deutsche Vertreter der Politica Christiana nicht verwunderlich, sind dies doch – wie Leibniz – allesamt Autoren, die sich der kameralistischen Perspektive zur Erklärung von Staatlichkeit verpflichtet sehen.
Der Gemeine Nutzen
Insofern geht es hier um die Praktikabilität der politischen Ordnung und um die Steigerung ihrer Effizienz. Der gemeine Nutzen wird nunmehr zu einer Zielkategorie, die keineswegs mehr allein normativ gedacht ist, sondern ganz konkret materiale Ursachen und Wirkungen beinhaltet. In verschiedenen Schriften, Projektskizzen wie Memoranden hat Leibniz versucht aufzuzeigen, worin die materialen Auswirkungen politischer Herrschaft zu sehen sind. Ob es sich dabei um Staats-Tafeln für die Regie des Regenten oder um die Aufstellung außenpolitischer Grundsätze für eine territoriale Diplomatie handelt, stets ist der Fürst hier der Adressat der Empfehlungen und Überlegungen. Wenn es um die Frage der Gerechtigkeit geht, dann kann nur ein christlicher Fürst Gottes Gerechtigkeit verstehen und anwenden. Das legt allerdings hohe Maßstäbe an den einzelnen Regenten an.
Das Naturrecht
Der christliche Fürst muss das Naturrecht verstehen, seine eigene Tugend erkennen und beherrschen sowie das Glück auf seiner Seite haben, um die richtigen Gesetze machen zu können (vgl. Leibniz 1989: 85). Wenn die richtige Relation zwischen den positiven Gesetzen, die der Fürst macht, seinem eigenen tugendhaften Vermögen, der Gunst der Stunde und dem Naturrecht gefunden wird, dann ist christliche Herrschaft ebenso effizient wie gerecht. Was Leibniz somit beschreibt, ist nicht einfach nur eine Neuauflage des klassischen Fürstenschemas aus der Fürstenspiegel-Literatur des Mittelalters, sondern er offeriert eine modifizierende Interpretation, in der Fortuna eine wichtige Rolle spielt. Positive Gesetze können demzufolge nicht einfach willkürlich gemacht werden, sie bedürfen stets einer sorgfältigen Analyse und Interpretation auf den Grundlagen des christlichen Naturrechts. Kein Fürst der Erde kann sich dem entziehen. Tut er das doch, dann entbehrt seine Herrschaft jeglicher christlicher Legitimation. Sie ist dann eine Tyrannis und eben keine wahre politische Herrschaft.
Christlicher Republikanismus
In diesem christlich-ontologischen Herrschaftsmodell fungiert die Kategorie der Tugend als zentrales Vehikel für die Handlungschancen des Fürsten. Machiavellis Lehre wird somit christlich gewendet und in einem durchaus republikanischen Sinne für das monarchische Modell der Politica Christiana gewonnen. Das ist deshalb republikanisch zu nennen (vgl. Nitschke 2001), weil Leibniz einräumt, dass der Monarch keineswegs von Geburt an in der Statusfunktion gewesen sein muss. Wie das Beispiel des Scipio Africanus in der Römischen Republik zeigt, kann man auch aufgrund der persönlichen Verdienste um das Vaterland in die Statusfunktion des Fürsten gelangen (vgl. Leibniz 1989: 86). Nicht das Blut macht also das monarchische Amt aus, sondern die persönlichen Leistungen des Amtsträgers!
Angesichts eines solchen Kredos ist Leibniz sehr daran interessiert, das Tableau der Tugenden für den politischen Regenten deutlich zu umreißen. Denn wenn es die Fähigkeiten sind, die einen christlichen Regenten ausmachen, und nicht einfach nur seine Funktion, dann gilt es zu ergründen, was die essentiellen Kategorien für politisch tugendhaftes Handeln sind. In den natürlichen Eigenschaften, dem Adel und der Frage der Erziehung sieht Leibniz die maßgeblichen Fixpunkte, von denen aus sich das Konzept der politischen Tugenden bestimmen lässt. Idealerweise sollte der Fürst einen großen Geist haben, „ein solides Urteil, einen unbezwingbaren Mut, eine herausragende Güte und einen starken Drang nach Tugend und Ruhm“ (ebd.: 87). Da der Esprit hierbei die wesentlichen Vorgaben macht, denn andernfalls kann gar nicht erkannt werden, was jeweils in einer konkreten Situation das Richtige und das Zweckmäßige ist, wird die Frage des wissenschaftlichen Erlernens in der Leibnizschen politischen Philosophie ein zentraler Punkt bei allen Erörterungen. Der Fürst muss stets so proportioniert sein zu den „natürlichen Einstellungen“ des menschlichen Lebens, das er alles möglichst angemessen erfasst (ebd.). Als Ziel definiert Leibniz die Verwirklichung von Gemeinwohl, darüber hinaus den Ruhm und die Zufriedenheit der Menschen als Adressaten fürstlichen Handelns.
Um an dieses Ziel zu gelangen, darf selbst der christliche Fürst zum guten Zweck lügen. Keineswegs ist also die Programmatik der Politica Christiana hier nur normativ. Im Gegenteil: sofern es die Funktionen verlangen, kann, darf und soll auch äußerst zweckgerichtet Politik gemacht werden. Warum „nicht ein Kind oder einen Kranken täuschen um seines Heils willen“, fragt Leibniz entwaffnend (1992: 240). Die Anerkennung taktischer Belange im Rahmen einer Staatsräson ist aber kein Selbstzweck: Nicht Staatsräson um ihrer selbst willen, schon gar nicht zur Rettung der eigenen Person des Regenten, sondern um des Ganzen willen, das heißt der Befolgung von Gottes Geboten in einer irdisch unvollkommenen Welt.
Die Wissenschaft von der Politik
Der Monarch sollte hierbei seine Minister und Untergebenen so in Szene setzen wie Gott alle Lebewesen zu den Dingen und Handlungen bringt, die er allein mit der Gesamtordnung gesetzt hat (vgl. Leibniz 1989: 87). Leibniz analogisiert demnach das Monarchiemodell mit der göttlichen Genesis der Welt. Jedoch ist dies jetzt nur noch eine Analogie: Alle Attribute weltlicher Herrschaft folgen einem selbstgewählten Duktus, hängen nicht mehr von Gott ab. Damit drückt Leibniz die Selbstverpflichtung und die Freiheit politischer Handlungen aus. Der politisch Handelnde muss sich stets bewusst sein, mit welcher naturrechtlichen Verantwortung er seine Handlungen vollzieht. Eben deshalb dringt Leibniz so sehr auf die richtige wissenschaftliche Verständnisweise. Die Wissenschaft von der Politik ist dann neben der Moralwissenschaft und der Geographie der elementare szientistische Kode, mit dem ein Herrscher politisches Handeln überhaupt begreifen kann (vgl. ebd.: 92). Aufgrund der Verwissenschaftlichung des Politikbegriffs handelt der christliche Regent nicht mehr einfach nur zufällig normativ richtig, sondern er muss seine Handlungen und Fähigkeiten systematisch unter Beweis stellen und ständig trainieren.
Das Politische bleibt für den Barockgelehrten aus Hannover jedoch stets nur ein Movens unter anderen Dingen. Als menschliche Seinsweise hat die Politik noch nicht einmal den Anspruch auf die höchste Dignität. Daraus resultiert nicht zuletzt auch eine differentielle Sicht auf Staat und Gesellschaft. Für Leibniz sind Staat und Gesellschaft zu keinem Zeitpunkt deckungsgleich. Die zivile Sphäre ist jeweils etwas anderes (und Natürlicheres) als die staatliche Ebene. Sie ist zwar kompatibel zum Staat, was sie aufgrund des Ordnungsgedankens auch sein muss, aber es existiert zwischen Gesellschaft und Staat keine synonyme Gleichsetzung wie in der Vertragstheorie des Thomas Hobbes.
Hierin zeigt sich die ganz anders gelagerte Argumentationsrichtung der Politica Christiana am deutlichsten. Was Leibniz gegen die Kontraktualisten der Prämoderne grundsätzlich in Erinnerung ruft, ist das klassische Aristotelische Verständnis von politischer Welt: Man ist Mensch und Angehöriger einer Gemeinschaft von Menschen aufgrund eines status. In diesen Status wird man hineingeboren, für den kann man zunächst einmal nichts, aber in dem jeweiligen Status lebt und arbeitet die menschliche Existenz. Und erst aufgrund dieses jeweiligen (bürgerlichen) Status, der in der Leibnizschen Philosophie stets auch eine politische Bedeutung hat, partizipiert das Individuum an der politischen Ordnungswelt. Jeder auf seine Weise, gemessen an der statuellen (ständischen) Souveränität. Das mag je nach Stand eine spezifische Moralität implizieren, aber genau diese gilt es einzubringen in die Politik.
Die begrenzte Monarchie
Das Gemeinwohl besteht somit aus einer Vielzahl von unterschiedlichen sozialen Statuseinheiten und deren Handlungsintentionen, die allesamt vom Monarchen berücksichtigt und bestmöglich integriert werden sollen. Damit löst Leibniz bezeichnenderweise den Bodinschen Souveränitätsbegriff wieder auf. In seiner Auslegung ist politische Souveränität gerade nicht durch Unteilbarkeit gekennzeichnet, sondern durch die Aufteilung von Funktionen. Die Vielheit in der Einheit Gottes, lautet hier das Kredo, was auf ein Konzept von gebundener Monarchie (monarchia limitata) hinaus läuft, in dem sich der Wert des ersten Bürger im Staate daraus ergibt, in welchem Maße er sich an die christlichen Grundsätze hält.