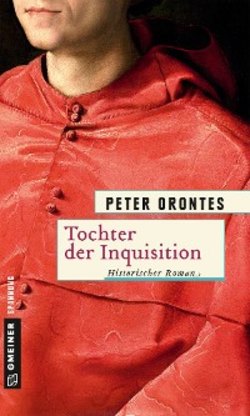Читать книгу Tochter der Inquisition - Peter Orontes - Страница 14
Kapitel 9
ОглавлениеFreitag, 07. August 1388
Der Hof vor dem Gerichtsgebäude zu Steyr war voller Menschen. Es herrschte ein Schubsen, Drängeln, Stoßen und Rempeln, dass einem angst und bange werden konnte. Aus nah und fern war man herbeigeströmt, um bei der Verhandlung dabei sein zu können. Ganze Familien waren zugegen. Einige von ihnen hatten sogar ihre Speisen mitgebracht: Brot, Käse und Dünnbier. Auch Christine war gekommen und versuchte nun, einen guten Platz in den vorderen Reihen zu ergattern, um möglichst nah am Geschehen sein zu können. Das Wetter an diesem Freitag schien für eine solche Veranstaltung geradezu geschaffen zu sein: Der Himmel war blau, und die Sonne strahlte nicht zu allzu heiß. Selten hatte eine Verhandlung vor dem Stadtrichter so viele Zuschauer angezogen. Das war auch kein Wunder, ging es doch um den Mord an Dietrich Pützer, ehemals Schuster zu Garsten. Oder zumindest um das, was einige als Mord bezeichneten. Denn es gab nicht wenige, die den Tod des Pützer lediglich als einen unglücklichen Zufall ansahen.
Und das kam so:
Wie viele andere Mannsbilder aus der Gegend war auch Dietrich Pützer Stammgast im Schwarzen Raben zu Garsten gewesen. Nicht, dass das Gebräu, das man dort genießen konnte, besonders frisch und von herausragendem Geschmack gewesen wäre – es war eher von durchschnittlicher Güte. Nein, was viele der Männer so sehr erfrischte, waren vor allem die Reize der Wirtstochter Luzia, mit denen diese nicht gerade geizte.
Eines Abends war in der Schankstube des Rabenwirts zwischen Dietrich Pützer, dem Schuster, und Jobst Heiss, der in der Nähe von Garsten eine Schmiede betrieb, ein Streit ausgebrochen. Ein Streit darüber, wer von beiden denn nun das Recht habe, dem lieblichen Töchterchen den knackigen Hintern zu tätscheln, wenn es einem den Humpen kredenzte.
Luzia selbst war das völlig gleichgültig; tätscheln konnte sie, wer wollte – Hauptsache, der Pfennig rollte. Aber zwischen Pützer und Heiss führte die Erörterung dieser unglaublich schwierigen Frage zu einer lautstarken Auseinandersetzung, die von Humpen zu Humpen an Intensität zunahm.
Außer den beiden Streithähnen waren an diesem Abend nur noch Peter Seimer und Balduin, der Schweinehirt des Dorfes Ternberg, als Gäste anwesend gewesen.
Als der Rabenwirt die Hitzköpfe beschwichtigen wollte, war es bereits zu spät. Die gewaltigen Mengen an Bier hatten nicht nur ihre Bäuche, sondern auch ihren Verstand geflutet. So war aus dem verbalen Gefecht schnell eine handfeste Rauferei geworden; Jobst und Dietrich droschen wie wild aufeinander ein.
Peter Seimer, der nahe Wolfern einen großen Hof bewirtschaftete, hatte sich schon bei Beginn der Auseinandersetzung mit seinem Krug in die hinterste Ecke der Wirtsstube verzogen. Er hatte die Schankstube des Rabenwirts nicht wegen dessen Töchterchen aufgesucht, sondern weil er an diesem Abend im Raben zu nächtigen gedachte und die Heimreise erst bei Tageslicht fortsetzen wollte. Peter galt als ruhig und besonnen und als jemand, der dem Streit aus dem Weg ging. Längst schon hätte er die Kneipe verlassen, hätten die Hitzköpfe ihre Debatte mit Fäusten und Worten nicht in unmittelbarer Nähe der Türe ausgetragen.
Balduin der Schweinehirt dagegen hatte an der Prügelei seine wahre Freude. Sie brachte Kurzweil in sein erbärmliches Leben; einmal Jobst, ein andermal Dietrich anfeuernd, klatschte er begeistert in die Hände, wenn ein gut gesetzter Hieb dem anderen folgte.
Jakob, dem Wirt, war schnell klar geworden, dass er allein die beiden Streithähne nicht zur Vernunft bringen konnte. Also hatte er seine Kneipe durch eine Hintertür verlassen, um nachbarliche Hilfe einzuholen. Luzia war schon vorher in ihre Kammer geflüchtet.
Die Schlägerei eskalierte währenddessen weiter. Beide hatten nun begonnen, mit Gegenständen aufeinander einzuschlagen. Ein Tisch, zwei Stühle und einige Tonkrüge waren bereits zu Bruch gegangen, als Jobst plötzlich ein Messer gezückt und blitzschnell auf Dietrich eingestochen hatte. Wie vom Blitz getroffen, war dieser daraufhin in die Knie gegangen und dann, vornüber kippend, leise röchelnd liegen geblieben.
In dem Moment, da der Pützer zu Boden ging und vor sich hinröchelte, schien bei Jobst Heiss plötzlich wieder der Verstand einzusetzen. Bestürzt sah er auf seinen Widersacher herunter, dem das Blut aus der Seite quoll; es hatte ihn in der Nierengegend erwischt.
Gehetzt blickte Jobst um sich. Panischen Blickes musterte er die beiden anderen Gäste, die ihn entsetzt anstarrten. Mit einem Mal sprang er zum Tresen. Er griff sich ein Messer, das dort lag, sprang zu dem sich am Boden krümmenden Dietrich zurück, beugte sich zu dem Schwerverletzten hinunter, packte dessen Rechte und drückte ihm das Messer in die Hand.
Dann rannte er wie von Furien gehetzt durch die offenstehende Tür in die laue Nacht hinaus.
Balduin der Schweinehirt sah blöde drein. Peter Seimer hatte zunächst nur ungläubig zugesehen, unfähig einzugreifen. Dann aber war er zu dem Verletzten gestürzt, hatte ihm das Hemd vom Leib gefetzt, es zu einem Ballen geformt und diesen auf die Wunde gepresst, um das Blut zum Stillstand zu bringen.
Irgendwann war der Wirt mit einigen Nachbarn, die er in aller Eile zusammengetrommelt hatte, in die Kneipe gestürmt. Einer von ihnen war der Dorfbader von Garsten, ein geschickter Bursche, der, was die Wundbehandlung anging, recht erfahren war. Er nahm sich sofort des Verletzten an und sorgte dafür, dass er auf einem Karren in die Obhut der klösterlichen Krankenstube gebracht wurde. Dort hatte Bruder Adalbert ihn weiterbehandelt. Von Anfang an war jedoch klar gewesen, dass der Schuster – wenn überhaupt – nur mit Hilfe sämtlicher Heiliger hätte gerettet werden können. Ob die allerdings willens sein würden, sich eines Saufboldes anzunehmen, der für seine derben Flüche berüchtigt war, blieb abzuwarten. Doch wider Erwarten sah es anfänglich tatsächlich danach aus. Der Pützer hatte eine starke Natur. Zuerst schien es, als ob er sich erholen würde. Dann aber, etwa vier Wochen waren seit dem Streit im Schwarzen Raben vergangen, verschlechterte sich sein Zustand zusehends. Er bekam hohes Fieber und starb.
Das war schlecht für Jobst Heiss, der im Schergenhaus zu Steyr auf seinen Prozess wartete. Seine überstürzte Flucht hatte ihm nichts genützt; man hatte ihn schnell eingefangen und auf Anordnung des Stadtrichters festgesetzt. Er sollte sich vor Gericht für die derbe Schlägerei und für den Schaden, der dem Wirt dadurch entstanden war, verantworten. Zusammen mit Dietrich Pützer, sobald dieser wieder genesen wäre. Nun aber war der Pützer tot und Jobst nach Meinung vieler – allen voran die Witwe Dietrichs – zum Mörder geworden. Andere dagegen – und von denen gab es eine ganze Menge, denn Jobst verfügte über eine große Anzahl Freunde – vertraten die Ansicht, Jobst sei kein Mörder, denn der Pützer sei schließlich am Fieber verstorben und nicht an dem Stich, der ihm verpasst worden sei. Außerdem glaubten sie der Aussage Jobsts, dass Dietrich als Erster das Messer gezogen habe. Jobst sei schließlich nichts anderes übrig geblieben, als sich mit ebenbürtigen Mitteln zu verteidigen, argumentierten sie.
Dem allerdings widersprach die Aussage Peter Seimers und Balduins des Schweinehirten. Beide waren von Stadtrichter Georg von Panhalm bereits als Zeugen vernommen worden. Heute nun sollten sie ihre Aussagen vor den Ohren der versammelten Öffentlichkeit wiederholen und mittels des Eides bestätigen. Auch der Rabenwirt und seine Tochter sollten noch einmal gehört werden. Besonders dem Auftritt Balduins sahen viele mit großer Erwartung entgegen; der tölpelhafte Schweinehirt würde bestimmt für einige vergnügliche Augenblicke sorgen. Darüber hinaus war bekannt geworden, dass die zwölf Genannten, die dem Stadtrichter beim Urteilen zur Seite stehen sollten, – wobei die Hälfte aus dem Stande des Angeklagten, die andere Hälfte aus den Nachbarn desselben gewählt worden war – sich über Schuld oder Unschuld des Angeklagten alles andere als einig waren.
Alles in allem versprach die Gerichtsverhandlung also eine spannende und kurzweilige Sache zu werden, die ein wenig Abwechslung in den tristen Alltag brachte.
»Dort kommen sie.«
Der schrille Ruf der Praitenbergerin schallte über den Platz und lenkte die Blicke der versammelten Menge auf die Prozession, die, durch die Enge Gasse kommend, auf den Hof vor dem Stadtrichterhaus zuschritt. Allen voran Stadtrichter Georg von Panhalm und Ludwig der Neudlinger, Bannrichter zu Enns. Ihnen folgten die eigens für die Verhandlung vom Stadtrichter ausgewählten zwölf Genannten, des Weiteren zwei Mitglieder des Rates sowie der Gerichtsschreiber und mehrere Büttel, die als Gerichtsdiener fungierten, dann die Zeugen Peter Seimer, der Wirt Jakob Rabener, seine Tochter Lucia und schließlich Balduin Lechner, der Schweinehirt. Den Schluss bildeten zwei bewaffnete Schergen, die den an den Händen gefesselten Jobst Heiss in ihrer Mitte führten.
Die Prozession hatte die Treppe vor dem Gebäude erreicht, die zu der unmittelbar neben der Fassade errichteten überdachten Gerichtslaube hinaufführte. Zuerst schritten die wichtigsten Angehörigen des Gerichtes die Stufen empor, um auf den Bänken Platz zu nehmen, die sich an der Längsseite eines langgestreckten Tisches reihten: in der Mitte Georg von Panhalm, den Richterstab in den Händen; neben ihm Bannrichter Ludwig der Neudlinger, rechts und links flankiert von jeweils einem Mitglied des Rates. An einer der kurzen Seiten des Tisches hatte der Gerichtsschreiber Platz genommen und breitete bedächtig die Untensilien seines Standes vor sich aus: Blätter und Rollen aus Pergament, Federkiele, Tinte und Siegelwachs.
Jetzt erst erklommen auch der Angeklagte Jobst Heiss und seine beiden Bewacher sowie die zwölf Genannten die Stufen, um vor dem Tisch, an dem das Gericht Platz genommen hatte, stehen zu bleiben. Die Zeugen warteten, bewacht von einigen Bütteln, unten am Fuß der Treppe darauf, aufgerufen zu werden.
Georg von Panhalm – in der Linken den Richterstab und in der Rechten einen Holzhammer – blickte gewichtig in die versammelte Menge. Dabei war er sich weniger der Würde des Amtes bewusst, das er heute innehatte, sondern vor allem der Wichtigkeit seiner Person. Es kam nicht oft vor, dass er in Gegenwart des Bannrichters eine Verhandlung zu leiten hatte.
Mit dem Holzhammer klopfte der Stadtrichter dreimal kräftig auf die Tischplatte.
»Hiermit gibt das Gericht der Klage gegen Jobst Heiss statt«, eröffnete er die Verhandlung, und fuhr fort: »Er wird beschuldigt, den Tod von Dietrich Pützer verursacht zu haben. Ich fordere alle Anwesenden auf, während des Verfahrens Ruhe und Ordnung zu wahren.« Dann wandte er sich an den Gerichtsschreiber. »Gerichtsschreiber, lest die Klageschrift vor.«
Der Aufgeforderte erhob sich. Er räusperte sich, entrollte ein Pergament und brachte mit lauter Stimme den genauen Ablauf des verhängnisvollen Abends der aufmerksam lauschenden Zuhörerschaft zur Kenntnis. Anschließend verlas er die Namen der zwölf Genannten und schloss mit der Aufforderung: »Ehrwürdiger Herr Stadtrichter, waltet Eures Amtes.«
Spätestens als der Schreiber begonnen hatte, die Klageschrift vorzulesen, war Ruhe auf dem Platz vor der Laube eingekehrt. Als er die Stelle verlas, in der erwähnt wurde, wie der Beschuldigte dem am Boden liegenden Opfer nachträglich ein Messer in die Hand gedrückt hatte, war ein empörtes Raunen durch die Menge gegangen. Es war schließlich jedermann klar, aus welchem Grund Jobst Heiss das getan hatte. Jobst spürte, wie sich die Stimmung gegen ihn zu richten begann. Es lief ihm kalt den Rücken hinunter.
Georg von Panhalm wandte sich zunächst an ihn. »Ihr seid Jobst Heiss?«, fragte er formell.
Jobst nickte nur. Er brachte keinen Ton hervor.
»Ihr habt gehört, was Euch zur Last gelegt wird. Was habt Ihr dazu zu sagen?«
Jobst schwieg. Zerknirscht und furchterfüllt blickte er zu Boden.
»Nun, was ist, Jobst Heiss?«, fragte von Panhalm ungeduldig. »Habt Ihr denn nichts zu Eurer Verteidigung vorzubringen?«
Jobst hob den Kopf. »Doch, Herr Stadtrichter. Es war ein dummer Streit. Es tut mir leid. Aber er hat damit angefangen«, Jobsts Stimme verriet zwar eine gehörige Portion Furcht, doch es lag auch ein gewisser Trotz darin.
»Wer, ›er‹?«, fragte der Richter. Obwohl er natürlich wusste, wer gemeint war.
»Na, der Dietrich.«
»Ihr meint: Dietrich Pützer? Er hat also den Streit begonnen? Um was ging es denn dabei?«
Jobst trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. »Na ja – das lässt sich … schlecht sagen. Es ging um … es ging um … Jungfer Luzia.«
Aus den Reihen der Zuschauer klang verhaltenes Lachen herauf.
Panhalm blickte streng in die Menge hinunter, bevor er sich wieder an Jobst wandte. »Aha, es ging um Jungfer Luzia. Ihr meint die Tochter des Wirts, Jakob Rabener? Sie war der Grund Eurer Auseinandersetzung? Inwiefern?«
»Nun …«, wieder zögerte Jobst mit der Antwort. »Es ging … es ging eigentlich nur um ihren … um ihren Hintern.«
Jetzt lachte die Menge aus vollem Hals. Sogar in der Miene des Stadtrichters zuckte es verdächtig.
Doch er hatte sich gleich wieder in der Gewalt. »Könntet Ihr das etwas näher erklären?«
»Luzie – äh, ich meine Jungfer Luzia – ich mag sie eben. Und sie mich auch, glaube ich. Und immer, wenn sie dem Dietrich seinen Humpen brachte, … klopfte er ihr … klopfte er ihr auf den Hintern, einfach so. Und das hat mir … hat mir eben … nicht gefallen. Und da habe ich ihm gesagt, er soll … er soll … das bleiben lassen. Aber er sagte, das ginge mich nichts an. Er sagte auch, er habe die gleichen … die gleichen Rechte wie ich … Und da bin ich eben einfach fuchsteufelswild geworden, und dann gab ein Wort das andere, … und dann … und dann…«, Jobst wusste nicht mehr weiter und blickte hilfesuchend in die Runde.
»Und dann sprachen Eure Fäuste«, vervollständigte der Stadtrichter den angefangenen Satz.
Wieder lachten die Zuschauer.
»Ja, ja, … genauso war es. Aber es wäre alles nicht geschehen, … wenn wir nicht … wir waren … wir hatten ja auch …«, abermals suchte Jobst nach Worten, ohne die richtigen zu finden.
Erneut kam ihm der Stadtrichter zu Hilfe. »Ihr meint wohl, Ihr hattet so etwas wie einen Rausch?«
»Richtig, Herr Stadtrichter, Ihr sagt es. Das viele Bier. Wir … wir hätten etwas weniger davon kosten sollen.«
»Hattet Ihr eben ›kosten‹ gesagt? Ich nenne das ›saufen‹«, gab der Stadtrichter trocken zurück.
Der Gerichtsschreiber ergriff das Wort. »Soll ich diesen Euren Satz in das Protokoll mit aufnehmen?«, fragte er gewichtig.
»Natürlich nicht, Ihr Narr«, antwortete Panhalm.
Die Zuhörer amüsierten sich köstlich. Die Verhandlung schien ganz nach ihrem Geschmack zu laufen. Nicht wenige begannen, flachsige Kommentare von sich zu geben.
Energisch klopfte Panhalm mit seinem Hammer auf den Tisch. »Ich bitte mir Ruhe aus. Und ein wenig mehr Respekt«, polterte er los.
Dann wandte er sich wieder an Heiss. »Wie kamt Ihr eigentlich dazu, plötzlich auf den Pützer einzustechen?«
Jobst hatte diese Frage erwartet. So unbeholfen, wie er bis jetzt gesprochen hatte, so überlegt und bewusst setzte er nun zur Antwort an. Er wusste, dass er in diesem Augenblick absolut glaubwürdig wirken musste; sein Leben hing davon ab.
»Ich hätte niemals mein Messer gezogen. Er hat es zuerst getan. Ich musste mich gebührlich verteidigen. Ich zog mein Messer in Notwehr«, sagte er mit fester Stimme.
Peter Seimer, der zusammen mit den anderen Zeugen auf dem Podest stand und bis jetzt aufmerksam der Verhandlung gefolgt war, zuckte ob dieser groben Lüge zusammen. Balduin den Schweinehirten schien die Antwort Jobsts gleichgültig zu lassen; er schwankte wie ein Ast im Wind. Die Bierfahne, die vor ihm herwehte, ließ den Schluss zu, dass ihm die Tragweite dieser Aussage verborgen blieb.
»Ihr behauptet also tatsächlich, dass der Pützer zuerst das Messer zog?«, vergewisserte sich der Stadtrichter. »Ihr wisst, dass Ihr darauf den Schwur zu leisten habt!«, fügte er mahnend hinzu.
Jobst Heiss wusste dies. Doch was nützte es ihm, wahrheitsgemäß zu antworten, wenn ihn dies den Kopf kostete? Andererseits war ihm klar, dass seine Darstellung der Dinge in direktem Widerspruch zu der Aussage der beiden Zeugen stand. Was Balduin den Schweinehirten anging, brauchte er sich da keine allzu großen Sorgen zu machen. Denn dass Balduin als Zeuge so viel wert war wie ein durchlöchertes Wams bei heftigem Regen, wusste schließlich jeder. Die Glaubwürdigkeit Peter Seimers zu erschüttern, würde dagegen weitaus schwieriger sein. Dennoch – er musste es versuchen, es ging ums Überleben.
»Ich weiß sehr wohl, dass Ihr mich vereidigen werdet, Herr Stadtrichter. Doch ich bleibe dabei – der Pützer zog das Messer als Erster.« Die Stimme Jobsts klang trotzig, fast herausfordernd.
Während der Stadtrichter daraufhin nur nickte, sah Peter Seimer abermals empört zu Jobst hinüber. Gleichzeitig lastete die Ungewissheit über das, was ihn selbst erwartete, wie ein schwerer Stein auf seiner Seele. Er wusste, dass der Stadtrichter auch ihn dazu auffordern würde, seine Aussage zu beeiden. Aber er würde dies ablehnen. Er durfte nicht schwören. Weil er sein Leben dem Herrn geweiht hatte. Als einer der Angehörigen der Gemeinde der »Armen Christi« zählte er zu denjenigen, die niemals einen Eid ablegten. Selbst nicht angesichts des Todes. Denn dies war schließlich eine Sünde. Eigentlich hatte er sich schon vor Wochen damit abgefunden, mit seinem heutigen Auftritt vor Gericht unweigerlich seine Identität preisgeben und sich als einer der »Armen« zu erkennen geben zu müssen. Doch dann, vor wenigen Tagen erst, war ihm etwas Seltsames widerfahren. Etwas, das ihn in die Lage versetzte, den Eid zu verweigern, ohne sich in aller Öffentlichkeit zu denjenigen bekennen zu müssen, welche die Kirche als Ketzer bezeichnete. Von diesem Zeitpunkt an hatte er wieder Hoffnung geschöpft. Doch ob der Richter seiner Geschichte Glauben schenken würde, war mehr als fraglich.
»Jobst Heiss, ich fordere Euch dazu auf, vor Gott und den Menschen zu bezeugen, dass Ihr die Wahrheit gesagt habt.« In fast feierlichem Ernst klang die Stimme Georg von Panhalms über den Platz. Zusammen mit ihm hatten sich auch alle anderen, die am Richtertisch saßen, erhoben.
»Hebt die Hand und schwört also: Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und bei allem, was mir heilig ist, dass ich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt habe.«
Jobst Heiss hob die Hand. »Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, und bei allem, was mir heilig ist, dass ich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt habe«, verkündete er Gott und den Menschen. Als er zu Ende gekommen war, standen Schweißperlen auf seiner Stirn.
»Nun gut. – Ich rufe als ersten Zeugen Balduin Lechner auf«, fuhr der Stadtrichter mit der Verhandlung fort.
Mit unsicheren Schritten erklomm der Schweinehirt in Begleitung eines der Büttel die Stufen und begann, sichtlich zum Ergötzen der Zuschauer, im Zick-Zack-Kurs quer durch die Laube zu stolpern. Den schwarzen, zerlumpten Hut mit der durchlöcherten Krempe hatte er abgenommen. Das graue Haar hing ihm in verwegenen Strähnen in das schmutzige, von einem struppigen Bart gerahmte Gesicht. Der schwarze Umhang über dem Wams starrte vor Dreck, ebenso die Beinlinge und die Lumpen, mit denen er seine Füße umwickelt hatte. Zielbewusst strebte Balduin mit wenigen Schritten dem Richtertisch zu, den er wider Erwarten auch tatsächlich erreichte. Deutlich schwankend, aber sich durchaus der Wichtigkeit seiner Person bewusst, verharrte er schließlich unmittelbar vor Georg von Panhalm.
Das hohe Gericht rümpfte entsetzt die Nase. Von Panhalm verzichtete darauf, Balduin förmlich zu fragen, ob er auch wirklich Balduin sei. Dass der Mann, der da vor ihm stand, Herr der Ternbergschen Schweine war, hätte nur ein Wahnsinniger oder jemand ohne Geruchssinn leugnen können. Ebenso wenig, dass das Bier Herr über den Mann war. Die Schwaden, die seiner Gestalt entströmten, ließen an seiner Identität keinen Zweifel zu.
Nur mit eisernem Willen gelang es dem Stadtrichter, seine Nase von der Umklammerung seiner Finger zu befreien.
»Balduin Lechner, Ihr wart Zeuge an jenem Abend, als Dietrich Pützer und Jobst Heiss miteinander stritten?« Der Richter bemühte sich, seiner Stimme einen amtlichen Ton zu verleihen.
Balduin schwankte bedenklich. Er sah den Richter mit glasigen Augen an – dann wandte er sich plötzlich um und torkelte an die Brüstung der Laube. Breit grinsend sah er auf die Masse der Zuschauer hinunter, ungeachtet der schwarzen Zahnstummel, die er dabei entblößen musste, und fuchtelte mit den Armen.
»Ha… habt Ihr … es a… alle … ge… gehört – hicks – er … er ha… hat … ›Ihr‹ zu mir … ge… gesagt … Verstanden? – hicks – ›Ihr‹ … hat er … ge… gesagt … Nicht … ein … einfach… ›Du‹. Der … der Mann … der Mann da – hicks« –, tollkühn vollzog Balduin eine halbe Drehung um die eigene Achse und wies mit einer kreisenden Bewegung seiner Rechten auf den Richtertisch, – »hicks – der … der weiß, … was sich … ge… gehört.«
Die Zuschauer brüllten vor Lachen.
»Weiter so, Balduin!«, schrie einer.
»Sollen wir in Zukunft auch ›Ihr‹ zu dir sagen?«, feixte ein anderer.
»Oder vielleicht ›Euer Gnaden‹«, rief jemand dazwischen.
»Wenn schon, dann ›Eure schweinischen Gnaden‹«, setzte ein anderer drauf.
Die Menge johlte. Sogar einige vom Rat und den Genannten begannen zu grinsen. Der Gerichtsschreiber lachte gar aus vollem Hals und hielt sich den Bauch. Georg von Panhalm merkte, wie ihm die Verhandlung zu entgleiten drohte. Schlagartig begriff er, dass nicht nur die Würde des Gerichts auf dem Spiel stand, sondern auch seine künftige Karriere.
»Wollt Ihr diesem unwürdigen Treiben nicht endlich ein Ende machen?«, raunzte Ludwig der Neudlinger den Stadtrichter an und mischte sich damit zum ersten Mal in die Verhandlung ein.
Von Panhalm erhob sich mit hochrotem Kopf und blickte wütend in die Runde.
»Ruhe!«, brüllte er von der Laube herunter. »Ruhe! Wollt Ihr endlich Ruhe geben! Das ist eine Gerichtsverhandlung und kein Possenspiel. Oder sollen Euch meine Büttel vom Platz prügeln?«
Sofort kehrte Ruhe ein.
»Wer es noch einmal wagen sollte, sich ungebührlich zu benehmen, den lasse ich drei Tage einlochen. Der Zeuge Balduin Lechner ist hiermit entlassen. Auf seine Aussage kann vorerst verzichtet werden, er wird diese morgen in meiner Amtsstube wiederholen – wenn er wieder nüchtern ist. – Entfernt den Mann!« Mit den letzten Worten hatte sich von Panhalm, ruhiger geworden, an den Büttel gewandt, der für den Schweinehirten zuständig war. Der packte Lechner bei den Armen und beförderte ihn die Treppe hinunter.
Balduin sah enttäuscht drein. Er hatte das bedauerliche Gefühl, dass sein Auftritt zu Ende war, bevor er richtig begonnen hatte. Da hatte er es endlich einmal geschafft, einige Augenblicke lang zu einer wichtigen Person zu werden, und schon war das Interesse an ihm wieder dahin. Missmutig torkelte er von dannen.
»Peter Seimer, seid Ihr bereit?«, rief von Panhalm seinen wichtigsten Zeugen auf. »Tretet näher und erklärt dem Gericht, wie sich die Dinge an jenem Abend aus Eurer Sicht zugetragen haben.«
Peter Seimer ging festen Schrittes die Treppen hinauf und trat an den Richtertisch. Mit einem sonderbaren Gesichtsausdruck, in dem Furcht und Zweifel, aber auch ernste Entschlossenheit lagen, sah er den Richter an.
»Nun?«, fragte der Stadtrichter. Irgendetwas in der Miene Seimers irritierte ihn.
Peter schwieg. Es fiel ihm sichtlich schwer, mit dem Sprechen zu beginnen.
»Was ist, Seimer? Hat es Euch die Sprache verschlagen?« Der Stadtrichter runzelte die Brauen; er wurde sichtlich ungeduldig.
»Nein, Herr Stadtrichter«, Peter hatte sich endlich überwunden, doch seine Stimme klang rau und brüchig. »Es ist nur«, er zögerte, »ich … ich möchte Euch und die anderen ehrenwerten Herren davon in Kenntnis setzen, dass ich meine Aussage zurückziehen muss.«
Der gesamte Richtertisch saß da, wie vom Donner gerührt. In der Menge hätte man eine Nadel fallen hören können.
»W-a-a-s sagt Ihr da?«, fragte von Panhalm ungläubig. »Ihr wollt Eure Aussage zurückziehen? Warum denn das, in Dreiteufelsnamen? Seid Ihr von allen guten Geistern verlassen? Oder wollt Ihr mich zum Narren halten?« In die Stimme des Richters hatte sich so etwas wie fernes Donnergrollen gemischt.
»Nichts liegt mir ferner, Herr Stadtrichter. Ihr wisst, dass ich stets den schuldigen Respekt Euch gegenüber habe walten lassen. Ich achte Euch und Euer Amt. Ebenso das der anderen Herren.« Seimer nickte dem Bannrichter und den Mitgliedern des Rates zu. »Und glaubt mir, es fällt mir nicht leicht zu widerrufen – doch das Leben meiner Familie steht auf dem Spiel.« Peter blickte zu Boden.
Durch die Menge ging ein Raunen. Die beiden Richter und die vier Ratsmitglieder sahen sich befremdet an, ebenso die Genannten. Jobst Heiss musterte Seimer mit verkniffenem Blick, aber auch mit sichtbarer Verwunderung.
»Erklärt Euch deutlicher, Peter Seimer. Was, zum Teufel, veranlasst Euch, Eure Aussage zurückzuziehen? Wer sollte Eurer Familie etwas antun wollen?«, wollte von Panhalm wissen.
»Ich hege große Sorge, ehrenwerter Herr Stadtrichter, dass, wenn ich bei meiner Aussage bleibe, von gewisser Seite«, – Peter Seimer blickte zu Jobst hinüber –, »versucht werden wird, Rache zu nehmen. Ich bin in einem anonymen Schreiben davor gewarnt worden, meine Aussage hier vor Euch zu bestätigen. Sollte ich dies dennoch tun und sollte dies zu einer Verurteilung des Angeklagten führen, würden meine Frau und meine Kinder dran glauben müssen – so ließ man es mich wissen. Darum bitte ich Euch inständig, meine Aussage als hinfällig zu betrachten und sie nicht beschwören zu müssen. Bitte, Herr Stadtrichter, entlasst mich aus dem Verfahren.«
Von Panhalm hatte mit ungläubigem Staunen zugehört. »Und Ihr glaubt tatsächlich, dass ich Euch das abnehme?«
»Welchen Grund sollte ich haben, Euch zu belügen? Ich denke, man kennt mich als jemanden, der weiß, was er sagt und was er tut«, wandte Peter ein.
In der Tat kannte jedermann Peter Seimer als einen aufrechten, absolut ehrlichen Mann mit einwandfreiem Leumund. Insgeheim nannten ihn einige spöttisch sogar den »Heiligen«. Auch seine Familie galt als vorbildlich – für manche gar als übertrieben vorbildlich. All dies wusste auch der Stadtrichter.
»Zeigt mir dieses Schreiben«, forderte der Richter den Zeugen auf.
Peter Seimer sah zu Boden. »Ich besitze es nicht mehr, Herr Stadtrichter«, sagte er leise.
»Ach, Ihr besitzt es nicht mehr. Und das soll ich Euch glauben? Die Sache wird ja immer besser«, konterte von Panhalm verärgert.
»Es ist aber so, ehrenwerter Herr Stadtrichter. Vor wenigen Tagen wurde ich von zwei maskierten Männern überfallen. Nachts, als ich mich auf dem Heimritt befand. Sie zwangen mich abzusteigen. Einer von ihnen überreichte mir das Schreiben, hielt mir ein Messer vor die Nase und zwang mich, es im Schein einer Fackel, die er bei sich trug, zu lesen. Danach vernichtete er es, indem er es vor meinen Augen verbrannte, und beide verschwanden im Wald. Ihr könnt Euch vorstellen, wie erschrocken ich war.«
»So, so, Ihr wart also des Nachts zu Pferd nach Hause unterwegs, als plötzlich zwei Maskierte auftauchten. Wo war das denn? Und wo wart Ihr gewesen – so spät des Nachts?«
»Bei Gundel Schreyer, dem Zeitler. Ihr wisst, dass ich mit ihm im Streite liege. Er behauptet, ich hätte eines meiner Bienenvölker darauf abgerichtet, seine Stöcke zu überfallen, was natürlich nicht wahr ist. Die Klage ist bei Euch anhängig. Ich wollte mich im Guten mit ihm einigen, aber ich traf ihn nicht an. Als ich zurückritt und noch etwa eine halbe Reitstunde von meinem Hof entfernt war, traten die beiden Maskierten plötzlich aus dem Wald und hielten mich auf.«
Georg von Panhalm runzelte die Brauen und sah seinen Zeugen skeptisch an.
»Würde ich Euch nicht besser kennen, Peter Seimer, würde ich Euch für verrückt erklären. Oder für den erfinderischsten Geschichtenerzähler auf Gottes Erdboden. Aber gut – gehen wir einmal davon aus, ich nehme Euch das Ganze ab: Wer sollte Euch erpressen? Ihr wisst, dass der Angeklagte seit der Tat in richterlichem Gewahrsam sitzt. Und zwar in einem gut bewachten Verlies hier in der Stadt.«
»Ich weiß, Herr Stadtrichter. Doch ich bitte zu bedenken, dass Jobst Heiss über viele Freunde verfügt.«
Da hatte Seimer durchaus recht. Von Panhalm wusste dies. »Und der Inhalt dieses angeblichen Schreibens lautete tatsächlich darauf, dass Eurer Familie Schaden droht, wenn Ihr bei Eurer Aussage bleibt?«
»Jawohl, Herr Stadtrichter.«
»Zeuge Peter Seimer, seid Ihr Euch darüber im Klaren, dass ich Euch, zumindest was Eure Behauptung, erpresst zu werden, angeht, unter Eid stellen muss?«
»Ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass dies Eure Pflicht ist. Und dennoch: Ich kann nicht einmal auf diese Sache den Eid leisten, ohne meine Familie ernstlich zu gefährden.«
»Was soll das nun wieder heißen?«, polterte der Stadtrichter erbost. Wütend knallte seine Hand auf den Tisch.
»Bei allem schuldigen Respekt, Herr Richter, das Schreiben enthielt auch die Aufforderung, nichts von alledem, was ich Euch eben gesagt habe, zu beeiden. Ich könne zwar darlegen, dass das Leben meiner Familie bedroht ist, aber ich dürfe nicht den Schwur auf diese Behauptung leisten. Ohne einen Eid ist meine Aussage jedoch nichts wert, also werdet Ihr sie nicht gegen Jobst Heiss noch gegen irgendjemand anderen verwenden können. Darauf bauen diejenigen, die mich unter Druck setzen. Ehrwürdiger Herr Stadtrichter, um des Lebens meiner Familie willen bitte ich Euch: Vergesst meine Aussage und seht davon ab, mich unter Eid zu nehmen. Entlasst mich aus dem Verfahren. Ich hoffe auf Eure Gnade und Euer Verständnis.« Seimer war zu Ende gekommen. Verzweifelt blickte er auf die beiden Richter und die Beisitzer.
Georg von Panhalm sah konsterniert auf seine Finger, die nervös auf die Tischplatte trommelten. Er war in einer verzwickten Lage. Da war ein Zeuge, der glaubhaft versicherte, man hätte ihn erpresst, damit er seine Aussage zurückziehe, die den Angeklagten erheblich belastete. Damit nicht genug, verlangten der oder die angeblichen Erpresser auch noch, dass eben dieser Zeuge die Umstände seiner Erpressung zwar darlegen, diese Darlegung aber nicht beeiden dürfe. Worin lag der Sinn dieser Taktik? Offensichtlich darin, alle Aussagen Seimers durch seine Verweigerung des Eides unwirksam werden zu lassen. Zum einen, was seine Darstellung der Geschehnisse jenes Abends anging, an dem der Pützer niedergestochen wurde. Zum anderen, was die Erpressung selbst betraf.
Von Panhalm war sich darüber im Klaren, dass er dem Zeugen nicht einmal in diesem Punkt einen Eid abnehmen konnte, ohne ihn in Angst zu stürzen. Denn auch der Tatbestand der Erpressung rückte Jobst Heiss deutlich in die Nähe einer Schuld, selbst wenn er nicht persönlich daran beteiligt war. Ein Eid in dieser Angelegenheit würde dem Schuldvorwurf gegen ihn eine umso bedrohlichere Dimension geben. Genau das versuchten der oder die Erpresser geschickt zu verhindern, indem sie Peter Seimer schreckliche Konsequenzen androhten, sollte er doch die Hand zum Schwur erheben. Gericht und Zeuge drehten sich so im Kreis. Waren auch genügend Verdachtsmomente gegen den Angeklagten gegeben, man konnte ihm nichts beweisen. Denn Seimer hatte unbestreitbar recht: Ohne einen Eid waren alle seine Zeugenaussagen nichts wert; so wollten es Recht und Gesetz. Ihn zum Schwur zu zwingen, war unter den gegebenen Umständen jedoch nicht sinnvoll; jeder Richter, der sich dazu hätte hinreißen lassen, hätte sich in den Augen der Öffentlichkeit der Rücksichtslosigkeit schuldig gemacht. Dagegen hatte ein Richter, der sich mit der öffentlichen Meinung gutstellte, unbestreitbar größere Chancen, erneut in das Amt gewählt zu werden.
Georg von Panhalm sandte einen Hilfe suchenden Blick zu Ludwig dem Neudlinger, der neben ihm saß.
»Glaubt Ihr an seine Schuld?«, raunte er ihm zu.
Der Bannrichter zuckte ratlos die Schultern.
»Ob wir beide es glauben oder nicht, spielt keine Rolle«, raunte er zurück. »Wegen Mordes können wir den Heiss jedenfalls nicht belangen. Er hat einen Eid darauf geleistet, dass dieser Pützer zuerst das Messer gezogen hat. Das könnt Ihr nicht widerlegen, nachdem Euer Hauptzeuge den Schwanz eingezogen hat, auch wenn ich geneigt bin, ihm zu glauben. So wie es aussieht, werden die Genannten, die die Fürsprache dieses Heiss übernommen haben, auf ›nicht schuldig‹ plädieren. Wenn alles so war, wie der Schmied behauptet, hatte er in der Tat das Recht, sich gebührend zu verteidigen.«
Von Panhalm nickte mit finsterer Miene. Er hatte in der Tat keine andere Wahl, als sich den Gegebenheiten zu beugen, wenngleich sein Instinkt ihm sagte, dass Peter Seimer die Wahrheit gesprochen hatte.
Ihm blieb nur noch, den Angeklagten nochmals zu verhören.
»Jobst Heiss, Ihr habt vernommen, was der Zeuge Seimer gesagt hat. Wie steht Ihr dazu?«, fragte er, im Innern davon überzeugt, dass sich diese Frage eigentlich erübrigte.
Jobst trat vor den Richter. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Völlig entgeistert war er zunächst den Ausführungen des Peter Seimer gefolgt. Er konnte einfach nicht glauben, was er da gehört hatte. Dann aber wurde ihm warm ums Herz. Offensichtlich hatten sich einige seiner Freunde mächtig ins Zeug gelegt, um ihn hier herauszuhauen. Er zermarterte sich das Hirn, wer sich da so für ihn eingesetzt haben mochte, doch er kam zu keinem Ergebnis. Aber letztendlich war das auch gleichgültig. Wichtiger war – das hatte er sofort begriffen –, dass die Aussagen Seimers keinerlei Bedeutung mehr besaßen. Ohne Kopf und Kragen zu riskieren, konnte er diesmal sogar auf die Fragen des Richters wahrheitsgemäß antworten. Denn was die Erpressung anging, von der Seimer berichtet hatte, wusste er schließlich wirklich nichts. Über das ganze Gesicht grinsend, aber immer noch sprachlos ob der für ihn unerwartet günstigen Entwicklung, stand Jobst Heiss vor seinem Richter.
»Ich habe Euch gefragt, wie Ihr zu der Aussage des Zeugen Seimer steht. Wollt Ihr Euch also endlich bequemen zu antworten?«, hakte der Panhalmer ärgerlich nach.
»Verzeiht, Ehrwürdiger Herr Stadtrichter«, antwortete Jobst mit triumphierendem Grinsen, »aber Ihr seht mich völlig überrascht. Mir fehlen die Worte. Doch Ihr habt es vorhin selbst schon gesagt: Wie hätte ich den Seimer erpressen können – ich saß ja die ganze Zeit über im Loch. Und was meine Freunde angeht: Welche Beweise gibt es für ihre angebliche Schuld? Wer könnte mit Recht irgendwelche Namen nennen? Mit Verlaub, Euer Gnaden: Peter Seimer lügt. Er hat von Anfang an gelogen; jetzt wird ihm die Sache zu heiß und er zieht den Schwanz ein. Dabei versucht er, die erste Lüge mit einer zweiten zu vertuschen.«
Jobst hatte Oberwasser bekommen, hämisch grinsend sah er zu Peter Seimer hinüber. In der Menge begann es wieder zu rumoren. Eine hitzige Diskussion hatte eingesetzt. Einige hielten es mit dem Zeugen, andere, und das waren nicht wenige, mit dem Angeklagten.
Zum wiederholten Male sauste der Hammer des Stadtrichters auf den Tisch.
»Ruhe!«, rief er. »R-u-h-e-!«
Er wandte sich an den Bannrichter und flüsterte ihm etwas zu. Gleich darauf steckten sämtliche Beisitzer die Köpfe zusammen und es folgte ein ausführliches, leise geführtes Gespräch zwischen den beiden Richtern und den Vertretern des Rates, dann erhob sich von Panhalm.
»Hiermit ergeht folgendes Urteil«, verkündete er. »Jobst Heiss wird vom Vorwurf des vorsätzlichen Mordes aufgrund ungültiger beziehungsweise fehlender Zeugenaussagen freigesprochen. Das Gericht muss ihm das Recht zur Notwehr zubilligen. Für den Tatbestand der gefährlichen Schlägerei jedoch verhänge ich über Jobst Heiss eine fünftägige verschärfte Kerkerhaft bei Wasser und Brot und verurteile ihn zum Tragen des Spotthutes für einen Tag. Darüber hinaus hat er dem Wirt Jakob Rabener den ihm zugefügten Schaden voll zu ersetzen. Das Urteil ist sofort durch den Züchtiger zu vollstrecken. Was den Zeugen Peter Seimer angeht: Er ist aus dem Verfahren entlassen. Auf seine Vereidigung wird verzichtet. Desgleichen erübrigt sich auch die Vernehmung der anderen Zeugen sowie das Plädoyer der vom Gericht bestimmten Genannten. Die Verhandlung ist damit beendet!«
Zum letzten Mal an diesem Tag ließ der Stadtrichter den Hammer herniederfahren.
Die beiden Büttel, die für den Angeklagten zuständig waren, packten diesen rechts und links am Arm und führten ihn ab. Jobst grinste und winkte mit den gefesselten Händen ins Publikum. Für viele war er der Held des Tages.
»Gut gemacht, Jobst!«, schrie ein kleiner, buckliger Alter mit einem lahmen Bein.
»Ja, dem Seimer hast du’s ordentlich besorgt!«, brüllte ein anderer. »Wenn du wieder draußen bist, saufen wir dem Rabenwirt den Keller leer!«, grölte ein Bärtiger namens Hans Rotter; er und Heiss waren besonders gute Freunde.
So wurde Jobst Heiss unter dem Beifall seiner obskuren Kameraden in das Stadtverlies geführt.
Einige von denen, die es mit Peter Seimer hielten, gingen auf ihn zu, klopften ihm auf die Schulter und gaben ihm ein paar gut gemeinte Worte. Doch Peter sah zu, dass er den Marktplatz so schnell wie möglich verließ. Ihm war nicht nur ein Stein, sondern ein ganzes Gebirge vom Herzen gefallen. Mochte er auch in den Augen einiger eine zweifelhafte Vorstellung als Zeuge abgeliefert haben, ihm selbst war dies gleichgültig. Hauptsache, er war um den Eid herumgekommen, ohne sich in aller Öffentlichkeit zu seinem Glauben bekennen zu müssen. Für ihn zählte nur eines: Dem Herrn hatte es gefallen, seinen Diener aus der Gefahr zu befreien. Vielleicht hatte sogar er für jene Maskierten gesorgt, die ihn erpresst hatten? Man konnte es nicht wissen. Die Wege des Herrn waren schließlich rätselhaft, wer vermochte sie schon zu kennen?
Das hohe Gericht hatte sich erhoben und verließ die Gerichtslaube.
Einige aus der Menge begannen ebenfalls zu gehen, während andere noch blieben. Man stand in Grüppchen beisammen und unterhielt sich über den Verlauf der Verhandlung, wobei die vermeintlich interessantesten Szenen und Aussagen wieder und wieder hervorgezerrt wurden, um sie genüsslich auf den tratschenden Zungen zergehen zu lassen.
Was für Jobst Heiss und Peter Seimer eine todernste Angelegenheit hätte werden können, empfanden die meisten der Zuschauer im Nachhinein lediglich als unterhaltsames Spektakel, an dem man sich ergötzt und das einem angenehme Schauer über den Rücken gejagt hatte.
Doch dies sahen nicht alle so.
Einige der Angehörigen der verschworenen Gemeinschaft der Armen Christi waren ebenfalls unter der Menge gewesen. Für sie, die wie Peter Seimer ihre religiösen Überzeugungen geheim halten mussten, war der Ablauf der Verhandlung vor dem Stadtrichter alles andere als ein vergnügliches Possenstück gewesen. Vielmehr eine erneute Bestätigung dafür, dass sie in einer Welt lebten, die vom römischen Antichristen und damit vom Teufel beherrscht wurde. Einer Welt, in der sie, die wahren Diener des Herrn, sich vorsichtig wie Tauben und listig wie Schlangen erweisen mussten.
Natürlich waren sie heilfroh, dass sich Peter Seimer nicht gezwungen sah, öffentlich zu bekennen, wer er war. Insofern musste man dem Herrn für seine Güte danken. Doch der Prozess hatte ihnen einmal mehr vor Augen geführt, in welcher Gefahr sie schwebten. Vor allem jetzt, da, wie man gerüchteweise hörte, wieder einmal die Heilige Inquisition im Begriff stand, ihre Klauen auszufahren.
Und so schwieg man lieber und ging still nach Hause, als sich an der öffentlichen Diskussion auf dem Marktplatz zu beteiligen.
Auch Heiner Mohr, der mit seiner Familie in Ternberg lebte und als guter Freund Peter Seimers galt, war gerade dabei aufzubrechen, als er von seinem Nachbarn Johann Rieser angesprochen wurde.
»Gott zum Gruß, Heiner. Willst du etwa schon gehen? Jetzt, wo’s so richtig gemütlich wird? Ich treff’ mich mit den Praitenbergers in der Goldenen Gans. Willst du nich mitkommen?«
»Nein, Johann. Danke für das Angebot. Vielleicht ein andermal. Ich muss heim; die Familie wartet«, beschied Heiner Mohr seinem Nachbarn und zwang sich zu einem unverbindlichen Lächeln. Sie mochten einander nicht, auch wenn sie notwendigerweise des Öfteren miteinander sprachen. In den Augen Heiner Mohrs war Rieser ein vulgärer Grobian, der beim kleinsten Missgeschick die Selbstbeherrschung verlor, fluchte, was das Zeug hielt, und weder mit seiner Familie noch mit seinen Nachbarn in Frieden leben konnte; kurz: ein Mensch, dessen Gesellschaft man besser mied. Rieser wusste, was Mohr von ihm hielt, und konnte ihn seinerseits nicht leiden. »Scheißheiliger«, »Betmemme«, »Pfaffenliebling« waren die gängigen Begriffe, mit denen er ihn titulierte, wenn er mit anderen über ihn sprach; Bezeichnungen, in denen sich gleichermaßen Hass und Spott spiegelten. Denn so sehr Rieser Mohr seines überaus sittsamen Lebenswandels und seiner tiefen Gläubigkeit wegen verachtete und mit Spott bedachte, so sehr empfand er insgeheim Neid wegen des ausnehmend guten Leumundes, den sein Nachbar überall genoss – und maßlosen Ärger darüber, dass sich Mohr deswegen »besser vorkam wie andere«, wie Rieser behauptete
»Ach was. Spiel nich wieder den Heiligen. Deine Familie kommt auch mal ohne dich zurecht. Gönn dir einen kühlen Schluck; komm mit«, forderte er ihn nichtsdestotrotz auf.
»Lass gut sein, Johann. Bis nach Ternberg ist’s ein ordentliches Stück Weg. Ich will bald zu Hause sein. Wie gesagt: ein andermal«, entgegnete Mohr und wandte sich zum Gehen. Das letzte Mal, als er sich von Rieser zu einem Schwatz am Biertisch hatte überreden lassen, war er mit hämischen Bemerkungen und spöttischen Kommentaren geradezu überschüttet worden. Damals hatte er sich geschworen, solches in Zukunft bleiben zu lassen.
Doch Johann Rieser ließ nicht locker. »Warte, Heiner; einen Augenblick noch. Was sagst du eigentlich dazu, wie’s mit dem Heiss ausgegangen is’? Der hat doch verdammtes Schwein gehabt. Wenn der Seimer hätt schwören können, wär’s vielleicht aus mit ihm gewesen. Dem Seimer hätten Richter und Ratsherren sicher eher geglaubt. Meinst du nich auch? Und überhaupt: Peter und du, ihr seid doch dicke Freunde. Hat er dir denn nichts von der ganzen Geschichte erzählt? Ich mein’, das mit den Maskierten und der Erpressung und so.«
»Nein, hat er nicht«, gab Heiner geduldig zur Antwort. »Er hatte auch keine Gelegenheit dazu. Ich habe ihn … ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen.«
»Ach, hör auf, Heiner, was heißt hier, schon länger nicht mehr gesehen. Er war doch erst vorgestern bei dir; spät des Nachts. Ich hab ihn gesehen. Und andere waren auch noch da – welche, die ich noch nie gesehen habe.«
Heiner Mohr erschrak. Was der Rieser sagte, war richtig. Peter war mitsamt seiner Familie und dem Gesinde tatsächlich vorgestern Nacht bei ihm gewesen. Und nicht nur er. Einige andere aus der Gemeinde waren ebenfalls bei ihm gewesen. Und auch die beiden reisenden Meister, Bruder Rudlin und Bruder Heinrich. Sie alle hatten Peter für die vor ihm liegende Verhandlung Mut zugesprochen. Rudlin und Heinrich hatten der geheimen Versammlung aus dem Buch der Psalmen vorgelesen. Dann hatten sie zusammen gebetet und anschließend hatten die beiden Meister den Anwesenden die Beichte abgenommen.
Allerdings hatte Heiner geglaubt, dass sie alle genügend Vorsicht hatten walten lassen und von niemandem gesehen worden waren.
Doch das war offenbar ein Irrtum gewesen.
Johann Rieser hatte sie beobachtet.
Heiner Mohr lächelte gequält.
»Ja, ja«, sagte er. »Du hast schon recht. Natürlich war Peter bei mir. Aber eben schon vorgestern. Darum sagte ich, ich hätte ihn schon länger nicht mehr gesehen. Zwei entfernte Verwandte waren bei ihm abgestiegen. Sie waren auf der Durchreise. Und da hat er uns eingeladen. Du verstehst schon. Wegen der Neuigkeiten und so. Unsereiner ist ja, wenn er erfahren will, was in der Welt passiert, auf durchziehende Reisende angewiesen. Aber von seiner Begegnung mit dem Maskierten hat er nichts erzählt. Wahrscheinlich wollte er seiner Aussage vor dem Stadtrichter nicht vorgreifen. Ist ja auch verständlich. Aber jetzt lass gut sein, Johann. Ich muss weiter.«
»Mach’s gut, Heiner. Und sag dem Seimer, er soll mich das nächste Mal auch mit einladen, wenn er Besuch kriegt. An Neuigkeiten bin ich schließlich auch interessiert.«
»Ich werd’s ihm ausrichten, Johann. Also dann – bis bald.«
Während sich Mohr endgültig zum Gehen wandte, sah ihm Rieser mit verkniffener Miene nach.
»Ich krieg dich schon, du scheinheiliger Tugendbold, dich und deine Freunde, verlass dich drauf«, murmelte er leise; der Verdacht, den er bereits über Jahre hinweg hegte, hatte heute neue Nahrung bekommen. Ein Hinweis, an der richtigen Stelle angebracht, würde die nötige Klärung bringen, da war sich Johann Rieser sicher.
Ein gehässiges Lächeln spielte um seine Mundwinkel, während er zum Goldenen Krug hinüberging.
*
Die beiden Männer waren von tiefer Zufriedenheit erfüllt.
Verschmitzt lächelnd, beobachtete der jüngere von ihnen die auseinanderstrebende Menschenmenge auf dem Platz vor dem Stadtrichterhaus.
»Siehst du, Bruder Rudlin, die List hat sich gelohnt«, sagte er.
Der Ältere lächelte still vor sich hin. »Ja, für diesmal hast du recht behalten, Bruder Heinrich. – Im Übrigen: Du musst sehr überzeugend gewirkt haben. Peter hat dich wirklich nicht erkannt, als du ihm den fingierten Drohbrief überreicht hast.«
»Nun, das war schließlich auch der Sinn der Übung, nicht wahr?«, grinste der Jüngere.
Der Ältere nickte. »Beten wir zum Herrn, dass deine List auch weiterhin erfolgreich sein möge, Bruder Heinrich«, entgegnete er, während das Lächeln in seiner Miene skeptischem Ernst Platz machte.
»Ja«, bestätigte der Jüngere, ebenfalls ernster werdend, »beten wir darum.«
*
Zu denen, die den Platz vor dem Stadtrichterhaus recht nachdenklich verließen, gehörte auch Christine von Falkenstein. Während sie zum Haus des Ternbergers hinunterging, versuchte sie, die Verhandlung noch einmal an ihrem geistigen Auge vorüberziehen zu lassen. Sie hatte einen guten Platz in der vordersten Reihe der Zuschauer ergattern und die Protagonisten genau beobachten können. Auch Peter Seimer. Ein hochgewachsener, asketisch wirkender Mann, schlank, fast mager, der trotz der mächtigen Hakennase und der kantigen Gesichtszüge einen gütigen, fast vornehmen Eindruck machte. Obgleich sie seine Erklärung über die nächtliche Begegnung mit den zwei maskierten Männern als äußerst seltsam empfand, tendierte sie wie auch der Stadtrichter dazu, ihm zu glauben. Während des Verhörs durch Georg von Panhalm hatte sie auch die eine und andere aufschlussreiche Bemerkung aus dem Publikum über ihn aufgeschnappt. Die meisten zeugten durchweg von Respekt. Einige aber auch von gutmütigem, andere sogar von bösartigem Spott.
Was Christine jedoch am meisten beschäftigte, war das, was Peter Seimer über seine Beziehung zu Gundel Schreyer, dem Zeitler, gesagt hatte. Irgendwie wurde sie das Gefühl nicht los, dass damit eine weitere Figur aus dem Dunstkreis der Beziehungen zwischen Seimer, Klara und Sofia Kontur bekommen hatte, die lohnte, einer genaueren Betrachtung unterzogen zu werden.
Schade, dass du nicht dabei sein konntest, Falk. Christine dachte an ihren Gatten, der die Gelegenheit ihres Aufenthaltes genutzt hatte, um für einige Tage nach Melk zu reisen. Der Prior des dortigen Benediktinerstiftes, den er seit vielen Jahren kannte, war schwer erkrankt, und so hatte Falk beschlossen, ihm einen Besuch abzustatten. Übermorgen erst würde er zurückkehren.
Christine verlangsamte ihren Schritt und grübelte …
Peter Seimer und Gundel Schreyer. Zwischen ihnen herrschte ein nicht unerheblicher Streit, und zwar dergestalt, dass sogar der Stadtrichter damit beschäftigt war. Die Tatsache, dass Seimer Schreyer lediglich als Zeitler bezeichnet hatte, ließ den Schluss zu, dass dessen Hauptbeschäftigung den Bienen galt. Oder dem Flugvieh, wie die kleinen fleißigen Summer auch genannt wurden. Wer seinen Lebensunterhalt ausschließlich als Zeitler bestritt, verfügte in der Regel über bedeutend mehr Bienenstände als die normalen Bauern, die nur einige Schwärme nebenbei hielten. Dass er eifersüchtig über seine Völker wachte, verstand sich von selbst, entsprach der Kaufpreis zweier Bienenvölker doch dem einer guten Kuh!
Aber dass Peter Seimer einen seiner Schwärme darauf abgerichtet haben sollte, die emsigen Honiglieferanten des Gundel Schreyer zu überfallen, das schien Christine nun doch sehr weit hergeholt.
Honig!
Christine verhielt ihren Schritt.
Klara!
Der rechte Ärmel ihres Surkots war voller Honig gewesen. Ungezählte Ameisen hatten sich daran gütlich getan.
Klara – Gundel Schreyer …?
Obwohl ihr die Idee abstrus erschien, fühlte Christine eine seltsame Erregung in sich wachsen.
Sie würde Falk über ihre Vermutung in Kenntnis setzen und dann …
… nein!
Falk würde erst übermorgen nach Steyr zurückkehren. So lange würde sie nicht warten.
Sie würde es so schnell wie möglich herauszubringen suchen.
Am besten schon morgen.