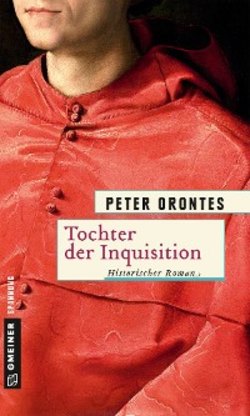Читать книгу Tochter der Inquisition - Peter Orontes - Страница 17
Kapitel 12
ОглавлениеDienstag, 11. August 1388
Seit nunmehr zwei Tagen schon fiel dichter Regen in feinen Schnüren vom Himmel und hüllte die Landschaft in trostloses Grau, es war kühl geworden; zu kühl für diese Jahreszeit.
Morast spritzte unter den Hufen der Pferde, deren Reiter sich gegen die durchdringende Nässe mit dicken Mänteln zur Wehr zu setzen suchten. Bereits im Morgengrauen waren sie von Steyr in Richtung Ternberg aufgebrochen.
»Wäre es nicht besser gewesen, das Stück Stoff in seinem Versteck zu belassen? Was machen wir, wenn dieser Schreyer den Verlust bemerkt und das Weite gesucht hat?« Missmutig musterte Georg von Panhalm Falkmar von Falkenstein, der neben ihm ritt.
»Wenn ich ein Beweismittel entdecke, habe ich es unverzüglich zu sichern, das müsstet Ihr als Stadtrichter eigentlich wissen. Warum sollte der Mann Reißaus nehmen, nur weil er dieses Stück Stoff vermisst? Und mal ganz ehrlich: Hättet Ihr Euch des Zeitlers angenommen, wenn ich Euch das alles nur erzählt hätte, ohne Euch das Beweisstück zu präsentieren?«
Ärgerlich gab Falk seinem Rappen die Fersen und preschte schlammspritzend an die Spitze des kleinen, aus acht Mann bestehenden Reitertrupps. Erst gestern, Montag, spätabends, war es ihm gelungen, Stadtrichter und Burggraf zu erreichen und sie von dem Fund Christines zu unterrichten. Vorher hatten sowohl Irmingard als auch Hans Söhnlein bestätigt, dass der Stofffetzen tatsächlich von jenem Kleid stammte, das Klara am Tag ihres Todes trug. Obwohl die beiden Obrigkeitsvertreter die Beweiskraft des Indiziums nicht leugneten, wurde Falk das Gefühl nicht los, dass sie alles andere als erbaut davon waren, der neuen Spur nachgehen zu müssen. Zu sehr fühlten sie sich bloßgestellt, war der Fund Christines doch ein Beweis dafür, dass sie die Umstände des Mordes an Klara völlig falsch eingeschätzt hatten. Besonders Heinrich von Pogner, dem Burggrafen, war der Ärger über die aus seiner Sicht fatale Entwicklung der Ereignisse anzusehen gewesen. Eigentlich hätte er an diesem Morgen mit dabei sein sollen; durch einen Boten hatte er jedoch, noch bevor sie aufgebrochen waren, mitteilen lassen, dass er auf der Burg unabkömmlich sei. Es genüge schließlich, wenn man ihn baldmöglichst über das Ergebnis der Unternehmung unterrichte, alles Weitere werde sich finden.
»Wir steigen ab. Den Rest gehen wir zu Fuß«, befahl der Stadtrichter und sprang aus dem Sattel. Auch Falk und die sechs Büttel saßen ab.
Trotz des schlammigen Straßenzustandes waren sie verhältnismäßig gut vorangekommen; soeben hatten sie den Wald verlassen und den Wiesengrund erreicht, auf dem das Anwesen des Zeitlers stand. Noch war es ziemlich dunkel, der Morgen war jung, zudem verweigerte eine tief hängende Wolkendecke dem Licht des Tages das ihm zustehende Recht.
Sie nahmen die Pferde beim Zügel und schritten am Zaun entlang.
»Hans und Gottfried, ihr sichert den Eingang und passt auf die Pferde auf, die lassen wir bei euch. Siegbert, Bodo, Heinrich und Jakob, ihr kommt mit uns«, instruierte von Panhalm seine Büttel, als sie beim Gatter angelangt waren.
Nachdem sie sich durch die Öffnung gezwängt hatten, suchten sie hinter einigen Haselsträuchern erst einmal Deckung und sahen sich um. In nordöstlicher Richtung, in einer Entfernung von vielleicht fünfzig Fuß, bemerkten sie ein geduckt daliegendes Gebäude – die Kate des Zeitlers. Als dunkelgrauer Klotz erhob sie sich aus dem hohen Gras, das an diesem verregneten Montagmorgen ebenfalls jegliche Farbe verloren zu haben schien.
Der Stadtrichter hob die Hand.
»Gehen wir’s an. Wir werden ihm eine hübsche Überraschung bereiten. Bodo, Siegbert und Jakob, ihr umstellt die Hütte. Auf jede Seite ein Mann«, raunte er den Bütteln zu. »Heinrich, du bleibst bei mir und Herrn von Falkenstein. Wir nehmen uns die Tür vor.«
Auf sein Zeichen hin begannen sie loszulaufen, wobei das hohe, nasse Gras ihnen das Vorwärtskommen nicht gerade erleichterte. Die drei Büttel erreichten als Erste die Kate und umstellten sie. Gleich darauf langten auch von Panhalm, Falk und Heinrich bei der Tür an. Sie war verschlossen.
»Gundel Schreyer, hier ist der Stadtrichter Georg von Panhalm. Ich befehle Euch, zu öffnen und herauszukommen!«, rief von Panhalm, noch ganz außer Atem, und hämmerte mit der Faust mehrmals gegen die Tür.
Nichts rührte sich.
»Gundel Schreyer, ich fordere Euch im Namen der weltlichen Gerichtsbarkeit auf zu öffnen!«, brüllte der Stadtrichter erneut.
Wieder keine Antwort.
»Öffne endlich die Tür, du verdammter Bastard! Oder sollen wir sie einschlagen?«
Stille. Keine Reaktion.
»Er will es nicht anders. Heinrich, tritt sie ein!«, befahl der Stadtrichter seinem Büttel. Der Mann war untersetzt, aber muskulös und kräftig. Er grinste und trat einige Schritte zurück. Dann nahm er Anlauf, sprang mit einem Satz hoch und trat mit dem rechten Stiefelabsatz gegen das Schloss. Ein Krachen ertönte, Holz splitterte, die Tür sprang einen Spalt weit auf.
»Komm heraus! Und denk daran, jeder Widerstand ist zwecklos!«, rief der Stadtrichter, der sich zum Schutz vor unliebsamen Überraschungen mit dem Rücken zur Wand neben dem Eingang postiert hatte. Auch Falk und Heinrich waren seinem Beispiel gefolgt. Alle hatten sie ihre Schwerter gezogen und warteten nun darauf, dass der Zeitler die Ausweglosigkeit seiner Lage einsah und endlich erschien.
Doch noch immer rührte sich nichts. Außer dem leisen, kaum wahrnehmbaren Rauschen, das das Nieseln des Regens verursachte, war alles still – unheimlich still.
Von Panhalm und Falk wechselten einen kurzen Blick. Dann sprangen beide, die Tür zur Gänze aufstoßend, mit gezückten Schwertern über die Schwelle. Das magere Licht des Morgens fiel durch die Tür und erhellte nur spärlich das Dunkel des Hütteninneren. Doch es genügte, um sie den fürchterlichen Anblick wahrnehmen zu lassen, der die unheimliche Stille erklärte.
An einem der Deckenbalken, die sich quer durch die Kate zogen, hing an einem Strick die Leiche eines Mannes, zu seinen Füßen lag ein umgestoßener Schemel. Das Haupt zur Seite geneigt, die Augen weit aufgerissen, streckte er den entsetzten Betrachtern die Zunge entgegen. Ein Windhauch fuhr in die Kate und ließ den Körper gespenstisch hin- und herpendeln.
»So er wirklich der Mörder ist, hat er sich nun selbst gerichtet«, murmelte von Panhalm nach dem ersten Schrecken. »Heinrich, eine Fackel, schnell! Und sag den anderen, sie sollen hereinkommen«, befahl er dem Büttel.
Kurz darauf traten die anderen drei Gerichtsknechte über die Schwelle, und der helle Schein der Fackel prägte das ganze Grauen in die frühmorgendliche Dämmerung. Jetzt erst bemerkten sie, dass das Gesicht der Zeitlers blau angelaufen war; die Zunge, die groß und dick aus dem Mund schwoll, hatte eine fast schwarze Farbe angenommen.
»Bodo und Siegbert, nehmt ihn herunter!«, befahl der Stadtrichter.
»Halt, wartet!«, widersprach Falk, was von Panhalm zu einem ärgerlichen Stirnrunzeln veranlasste.
»Verzeiht, Herr Stadtrichter, aber lasst mich zuerst noch etwas ausprobieren«, bat Falk.
Er hob den umgestoßenen Schemel auf, stellte ihn direkt unter den am Strick hängenden Leichnam und trat einen Schritt zurück.
Erstaunt beobachtete von Panhalm ihn.
»Fällt Euch etwas auf?«, wandte sich Falk an den Stadtrichter.
»Was sollte mir auffallen?«
»Seht Euch den Abstand zwischen den Füßen und dem Schemel an.«
»Den Abstand? Was ist damit?«
»Ganz einfach: Er ist ein wenig zu groß.«
»Ein wenig zu groß? Was meint Ihr mit: zu groß?«
»Er ist zu groß, als dass der Mann sich selbst getötet haben könnte. Er wurde getötet.«
»Ach, er wurde getötet. Ihr seid dabei gewesen, nicht wahr?«, bemerkte der Stadtrichter süffisant und verärgert zugleich.
Das darf nicht wahr sein, dachte Falk und erinnerte sich unwillkürlich an die Bemerkung des Ternbergers über die Unfähigkeit des Richters.
»Nun, überlegt doch mal, wenn Ihr Euch erhängen wolltet, wie würdet Ihr es anstellen?«
»Hört auf, in Rätseln zu sprechen, erklärt Euch gefälligst deutlicher«, polterte der Stadtrichter los.
»Würde ich es tun wollen, würde ich einen Strick nehmen, ihn an einer bestimmten Stelle und in einer bestimmten Höhe festknüpfen, und zwar so, dass, nachdem ich mir die Schlinge um den Hals gelegt habe, mein Körper genügend tief fallen kann, um sicher das Genick zu brechen; schließlich möchte ich nicht elendiglich ersticken«, fuhr Falk ungerührt fort. »Vorher allerdings müsste ich darauf achten, dass ich den Gegenstand, auf den ich mich stellen muss, sagen wir, einen Schemel, mit den Füßen problemlos erreichen und umstoßen kann. Könnt Ihr mir so weit folgen?«, dozierte Falk weiter und bemühte sich gar nicht erst, den arroganten Eindruck, den er damit erweckte, zu unterdrücken; zu groß war der Ärger, den er über die Einfältigkeit des Stadtrichters empfand. Der Mann mochte als Richter eine ganz passable Figur abgeben, als Ermittler war er ein Versager.
Den schien das Belehrende an Falks Argumentation jedoch nicht weiter zu stören.
»Ah, jetzt verstehe ich. Ihr meint, Schreyer hätte den Schemel gar nicht allein umstoßen können, er hing zu hoch, nicht wahr?«, bemerkte er.
»Richtig«, bestätigte Falk.
»Wenn er getötet wurde, wie hat sich aber dann der Täter davonstehlen können? Schließlich war die Tür verschlossen. Der Schlüssel steckte von innen, wie Ihr wisst. Als wir sie aufsprengten, fiel er herunter«, hielt der Stadtrichter dagegen und wies auf den Schlüssel, der in der Tat am Boden lag. »Das Fenster kommt ja wohl nicht infrage. Da kommt niemand durch. Habt Ihr auch dafür eine Erklärung?«, fügte er triumphierend hinzu.
Falk sagte zunächst nichts und sah sich erst einmal um. Dabei inspizierte er vor allem den Platz um die halb zertrümmerte Tür und schob sie, so gut es ging, zu. Dann aber, als sein Blick am Boden entlangglitt, ging er plötzlich in die Hocke – und schob mühelos die flache Hand in den Spalt, der zwischen der unteren Kante der Tür und dem Fußboden klaffte.
»Wie ich mir das erkläre? Ganz einfach: Der Täter griff sich den Schlüssel, verschloss damit die Tür von außen und schob ihn einfach durch diesen Spalt wieder nach innen«, entgegnete er lakonisch und erhob sich. »Ihr könnt ihn jetzt herunternehmen lassen«, fügte er hinzu und deutete auf den Leichnam.
Von Panhalm maß ihn mit einem Blick, als wollte er ihm jeden Augenblick an die Gurgel fahren. Dann drehte er sich ruckartig um. »Siegbert, Bodo, Heinrich, ihr habt es gehört. Also macht voran!«, fuhr er seine Büttel wütend an.
Mit säuerlichem Gesicht schnitten die Knechte den Leichnam vom Balken und legten ihn auf den festgestampften Lehmfußboden. Der Tote war steif wie ein Brett.
»Lange kann der Mann noch nicht dort hängen. Höchstens vier bis acht Stunden. Noch hält die Leichenstarre vor«, sagte der Stadtrichter. Wenigstens das hast du bemerkt, ging es Falk durch den Kopf.
Als sie gleich darauf neben der Leiche in die Hocke gingen, fanden sich weitere Zeichen, die nahelegten, dass Gundel Schreyer sich nicht selbst umgebracht haben konnte.
Falk deutete auf die Unterarme. »Seht Ihr diese blutunterlaufenen Striemen hier an den Handgelenken?«
»Natürlich, ich bin ja nicht blind. Sieht aus, als wäre der Mann gefesselt gewesen«, brummte der Stadtrichter finster. Offensichtlich ärgerte er sich noch immer über die Blöße, die er sich gegeben hatte.
Mit ein paar Handgriffen lockerte Falk den Strick, der fest um den Hals des Toten geschlungen war, und schob ihn ein wenig nach unten.
»Ah, das ist interessant. Seht Euch das an.«
Der verhältnismäßig dicke Strick hatte ein um den gesamten Hals verlaufendes, bläulich verfärbtes ringförmiges Mal hinterlassen. Doch es gab noch ein anderes Muster, das sich auf grausame Weise in die Haut geprägt hatte. Bedeutend schmaler, als der dicke Strick es vermochte, und so tief, dass rundum Blut ausgetreten war.
Diesmal kam dem Stadtrichter die Erleuchtung etwas schneller.
»Der Mann dürfte schon tot gewesen sein, als ihn der Täter an dem Balken aufknüpfte. Er hat ihn vorher mit einer Schnur erdrosselt, die ihm regelrecht ins Fleisch schnitt«, schlussfolgerte er.
Falk nickte. »Ja. Dafür, dass das Opfer qualvoll erstickte, sprechen auch die intensiv bläuliche Gesichtsfarbe und die hervorquellende Zunge. Wie Ihr seht, haben wir es bei dem Mörder mit einem sehr einfältigen Menschen zu tun.«
»Einfältig?«
»Ja. Er will uns glauben machen, dass der Zeitler selbst Hand an sich legte, und hat versucht, uns auf eine falsche Fährte zu locken. Allerdings ging er dabei äußerst stümperhaft zu Werk. Er muss schon sehr einfältig sein, wenn er glaubt, dass wir darauf hereinfallen.«
»So gesehen, habt Ihr recht«, bekräftigte der Stadtrichter geschmeichelt. »Einen scharfen Verstand kann er nicht gerade sein Eigen nennen.«
Das sagt der Richtige, spottete Falk in Gedanken.
»Was sollen wir nun tun, was schlagt Ihr vor?«, fragte er.
»Wir werden das Unterste zuoberst kehren«, sagte der Stadtrichter bestimmt und richtete sich ebenfalls auf. »Wo sich das Eine fand, findet sich vielleicht auch Weiteres. Ich würde gerne das Versteck inspizieren, das Eure Gattin entdeckt hat.«
Falk ging zur Feuerstelle hinüber. Christine hatte ihm die Stelle in der Herdmauer, die dem Fenster gegenüberlag, genau beschrieben; er musste keine große Mühe aufwenden, um den Ziegel zu entdecken, der die Höhlung verschloss, und zog ihn heraus.
»Hier. Bedient Euch.«
Der Stadtrichter ging in die Hocke, griff vorsichtig in die Öffnung und tastete ausgiebig darin herum.
»Nichts«, verkündete er nach einer Weile enttäuscht und stand auf.
Natürlich nicht, dachte Falk und unterdrückte die abfällige Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag.
Auch die darauffolgende Untersuchung der Kate und des danebengelegenen Schuppens förderte nichts zutage, was irgendwie von Bedeutung gewesen wäre. Dennoch beschloss Falk, so bald wie möglich zurückzukehren, um eine erneute Inaugenscheinnahme vorzunehmen, jedoch allein und unbeobachtet.
»Ich denke, das war’s. Ich würde vorschlagen, wir reiten nach Hause. Ich habe noch einiges zu tun«, trat der Stadtrichter an ihn heran.
»Aber natürlich. Was geschieht mit der Leiche?«
»Die wird selbstverständlich noch heute geborgen werden. Allerdings …«, der Stadtrichter kratzte sich am Kopf, »normalerweise müsste ich den Leichnam bewachen lassen. Aber ich kann heute keinen meiner Büttel entbehren; ich benötige sie für die Suche nach dem entflohenen Waldenserschwein. Der Mann ist erst gestern wieder gesehen worden. Er hat Marthe Kranich, eine junge Frau, eine Kräutersammlerin, die in den Wäldern lebt, vergewaltigt.«
»Ein Waldenser, der Frauen vergewaltigt?«, fragte Falk ungläubig.
Von Panhalm schnaubte grimmig. »Ja. Es handelt sich noch dazu um einen ihrer Meister. Wir nennen ihn das ›Rußgesicht‹, weil er sein Gesicht mit Ruß färbt. Er muss mit dem Teufel im Bund stehen. Kaum dass er auftaucht, ist er im gleichen Augenblick auch schon wieder verschwunden. Da sieht man mal, wie sie wirklich sind, diese verdammten Ketzer. Tun so, als seien sie die Reinheit in Person, und dann so was. Aber ich werde ihn schon kriegen und dann gnade ihm Gott.«
Ein kantiger Zug legte sich um Falks Mundwinkel. Waldenser. Schon vor vielen Jahren hatte er sich mit den Lehren und der Weltsicht dieser eigenartigen, im Geheimen wirkenden Bruderschaft, die in vielen Gegenden des Reiches anzutreffen war, auseinandergesetzt. Obwohl als »secta Waldensium« von der Inquisition erbarmungslos verfolgt und gejagt, gelang es ihr seit über zweihundert Jahren, sich nicht nur zu behaupten, sondern ihre Anhängerschaft zu mehren. Ihre Angehörigen verwarfen die Stellung des Papstes, prangerten den ausschweifenden Lebensstil der Geistlichen an, lehnten die meisten der Sakramente ab und zogen gegen die Verehrung von Bildern, die Anrufung der Heiligen, das Fegefeuer und den Ablass zu Felde. Sie wären die Einzigen, die sich streng an die Lehren der Heiligen Schrift hielten, und somit seien sie die einzig wahre Kirche Jesu Christi – behaupteten sie. Wen wunderte es da, dass man die »Armen Christi«, wie sich die Waldenser selbst nannten, der Ketzerei sowie der ungeheuerlichsten Verbrechen und der Verübung scheußlichster Praktiken beschuldigte, was allerdings, wie Falk sehr wohl wusste, auf erbärmliche Weise an den Haaren herbeigezogen und größtenteils erstunken und erlogen war.
Ein Waldenserprediger, der eine Frau vergewaltigt hatte – war auch das nur eine böswillige Behauptung?
Plötzlich schoss ein Gedanke in Falk hoch, der seine Grübeleien sogleich wieder verdrängte.
»Wenn Ihr damit einverstanden seid, bleibe ich so lange hier, bis die Fuhrknechte kommen, um die Leiche abzuholen«, schlug er dem Stadtrichter vor.
»Das würdet Ihr tun? Da wäre ich Euch aber sehr verbunden.« Die verbissene Miene von Panhalms entspannte sich etwas; Falk glaubte, für die Dauer eines Wimpernschlags sogar eine Spur von Freundlichkeit darin entdeckt zu haben.
»Ich denke, wenn wir einander unterstützen, statt uns gegenseitig zu behindern, wird der Erfolg nicht ausbleiben, Herr Stadtrichter. Das ist gut für Euch und gut für mich. Und mit dem Segen Wernher von Ternbergs lebt es sich in Steyr leichter als ohne ihn, meint Ihr nicht auch?«, entgegnete Falk und versuchte sich an einem gewinnenden Lächeln.
Der Stadtrichter sah ihn überrascht an. Ein verlegenes Räuspern war jedoch das Einzige, was er hervorbrachte. Mit sichtlicher Hast und ohne auch nur mit einem Wort auf Falks Friedensangebot einzugehen, setzte er sich mit seinen Bütteln in Bewegung.
Falk wartete, bis die Männer beim Gatter angelangt waren, dann betrat er erneut die Kate. In einer Ritze der Bretterwand steckte noch eine brennende Fackel. Er ergriff sie und leuchtete nochmals jeden Winkel der Hütte aus. Den toten Zeitler, der nach wie vor auf dem Boden lag, ignorierte er.
Da waren das Bett und der Strohsack.
Da war das Regal an der Wand mit diversen Töpfen und Gefäßen.
Und da waren der Rauchfang und die Herdstelle.
Die Herdstelle! Obwohl sie den ummauerten Feuerplatz bereits einer eingehenden Prüfung unterzogen hatten, hielt Falk noch einmal die Fackel in die Öffnung und spähte hinein. Asche bedeckte etwa zwei Fingerbreit hoch den Boden, der aus Ziegeln bestand, die sorgfältig in den lehmigen Grund eingelassen waren. Einer Eingebung folgend, beugte er sich hinunter, griff mit der Rechten an verschiedenen Stellen in den mehligen, grauen Staub und ließ ihn langsam durch die Finger rieseln. Überrascht registrierte er, dass er noch leicht warm war. Plötzlich aber ertasteten seine Finger etwas, das sich dünn und biegsam anfühlte. Er zog es aus der Asche – und hielt gleich darauf einen Pergamentfetzen in den Fingern; Überbleibsel eines Schreibens, das offenbar hier im Herd verbrannt worden war. Es maß etwa vier Fingerbreit im Quadrat und war stark angekohlt. Dennoch gelang es Falk, zumindest einige wenige Wortfragmente zu entziffern. ›… Verd … Oss … Heimi …‹, las er im Licht der Fackel. Der Rest des Satzes verlor sich in dem breiten, schwarz verkohlten Rand, der unter seinen Fingern bereits zu zerbröseln begann. Was ihn verwunderte, war die Beschaffenheit des Pergaments; handelte es sich doch zweifelsfrei um den besten Beschreibstoff, den man für teures Geld bekommen konnte – um reinstes Vellum.
Vorsichtig steckte er das Fragment in seine Gürteltasche, beugte sich abermals hinunter und fuhr, die Finger wie einen Rechen benutzend, durch die Asche, in der Hoffnung, weiteres zutage zu fördern. Doch außer ein paar verkohlten Aststückchen und ein paar Tonscherben, die er sorgfältig auf die Mauer legte, fand er nichts.
Falk warf die Fackel in die Asche, wo sie bald erlöschen würde, und setzte sich grübelnd auf die Herdmauer.
Gundel Schreyer war nicht nur im Besitz eines für Klara von Ternberg kompromittierenden Briefes gewesen; durch seine Hände musste ein weiteres Schreiben gegangen sein, das, aus welchen Gründen auch immer, in seinem Herd verbrannt worden war. Wie war er in den Besitz der Dokumente gelangt? Gab es etwas, das ihn mit Lamprecht Bürgel verbunden hatte? Vielleicht würde ein Besuch bei dessen Witwe weiteren Aufschluss geben. Falk beschloss, sie so bald wie möglich aufzusuchen.
Nachdenklich musterte er den Leichnam Schreyers, der steif und starr auf dem Fußboden ruhte. Bald würde ein Fuhrwerk kommen und den toten Zeitler zum Friedhof karren – wie viele seiner Geheimnisse würde er wohl mit ins Grab nehmen?
Falk erhob sich und trat ans Fenster. Es wurde immer heller. Irgendwo stoben aufgeregt krächzend zwei Krähen empor, Zeichen dafür, dass der Tag nun vollends erwacht war. Ob Christine wohl schon …
… ssst – ein Geräusch, drüben beim Schuppen …
… der flüchtige Anblick einer schwarzen Fratze …
… und ein leises Sirren.
Verbunden mit einem kalten Hauch, schwirrte etwas an Falks Ohr vorbei.
Ein Fluch entfuhr seinen Lippen. Einem ausgeprägten Instinkt folgend, duckte er sich blitzschnell unter das Fenster, riss den Dolch aus dem Gürtel und schnellte mit zwei mächtigen Sätzen zum Eingang, wo er mit angehaltenem Atem neben der halb geöffneten Tür verharrte.
Das »Rußgesicht«!
Kein Zweifel – er hatte das »Rußgesicht« gesehen!
Was zum Kuckuck hatte der Mann hier zu suchen?
Und warum zum Henker hatte er auf ihn geschossen?
Falks Augen tasteten suchend das Hütteninnere ab – und hefteten sich auf einen kleinen, länglichen Gegenstand fast unmittelbar zu seinen Füßen: ein winziger, gefiederter Bolzen. Er war irgendwo abgeprallt und quer durch die Hütte bis fast vor die Tür geschleudert worden.
Falk hob das Geschoss auf und betrachtete es. Es musste von einem sogenannten Kleinschnepper abgeschossen worden sein; einer etwas mehr als faustgroßen Armbrust, auch Balestrino genannt, die in den Händen eines geübten Schützen eine heimtückische, überaus gefährliche Waffe darstellte.
Falk sah auf. Sein Blick bohrte sich durch die groben Ritzen der Tür. Komm nur, du hinterhältiger Schuft, ich –
Ein nicht näher bestimmbares Geräusch verhinderte, dass er den Gedanken zu Ende dachte. Gleich darauf flog ein Gegenstand durchs Fenster, schlug auf dem Lehmfußboden auf – und verwandelte sich augenblicklich in eine sich rasch ausbreitende dunkle Wolke winziger stechender Biester, die, zu Hunderten herumstiebend, die Kate mit drohendem Summen erfüllten.
»Du Bastard!«, entfuhr es Falk. Offensichtlich hatte das Rußgesicht einen der Bienenkörbe hereingeschleudert, um ihn so zu zwingen, die Kate zu verlassen.
Falk versuchte, sich des wütenden Flugviehs zu erwehren, und wechselte rasch auf die andere Seite des Eingangs. Ihm blieb nur noch die Flucht nach vorn. Doch dazu bedurfte es einer geeigneten Deckung. Angestrengt spähte er durch die halb geöffnete Tür ins Freie – und erblickte die Regentonne, etwa fünfzehn Schritte vom Eingang entfernt. Wenige Sprünge mussten genügen, um dorthin zu gelangen. Er rannte los und hörte, wie ein weiterer Bolzen an seinem Gesicht vorüberzischte und raschelnd im Gebüsch einschlug. Der Schuss war aus Richtung des Schuppens gekommen, über eine Distanz von mindestens dreißig Fuß, was bedeutete, dass das »Rußgesicht« ein verdammt guter Schütze sein musste. Doch noch bevor der Mann einen neuen Bolzen auflegen konnte, hatte Falk die rettende Tonne erreicht und sich dahinter niedergeworfen. Darum bemüht, seinen fliegenden Atem unter Kontrolle zu bekommen, guckte er vorsichtig hinter dem Fass hervor und musterte das vor ihm liegende Gelände.
Er wog den Dolch in seiner Hand. Der Platz hinter der Tonne war gut gewählt. Wollte der schwarze Teufel ihn weiter attackieren, würde er sein Versteck beim Schuppen verlassen und herankommen müssen. Ungeschützt und bar jeder Deckungsmöglichkeit, würde er ein gutes Ziel für einen wohlgesetzten Dolchwurf abgeben. Was das sichere Schleudern der Waffe anging, machte Falk so schnell niemand etwas vor.
Dann aber geschah etwas, was ihn maßlos verblüffte. Hinter einem beim Schuppen aufgeschichteten Holzstoß schoss plötzlich ein dunkler Schatten hervor und rannte mit weit ausholenden Sprüngen in Richtung Fluss!
Das »Rußgesicht«. Er gab Fersengeld.
Noch fragte sich Falk, was den Schurken zur plötzlichen Aufgabe seines rätselhaften Vorhabens bewegt haben mochte, als er entferntes Gemurmel hörte. Er fuhr herum – und nahm aufatmend zur Kenntnis, wie mehrere Männer am Rand des Anwesens entlangritten. Gleich darauf bemerkte er einen zweirädrigen Karren, der von einem kräftigen Gaul gezogen wurde. Die Knechte des Stadtrichters waren gekommen, um den Leichnam Gundel Schreyers zu bergen. Offenbar hatte das Rußgesicht die Männer kommen sehen und daraufhin beschlossen, das Weite zu suchen.
Für einen kurzen Moment war Falk geneigt, dem Flüchtenden nachzusetzen, verzichtete jedoch darauf, als ihm klar wurde, dass er damit ein nicht abzuschätzendes Risiko einging. Im dichten Ufergebüsch versteckt, würde ihn der Mann, so er sich näherte, wie einen Hasen abschießen und sich dann, ein Stück weiter flussaufwärts, seelenruhig zurück in den Wald schlagen.
Absurd. Es ist alles völlig absurd.
Schlagartig wurde Falk das Unwirkliche der Situation bewusst. Ein dem Kerker entsprungener Waldensermeister, der sich das Gesicht mit Ruß schwärzte, angeblich eine Frau vergewaltigt hatte und über eine äußerst seltene, aber überaus tödliche Waffe verfügte, wollte ihm, Falk von Falkenstein – beauftragt, den Mord an einer Frau aufzuklären und gegenwärtig vom Regen durchnässt vor einer einsamen Hütte stehend, in welcher der Leichnam eines ermordeten Bienenzüchters lag – ans Leder.
Es war zum Totlachen. Oder zum Verzweifeln. Je nachdem, wie man die Sache betrachtete.
»Der Stadtrichter schickt uns, die Leiche zu holen, Herr. Außerdem sollen wir Euch ausrichten, dass ein Schreiben Euer harrt. Ein Bote aus Melk überbrachte es«, unterbrach einer der Knechte, die inzwischen herangekommen waren, das Grübeln Falks.
»So?« Er runzelte die Brauen. Das wurde ja immer besser. Ein an ihn gerichtetes Schreiben aus Melk. Ein schneller Reiter benötigte für die Strecke Melk – Steyr etwa einen Tag. Was gab es Wichtiges, das man ihm mitzuteilen hatte? So wichtig, dass der Bote offenbar die Nacht hindurch geritten war und schon in aller Herrgottsfrühe an die Pforte des stadtrichterlichen Hauses geklopft hatte, um das Schreiben loszuwerden? Vor wenigen Tagen erst war er von seiner Reise nach Melk zurückgekehrt, die er unternommen hatte, um dem dortigen Prior Bodo von Schachnitz einen Besuch abzustatten. Allerdings hatte dieser ihn nicht empfangen können, da er schwer krank darniederlag. Hing das Schreiben damit zusammen? Falks Erinnerungen wanderten viele Jahre zurück. Einen großen Teil seines Lebens hatte er in der Umgebung des Stiftes zu Melk zugebracht; Jahre, die ihn geprägt und sein Schicksal mitbestimmt hatten, bevor er vor drei Jahren Christine kennengelernt und mit ihr nach Salerno gezogen war.
Achselzuckend machte sich Falk auf den Weg zu seinem Rappen.
In einigen Stunden würde er mehr wissen.