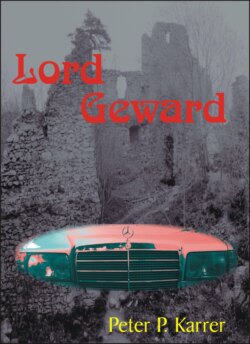Читать книгу Lord Geward - Peter P. Karrer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление8. Leben
Kalter Regen schreckt mich auf.
Instinktiv greife ich nach meinem Umhang, der nass und muffig neben mir in einer kleinen Pfütze liegt. Verwirrt ziehe ich ihn über und lege auch mein Schwert, in zwischenzeitlich gewohnter Routine, an.
Ganz allmählich finden meine Gedanken einen leichten Faden der Erinnerung an die tödliche Trockenheit, die Hitze und die höllischen Qualen der Sonne. Ich untersuche meine Arme, entblöße meine Schultern und Beine: nicht die kleinste Verbrennung. Die tiefen Narben, welche die Sonnenstrahlen unbarmherzig in mein Fleisch fraßen... nichts mehr davon zu sehen. Sicher, die Haut ist aufgequollen, aber nur vom vielen Regen. Gott weiß, wie lang ich hier schon liege.
War alles nur ein weiteres Kapitel, in einem teuflischen Albtraum?
Wer schreibt das Drehbuch zu diesem Horror?
Mit beiden Händen schöpfe ich vorsichtig, ohne Sand und Steinchen mitzuschwemmen, aus einer größeren Wasserlache frisches Regenwasser. Nach den ersten Schlucken bin ich sicher. Diese Kehle war noch vor kurzen staubtrocken und dieser Körper nahe am verdursten und vor der totalen Austrocknung.
Die Gedanken klären sich und ich bin sicher, ich bin wieder in einer neuen Welt. Offensichtlich springe ich zwischen Welten wie Blätter im Sturm; hin und hergetragen von teuflischen Winden, die ich nicht begreife. Ein Reisender ohne Ziel.
Mein Großvater führte Touristen von Zimmer zu Zimmer. Bin ich ein Reisender, der von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit geworfen wird? Ein Pauschaltourist, der alles sehen, alles ertragen muss ohne seine Reise abbrechen oder stornieren zu können? Ohne die Möglichkeit aus dem rasenden Horrorbus auszusteigen, um einfach nach Hause gehen zu können.
Auch wenn ich aussteigen könnte? Wo oder was ist mein Zuhause, in das ich heimkehren könnte? In die wilde Landschaft Usbekistans, ins ewige Eis Grönlands? Soll ich lieber mit König Artus in die Schlacht ziehen oder lange Tage im Büro verbringen, um die horrenden Unterhaltskosten für meinen Daimler aufzubringen?
Meine Gedanken schließen den Kreis und ich bin wieder am Anfang.
Wer bin ich? Wo bin ich? Was bin ich?
Die drei großen „W“ - Zeichen meiner Verzweiflung. An einem anderen Ort oder vielleicht nur in einer anderen Zeit - nicht einmal das weiß ich - stehen sie für World Wide Web. Ich aber kann nur Verzweiflung, Wut und Einsamkeit darin sehen.
Es regnet immer noch still und ergiebig.
Mein Umhang riecht streng nach schmutzigem, schwitzigen Mensch. Den Geruch habe ich scheinbar aus der letzten Sehenswürdigkeit, als Souvenirjäger, mitgebracht.
An die alte Gewohnheit anknüpfend und um überhaupt irgendetwas zu tun, mache ich mich auf die Beine, die neue Welt zu erkunden.
Die neue Welt: eine wunderschöne Berglandschaft, den Südtiroler Alpen nicht unähnlich, bietet zumindest genug Wasser und die Ernährungsfrage in dieser üppigen Vegetation dürfte keine Schwierigkeiten bereiten.
Ich muss lernen, mein Dasein als Wanderer zu akzeptieren. Immer die gleiche Prozedur: Erwachen, orientieren, Wasser und Verpflegung organisieren. Eigentlich doch kein schlechtes Leben? Wenn ich auch zugeben muss, der Wüstenaufenthalt war nicht nach meinem Geschmack und sollte beim Reiseveranstalter reklamiert werden.
Reiseveranstalter? Wer organisiert solche Trips?
Mich meines üblen Geruchs erinnernd, suche ich einen der unzähligen kleinen Bäche, reinige meine spärliche Kleidung, wasche mich selbst und unterziehe auch meine Stiefel einer gründlichen Reinigung. Das Fassungsvermögen meines Schuhwerks ist riesig. Ich fülle jeden Stiefel mehrmals mit Wasser und bewundere beim Ausgießen die beträchtliche Menge Sand, die mit ausgeschwemmt wird. Nach einigen Wiederholungen der Prozedur und gleichzeitigem wenden meines Umhanges, beschließe ich der Reinlichkeit Genüge getan zu haben.
Um nicht noch länger nackt und frierend am Bach zu stehen, in der vergeblichen Hoffnung der Regen könnte aufhören, ziehe ich meine tropfenden Sachen wieder an. Der Umhang, schwer wie eine Rüstung, ist nach meiner Waschaktion endgültig durch und durch nass.
Eine nasse Spur hinter mir her ziehend, gehe ich los.
Erst nach einiger Zeit bemerke ich, wie ich gedankenlos einem kleinen Pfad folge. Ein Waldweg, schwer zu erkennen, aber eindeutig ein Weg, mindestens ein Trampelpfad. Ich blicke mich um und erkenne zweifelsfrei einen Weg: zugewachsen, teilweise gras- und moosbedeckt, aber ein Weg. Leider hat der Regen, der langsam leichter wird, alle weiteren Spuren verwaschen. Ich hoffe, so viel von Waldtieren zu wissen, dass diese keine so gleichmäßig ausgetretenen Pfade trampeln und eher einzeln, versetzt, um nicht aufzufallen, durch den Wald streifen.
Ich bin nicht mehr allein, hier muss es noch andere Menschen geben oder gegeben haben.
Wieder der Sicherheit gebende Griff an mein Schwert. Alles in Ordnung, es sitzt fest an meiner Seite und wird mich beschützen. Die einzige verbleibende Frage: »In welcher Richtung soll ich dem Pfad folgen?« Nachdem ich bereits geraume Zeit, rein zufällig der einen Richtung folgte, ist es sicher die beste Lösung sie beizubehalten.
Eine Stunde später hört der Regen auf. Nur der Nebel in den Niederungen und die tropfenden Bäume zeugen noch von den vergangenen Regengüssen. Die noch feuchte Luft ist kalt, aber angenehm erfrischend und weckt auf wundersame Weise die vergessenen Lebensgeister.
Nach einer scharfen Biegung um einen etwa acht Meter hohen Felsvorsprung offenbart sich mir ein Ausblick, der nicht in Worte zu fassen ist.
Ich blicke in eine achtzig bis einhundert Meter tiefe Schlucht, am Grund ein reißender Wildbach. Das Wasser muss enorme Kräfte besitzen. Vereinzelt mühen sich armdicke Baumstämme gegen die Fluten. In der starken Strömung rollen Steine größer als Fußbälle wie kleine Kieselsteine. Alleine die Geräuschkulisse ist furchteinflössend. Schlucht aufwärts thront ein riesiges, sicher mehrere tausende Meter hohes Bergmassiv mit einer strahlenden, weißen Haube aus Schnee oder Eis.
Erschaudernd stelle ich mir die Urgewalten während der Schneeschmelze vor, die diesen bereits jetzt beachtlichen Bergbach in einen riesigen, alles mit sich reißenden Strom aus Wasser und Geröll verwandeln.
Einbildung oder Wunschgedanke, ich glaube einen Vogel zu hören.
Ja, jetzt wieder, ganz deutlich, trotz des tosenden Wassers, eine Vogelstimme, viele Vogelstimmen.
Mein Gott, hier erwacht das Leben und ich wandere genau hinein, in die Welt des Lebens. Nach wochenlanger einsamer Wanderschaft, endlich Leben. Nicht mehr alleine, der Wald ist voller Leben.
Mein Gott, diese Welt lebt.
Nie in meinem jämmerlichen Dasein war ich so glücklich, einen Vogel zu hören. Ich beobachte den Wald auf der anderen Seite der Schlucht, suche den Vogel, der das Leben verkündet, will das Leben nicht nur hören, will es auch sehen. Ja, am Ende eines Astes, auf einer kleinen, aber dicht gewachsenen Tanne, bewegt sich etwas. Da ist es, da ist das Leben.
Nie habe ich mich für Vögel interessiert, heute bereue ich es. Ich kenne nicht einmal seinen Namen, aber er ist der Bote des Lebens.
Der Bote genießt die frischen, honigsüßen, noch feuchten Knospen. Pickt, reißt und fliegt zum nächsten Ast, um wieder zu picken. Ich entdecke immer mehr der kleinen Lebensboten. Der ganze Wald ist voll davon. Ich kann mich gar nicht satt sehen.
Erst jetzt begreife ich, wie ich das Leben vermisste.
Meine Augen werden feucht. Freudentränen bahnen sich ihren Weg über beide Wangen. Ich setze mich auf einen noch nassen Stein und lasse meinen Körper das Leben genießen.
Aber auch auf dieser Seite der Schlucht gibt es Leben. Vor mir kämpft eine haselnussbraune Waldameise gegen die Last einer mindestens fünfmal so großen Fliege. Ich blicke auf den Waldboden, zwischen meinen Beinen und überall wimmelt es von Leben.
Es ist herrlich.
Die Sonne hat ihre Reise soweit fortgesetzt und jetzt berühren auch mich die ersten wärmenden Strahlen. Ich streichle den kalten Fels neben mir, als wollten meine Finger das Leben berühren und rieche das feuchte, eisenhaltige Mineral.
Zum erstenmal lebe ich... lebe ich wirklich.
Hier muss das Paradies sein!
Zufrieden schließe ich die nassen Augen. Eine letzte Träne bahnt sich ihren Weg, vorbei an meiner schniefenden Nase nach unten. Ich denke nichts mehr, fühle nur das warme Licht der Sonne, das langsam Stiefel und Umhang trocknet, höre das Wasser, die Vögel und immer wieder das Leben.
Die Zeit vergeht und erst gegen Abend erwache ich ohne die gewohnte Angst vor den hässlichen Tagträumen aus einem tiefen, erholsamen Schlaf. Mein Hunger erinnert mich daran, bis auf ein paar handvoll Wasser, noch nichts zu mir genommen zu haben.
In der durch Wald und Berge abgedunkelten Abendsonne entdecke ich in nächster Umgebung mehrere prall gefüllte Brombeersträucher. Die Früchte sind nicht nur angenehm süß, sondern mir auch bestens vertraut. Beeren, die ich mit Namen kenne; Beeren, die ich sorglos, ohne die Angst an giftige Früchte, genießen kann. Die Kerne, die meine vernachlässigten Zahnzwischenräume füllen, erinnern mich an meine Schulzeit, an die endlosen Ermahnungen: »Pflege Deine Zähne ordentlich, sie müssen ein Leben lang halten!« Ach hätte ich mich doch bloß daran gehalten. Ein Königreich für einen Zahnstocher. Die Kerne sind wirklich lästig. Mit Zunge und kleinem Finger versuche ich die kleinen Quälgeister loszuwerden.
Erst jetzt fällt mir auf, die Brombeeren besitzen keine Stacheln. Oder sind die Stacheln Dornen? Wieder diese lästige und völlig überflüssige Frage, die seit langem in meinem Kopf geistert. Egal... wildwachsende Brombeeren haben doch immer Stacheln? Aber diese? Es müssen kultivierte Sträucher sein. Ich suche die Ranken ab, aber weit und breit keine Stacheln. Die kirschgroßen Früchte sind für wilden Wuchs auch viel zu groß. Bei genauerer Betrachtung ist auch die Anordnung der Stauden zu gleichmäßig. Trotz des scheinbaren Wildwuchses erkenne ich ein geometrisches Pflanzsystem, das vor langer Zeit gut geplant wurde.
Es müssen hier, wenn auch vor längerer Zeit, Menschen gelebt haben. Die Bewohner waren sicher keine Wanderer, wie ich. Nomaden hätten nichts gepflanzt, das nach Jahren erst Früchte getragen hätte.
Ich mache mich auf, weitere Spuren im immer dunkler werdenden Abend zu suchen. Kurze Zeit später, gebe ich jedoch auf. Es wird zu dunkel.
Müde vom Staunen und Entdecken, suche ich mir bei fast völliger Dunkelheit einen trockenen Unterschlupf für die Nacht. Ein zwei mal drei Meter breiter Felsvorsprung erscheint mir ideal und vermittelt so etwas wie Heimat, Sicherheit und Geborgenheit.
Eingerollt in meinen Umhang, geschützt vor Regen und Kälte, schlafe ich ohne weitere Gedanken in Minuten ein.
Noch in frühster Morgendämmerung werde ich von tausenden Vogelstimmen, die den Tag begrüßen, geweckt. Ich bin wunderbar ausgeschlafen, nur meine Muskeln und Sehnen erinnern mich schmerzvoll an eine lange, auf hartem Boden verbrachte Nacht.
Zu sehr an den Lagerplatz am See, mit seinem weichen Sand und dem duftenden Moos unter den Birken, gewöhnt, bin ich mir sicher, für die nächste Nacht ein Lager auf weichem Waldboden zu suchen oder wenn es regnet, eine Höhle mit weichem Laub auszulegen.
Zum Frühstück gönne ich mir Beeren und Nüsse. Einige der Nüsse, sie müssen wohl vom Vorjahr sein, sind bereits vertrocknet, die restlichen aber ausgezeichnet. Zum erstenmal seit Wochen arbeiten meine Zähne, mahlen, quetschen und spalten die harte, ungewohnte Kost. Es ist fast unglaublich: meine Kaumuskulatur ist die Arbeit nicht mehr gewöhnt und beginnt bereits nach wenigen Nüssen zu ermüden und zu schmerzen! Trotz Hunger, der Kaumuskel ist am Ende.
Behutsam gewinne ich die Gewissheit wieder in einer lebenden, nicht in einer sich immer endlos wiederholenden Welt zu sein. Eine Welt, die lebt, aber in der man sich auch um seinen Hunger selbst kümmern muss. Ich ernte alle noch erreichbaren Nüsse und fülle damit meine Taschen. Die linke ist prall gefüllt, die rechte nur leicht mit einer handvoll Nüsse.
In Erinnerung an alte Bergfilme habe ich eine erste, echte Verwendung für mein Schwert. Aus einem hohen Nussstrauch hacke ich einen am Ende vier Zentimeter dicken Ast, säubere ihn von den wenigen Seitentrieben und betrachte stolz meinen neuen Wanderstock.
Wieder im Leben, möchte ich auch einen Kalender führen. Dazu ritze ich mit meinem Schwert, den Griff in den Bauch gestemmt, die Spitze in den Boden gerammt, meinen Wanderstock in beiden Händen haltend, zwei Kerben für die beiden Morgen, die ich wieder lebe, in das weiche Holz.
Ausgerüstet wie ein mittelalterlicher Söldner, mit Schwert und Stock, folge ich dem Weg in Richtung Tal.
Nach einer Stunde lässt mich ein Geräusch aufhorchen. Ein gepresster Laut, der mich an Alphörner erinnert. Mangels waidmännischer Erfahrung kann ich den Schrei nicht zuordnen. Da ich mir sicher bin, den Ruf von der anderen Seite der Schlucht gehört zu haben, gehe ich von keiner unmittelbaren Gefahr aus und beruhige mich, zu meiner eigenen Überraschung, wieder sehr schnell.
Zur Mittagszeit, Zufall oder nicht, finde ich einige Bäume mit wilden Birnen. Die Birnen, nicht größer als Zwetschgen, scheinen auch vom Vorjahr zu sein. Sie sind schrumpelig und vertrocknet. Die Stängel an denen sie hängen, befördern sicherlich schon lange keinen Saft mehr. Bemerkenswerterweise finde ich keine fauligen Früchte... nur ordentlich getrocknete.
Ich probiere eine der zähen Früchte. Sie sind hart aber durchaus noch genießbar, eigentlich sogar ganz lecker, wenn man nur lange genug darauf herumkaut. Ein ausgezeichnetes Training für meine schlaffen Kaumuskeln. Ich hätte nie gedacht, einmal meine Kaumuskeln trainieren zu müssen.
Ich fülle meine rechte Tasche bis zum Rand voll. Ein Hamster hätte sicher seine Freude an mir.
Weiter geht es in eine ungewisse Zukunft.
In Gedanken verloren kaue ich unterwegs eine Birne nach der anderen, nur unterbrochen durch einige Nüsse, so lange bis mich der Anblick des Unvorstellbaren den letzten Bissen beinahe unzerkaut verschlucken lässt.
Ich zwinkere zweimal mit den Augen, als traue ich ihnen nicht. Wie vom Blitz getroffen erstarre ich und vergesse sogar die letzten Birnenreste hinunterzuschlucken.
Keine fünfzig Meter vor mir sehe ich den Beweis vor dem ich immer Angst hatte und den ich doch so lange herbeisehnte: den Beweis, nicht der einzige Mensch zu sein!!!
Immer noch misstraue ich meinen Augen und kann es einfach nicht glauben oder weigere mich, es zu glauben. Ich kann es nicht sagen.
Ein Bauwerk, so faszinierend wie auch beängstigend, liegt unmittelbar vor mir. Durchgängig, soweit ich sehen kann, aus Holz, überspannt eine kleine Brücke das Tal. Eindeutig ein Gebilde von Menschenhand. Ängstlich und überrascht, bleibe ich immer noch wie versteinert stehen, überlege, gehe einige Schritte vorwärts, stoppe wieder, gehe wieder etwas zurück und gehe schließlich gebückt, übervorsichtig, ohne einen Laut zu verursachen weiter. Diesmal achte ich darauf mit meinem Schwert nicht wieder einen Felsen zu touchieren und mich zu verraten.
Die Brücke scheint alt zu sein, keine zwei Meter breit, das Geländer knapp einen Meter hoch. Die Brücke ist grobschlächtig, aber sie scheint durchaus solide. Das Geländer ist von tiefen Rissen im Holz gezeichnet. Die dicht mit feuchtem Moos bedeckten Bodenbretter wirken im Gegensatz zur restlichen Konstruktion verfault, brüchig und wenig vertrauenserweckend.
Die dichte und unbeschädigte Moosdecke beweist mir, diese Bretter betrat schon lange kein menschlicher Fuß mehr. Meine Nervosität verschwindet, als wäre sie nie da gewesen.
Der Weg ins Tal geht auf der anderen Seite weiter. Das bedeutet, um weiterzukommen, muss ich diesen Übergang benutzen.
Hin- und hergerissen, zwischen den Gedanken die Brücke zu benutzen oder umzukehren, taste ich mit dem rechten Fuß nach vorne. Mit zur Seite gestreckten Armen umklammere ich mit beiden Händen die Brückenköpfe. Bereits unter dem leichten Druck meines Fußes, geschweige meines Körpergewichtes, biegen sich die Bodenbretter gefährlich nach unten.
Erschreckt springe ich zurück. Hier ist kein Weiterkommen!
Neuen Mut sammelnd rüttle ich nacheinander an beiden Brückenpfeilern und an dem erreichbaren Geländer. Fest... keine Bewegung... nur die verdammten Bodenbretter sind marode.
Mein durch das neue Leben erwachter Abenteuerdrang besiegt schließlich jede Furcht und ich balanciere mit dem Körper Richtung Tal quer auf den Seitenbalken über die Brücke.
Alle paar Meter trete ich vorsichtig nach hinten und überprüfe dadurch die Qualität der Bodenbretter. Nach dem diese zur Mitte eher noch schlechter werden, finde ich mich damit ab, die Schlucht quer, mit zitternden Knien, über dem Höllenwasser zu überwinden. Obwohl alles sicher nicht länger als ein oder zwei Minuten dauert, erscheint mir das Überqueren wie eine nicht endende Psychofolter. Nach einer Weile über dem tosenden, mörderischen Wasser denke ich daran, es wäre wohl besser gewesen, nicht ins Tal, sondern bergauf zu sehen, aber egal, ich kann mich nicht umdrehen und in wenigen Metern ist alles geschafft und das Martyrium beendet.
Glücklich auf der anderen Seite angekommen und festen Boden unter den Füssen, atme ich tief durch, strecke mich und warte das Ende des Zitterns meiner Knie ab.
Jetzt spüre ich den Schweiß, nicht den der Anstrengung, einfach den kalten Schweiß der Angst, der in Strömen über meinen Rücken und unter meinen Achseln fließt. Ich öffne meinen Umhang, um ihn aber bald wieder, nachdem mich fröstelt, zu schließen.
Langsam beginne ich, mich in der Nähe der Brücke unwohl zu fühlen. Nicht wegen der alten, zum Teil morschen Konstruktion, die ich glücklicherweise hinter mir habe, sondern der Tatsache, die Überführung ist das Symbol dafür, nicht alleine zu sein.
Gerne würde ich wieder Menschen treffen, sogar der unheimliche Besucher Abraham Lincoln wäre mir recht. Trotzdem habe ich Angst, nach so langer Zeit andere Menschen zu treffen. Was, wenn sie mir feindlich gesinnt sind? Oder aufgrund meiner Waffe mich als Gegner und Feind sehen?
Ich ertappe mich dabei mein Schwert verstecken zu wollen, was aber alleine schon wegen seiner Größe unmöglich ist.
Ich wandere weiter, weg von der Brücke, weg von der Angst, das Böse zu treffen.
Gegen Abend öffnet sich mir ein offenes, freies Tal mit saftigen, grünen Wiesen und einzelnen, große Bäumen, vermutlich Eichen oder etwas Ähnliches.
Die letzten, windzerzausten Fichten verabschieden mich aus dem Bergwald und jetzt lobe ich mich selbst, einen so vorzüglichen Wanderstock geschnitten zu haben. Wenn er im Bergwald schon ausgezeichnet war, hier in den nassen, steilen Wiesen gibt er mir unschätzbaren Halt. Bei jedem Schritt nach unten stütze ich mich mit ihm ab und entlaste damit meine schmerzenden Knie.
Als Bergwanderer scheine ich nicht besonders zu taugen.
Am Morgen, als ich noch an die unendliche Wildnis der Berge glaubte, wäre mir die Idee eine Brücke zu finden, absurd vorgekommen. Aber was ich jetzt sehe, übersteigt alle meine Vorstellungen.
Am Ende des Tales auf einem kleinen Hügel träume ich schon wieder oder werde ich doch verrückt? Aber ich hätte es nach der Brücke doch wissen müssen: Ein Haus, besser eine Hütte!
Mein Gott, ich kann es nicht glauben!
Ein Blockhaus, in bester Karl-May-Manier, aus massiven Baumstämmen, einer Festung gleich.
Wieder stoppe ich, dieses Mal ducke ich mich nicht, ich bin viel zu weit weg. Nachdem der Abend immer schneller Einzug hält, plane ich hier die Nacht zu verbringen, natürlich ohne Feuer zu machen, um am Morgen ausgeruht und bei gutem Licht die Hütte zu erkunden.
Weit nach Einbruch der Dunkelheit liege ich immer noch wach. Wirre Phantasien quälen mich. Was, wenn ich morgen, kurz vor dem Ziel, wieder in einer anderen Welt erwache, in einer Wüste ohne Wasser oder in einem endlos tödlichen Meer, zum Ertrinken verurteilt. Immer wieder kreisen fantastische Fiktionen um die Hütte. Ich sehe Fleischreste auf blanken, weißen Skeletten, welche die Hütte bewachen. Denke an Goldgräber, die in blindem Wahn ihre Mine verteidigen und auf jeden Besucher oder Eindringling ihr tödliches Schrot abgeben. Denke an Pest und Cholera, welche die Bewohner verzehrte. Sehe kleine Kinder, die weinend neben ihren toten Eltern liegen, gnadenlos dem Hungertod ausgeliefert.
Immer wieder schlafe ich ein, um kurz darauf aus einem neuen Horrortraum gerissen zu werden. Natürliche Geräusche, die mich die ganzen Nächte davor nicht störten, machen mir plötzlich Angst. Verzweifelt kaue ich einige Nüsse, um Abstand von den Träumen zu bekommen, nicke ein und schrecke wieder auf. Die Nacht scheint endlos zu sein.
Kalt schwitzend erwache ich im frühen Morgengrauen. Endlich hell, der Tag und das Leben haben mich wieder.
Der erste Blick zur Hütte zeigt mir in beruhigender Sanftheit: Keine neue Welt, kein Albtraum! - Die Nacht der zusammenphantasierten Schrecken ist vorbei. Das lautstarke Einsetzen der nicht mehr so zahlreichen Vogelstimmen beruhigt mich endgültig.
Glücklich darüber genug Vorräte mitgenommen zu haben, frühstücke ich kurz und bin rundum mit mir zufrieden. Mit jeder gekauten Nuss steigt meine Entdeckerfreude. Noch die letzten Nusssplitter zwischen den Zähnen balancierend, mache ich mich auf den Weg ins Ungewisse.
Je näher ich dem Blockhaus komme, um so deutlicher erkenne ich, es ist nicht nur leer, sondern auch mindestens so lange wie die Brücke unbenutzt.
Die letzte Anspannung verschwindet aus meinem Körper und ich wandere immer zügiger, singend und pfeifend wie der glücklichste Sommerfrischler Richtung Hütte.
Das Dach aus schweren Holzschindeln scheint, zumindest aus der Entfernung betrachtet, intakt und dicht zu sein. Auch Fenster und Türe dürften in Ordnung sein. Die Treppe an der eingebrochenen Veranda dagegen ist nur noch in Fragmenten erhalten.
Der angrenzende Holzverschlag, vermutlich früher einmal eine Scheune oder Stall, lehnt sich derart zur Seite, dass er nur noch durch die Hilfe einer nebenstehenden Eiche am Einsturz gehindert wird.
Fünf Meter vor der Veranda ist ein Brunnen. Der danebenstehende hölzerne Trog ist kaum mehr als solcher zu erkennen.
Ein Fachmann der Spurensicherung der Kriminalpolizei hätte sicher bestimmen können, wie lange das Anwesen unbewohnt ist. Ich weiß nicht einmal, wie alt ein Blockhaus werden kann, wie lange der Verfall dauert; zehn Jahre oder hundert Jahre, ich habe keine Ahnung.
Die aus der Entfernung intakt aussehenden Fenster zeigen sich jetzt beim Näherkommen als armselige Überbleibsel aus Glassplittern und Spinnweben. Die Haustüre lehnt nur noch im Türstock, die eisernen Scharniere haben längst den Kampf gegen Wind und Regen verloren und sich in besten Rost verwandelt.
Jedenfalls kann ich mir wenigstens sicher sein: Hier lebt seit langem niemand mehr und auch für mich besteht keine Gefahr vor unbekannten Gegnern.
Mit der größten Spannung eines Entdeckers - die ich zum letzten Mal in meiner Kindheit empfand, als ich mit Freunden ein leerstehendes Haus nach Schätzen und Geheimgängen durchsuchte, letztendlich aber doch nur die Abfälle und das Lager mehrerer Landstreicher fand - blicke ich durch eines der Fenster an der Vorderseite.
Die Hütte besteht aus einem einzigen Raum, beherrscht durch einen über eineinhalb Meter breiten, offenen Kamin, oder besser einer Feuerstelle, die auch als Kochstelle diente.
Die Reste einer schweren Kette in der Mitte der Feuerstelle, zum Aufhängen eines Kessels, erinnert mich daran, wie angenehm wieder einmal eine warme Mahlzeit wäre. Sogar ein Eintopf, den ich mein ganzes Leben lang verschmähte und verachtete, wäre jetzt ein königliches Mahl. Alleine der Gedanke an eine warme Mahlzeit füllt meinen Mund mit Wasser und ich muss es in großen Portionen hinunterschlucken.
Vor meinen Augen sehe ich eine Bauernfamilie mit fünf oder eher acht Kinder, die mit freudiger Erwartung und großen, glänzenden Augen das Festmahl aus Kartoffeleintopf, Dörrfleisch und frisch gebackenem Brot herbeifiebern und den dampfenden Kessel keinen Augenblick aus den Augen verlieren. Einen Bauern, der das Brot bricht und verteilt. Mein Gott jetzt sehe ich auch noch die Bäuerin, die jedem einen vollen, dampfenden Holzteller, auf den Tisch stellt. Eine warme Mahlzeit: mein Traum.
Wieder schlucke ich das Wasser in meinem Mund hinunter, dieses Mal aber bedeutend bedrückter.
Ich reiße mich aus den traurigen Gedanken los und öffne oder besser stelle die Haustüre zur Seite und betrete seit Wochen das erstemal wieder ein von Menschenhand gebautes Haus.
Das erste Knacken der Bodenbretter empfinde ich als derart unnatürlich, dass ich sofort erschreckt zurücktrete und es mir erst im zweiten Anlauf gelingt den Raum zu betreten.
Ich erwarte einen muffigen Geruch, aber hier ist die Luft genauso frisch wie draußen, was mich nach weiterer Überlegung auch nicht wundert. Die zerstörten Fenster sorgen für eine mehr als ausreichende Luftzufuhr. Der einzige Geruch, den ich aufnehme ist der feuchte, aber nicht faulige des immer noch vom Regen nassen Holzes.
Der rohe Fußboden ist in ausgezeichnetem Zustand. Offensichtlich ist das Dach im Großen und Ganzen dicht. Ein Blick nach oben zeigt mir nur wenige, durchscheinende Stellen. Ich hätte nie gedacht; ein Holzdach würde dicht halten, während Türscharniere aus Eisen, aus ihren Verankerungen rosten.
Ich denke an den alten, aber trotzdem nicht weniger überflüssigen, dummen Spruch: »Man lernt nie aus.«
Links von mir, Richtung Westen, gibt es ein offenes Regal, in dem unter Bergen von Laub und Spinnweben ordentlich mehrere Krüge, Schüsseln und Teller gestapelt sind. Darunter finde ich - mein Entdeckerdrang ist kaum noch zu bremsen - einen riesigen, über und über mit grüner Patina bedeckten, Kupferkessel. Der Kessel, der früher sicher herrlich heißen Eintopf enthielt, ist jetzt ein Massengrab für unzählige Insekten.
Gegenüber steht ein schwerer Tisch, umrahmt von fünf Stühlen. Einer der Stühle, direkt unter dem offenen Fenster, hat keine Sitzfläche mehr und auch die Lehne hängt verrottet schräg nach vorne auf den Tisch. Das leichte Berühren lässt ihn, begleitet von einem dumpfen Schlag und einer Staubwolke, in sich zusammenbrechen.
Der Stuhl, nähe der Raummitte, erscheint mir am tragfähigsten. Mit einer Handbewegung wische ich Laub, Staub, Blätter und Blüten beiseite und setze mich übervorsichtig. Der Stuhl ächzt unter der neuen, ungewohnten Last; aber er hält.
Nach wochenlangem Leben auf der Erde, fühle ich mich wie ein König auf seinem Thron. Die Geräusche der Anstrengung, die mein neuer Thron von sich gibt, als ich mich auch noch gegen die Lehne abstütze, mindern das Wohlgefühl der Zufriedenheit nicht im mindesten und ermahnen mich nur mein Gewicht besser zu verteilen.
Minutenlang schwebe ich auf Wolken. Langsam lasse ich meinen Blick kreisen und entdecke immer mehr Dinge in dem kleinen Raum.
Die Zivilisation hat mich wieder.
Sicher kein DVD Spieler, kein Kabelfernsehen, nicht einmal elektrisches Licht oder fließendes Wasser, aber doch ein richtiges Zuhause, ein Heim von Menschenhand gebaut. Meinen Gedanken nachhängend, döse ich bis zum Abend.
Mein Nachtlager errichte ich mir direkt vor dem steinernen Kamin, der sicher kalt ist, aber irgendwie beruhigend wirkt. Obwohl sich dieses Lager auf dem harten Fußboden kaum von denen der letzten Zeit unterscheidet, schlafe ich doch entspannt, traumlos, ruhig und ohne ein einziges Mal aufzuwachen tief durch.
Als ich am nächsten Tag erwache, ist es beinahe schon wieder Mittag. Die dunkle Geborgenheit der Hütte ließ mich nicht früher erwachen. Bereits nach der ersten Nacht fühle ich mich wie ein stolzer Schlossherr.
Nach meinem kleinen Apartment, in einer fast vergessenen Welt, bin ich jetzt stolzer Hausbesitzer.
Nein, in meine alte Welt will ich nicht mehr zurück. Hier bin ich frei. „Abenteuer und Freiheit.“
Nichts vermisse ich aus der alten Welt. Nicht einmal mehr den alten Daimler. Mir fällt ein, mangels Tabak seit Wochen Nichtraucher zu sein. Ich, der nie aufhören konnte, der alles Mögliche von Tabletten über Pflaster bis Hypnose versuchte, ein Vermögen für sinnlose Therapien ausgab und ich, der keinen Tag ohne zwei bis drei Schachteln auskam, ich, ich... Nichtraucher, es ist kaum zu glauben!
Ich lache laut auf.
Lache ausgiebig und immer lauter. Nicht das Lachen eines Irren, sondern nur das einfach und ungestüme Lachen eines glücklichen und zufriedenen Kindes.
Ich glaube, nicht einmal als Kind so gelacht zu haben. Als Kind hieß es immer: »Sei nicht so kindisch!« oder »Sei nicht so albern!«, später war lautes Lachen nicht »angebracht« oder »so etwas gehört sich nicht« ich höre noch die Spötter »Der lacht ja wie ein Esel.«
Heute, in meiner neuen Welt, lache ich so lange und so laut, wie ich will.
Ich, der lachende Esel; ich lache und meine Spötter sind eingesperrt in klimatisierte Büroräume. Jetzt lache ich sie alle aus und ich genieße es von ganzem Herzen.
Lachen sie auch? Fühlen sie auch das Glück der Freiheit?
Sicher nicht!
Nein, nie wieder möchte ich in diese Welt zurück! Nie wieder!
Immer noch laut lachend, gehe ich nach draußen. Die Regenwolken haben endgültig den Kampf gegen die Sonne verloren und ich genieße die warmen Strahlen auf meiner nackten Haut. Mein Blick schwenkt über den Horizont. Ein wunderbares, ein weites Land, mein Land. Tief sauge ich die reine Luft durch die Nase in die hinterste Kammer meiner Lunge und blase sie mit gezückten Lippen wieder aus.
Systematisch verschaffe ich mir einen Überblick über die Schäden am Haus und dem Seitengebäude.
In der verfallenen Scheune entdecke ich in einer alten, schmucklosen Truhe einige Werkzeuge. Einen stark angerosteten Hammer - dessen Stiel von Holzwürmern durchlöchert und vom Regenwasser aufgeweicht ist - zerre ich als erstes an die Oberfläche. Ich breche ohne große Mühe mit einer kleinen Drehung den Stiel heraus und lege den rostigen Eisenklotz beiseite. Tief in der Truhe verborgen, fördere ich einen Klumpen diverser Eisenteile, Zangen oder ähnliches nach oben. Für diesen traurigen, ineinander gerosteten Haufen habe ich leider keine Verwendung und ich lasse ihn enttäuscht mit einem dumpfen Poltern in die morsche Truhe zurückfallen.
So viel versprechend die Truhe sich anfänglich zeigte, so wenig Brauchbares enthielt sie letztendlich. Den Hammer möchte ich instandsetzen, den Rost abschleifen und den fehlenden Stiel ersetzen. Weiteres aus der Truhe ist nicht zu verwenden.
Eingeklemmt unter eingestürzten Dachlatten, finde ich ein Fass ohne Ringe. Am Boden unter dem Fass entdecke ich die fehlenden Ringe. Vorsichtig befreie ich meinen Schatz und trage alle Teile ins Freie. Bei Tageslicht erkenne ich den, bis auf die gelösten Ringe, guten Zustand des Fasses.
Mit einiger Mühe und nach mehreren Versuchen gelingt es mir, das Fass zusammen zu bauen. Auch die Ringe passen halbwegs. In Ermangelung anderer Werkzeuge, schlage ich mit dem rostverklebten, stiellosen Hammer die Ringe fester. Ich bin mir sicher, die Ausdehnung, wenn ich Wasser einfülle, wird das Fass abdichten.
Stolz einige Meter zurücktretend, bewundere ich meine Handwerkskunst. Dann rolle ich das Fass zum Brunnen. Mühselig fülle ich mit einem der Krüge Wasser in das Fass und beobachte traurig die unzähligen Wasserfontänen, die in dicken Strömen auslaufen und aus jeder Ritze ihre bösartigen Wasserspiele zeigen.
Ich fülle immer wieder nach und langsam, ganz langsam, habe ich den Eindruck, die Wasserfontänen verlieren ihre Kraft. Nach zwei Stunden haben sie sich sogar in kleine Rinnsale verwandelt und das Wassernachfüllen muss nur noch gelegentlich erledigt werden. Zwischendurch schlage ich die Ringe noch etwas nach und ich bin sicher bis zum nächsten Tag ein dichtes Fass zu besitzen.
Meinen neuen Hausstand komplettiere ich noch durch einige Kupferkessel und Pfannen, die ich mit feinem Sand blank scheuere und mit frischem Wasser ausspüle. Nach einiger Mühe glänzen die Pfannen und Kessel in einem rotschimmernden, goldenen Licht wie neu.
Am Abend bin ich müde, aber auch stolz auf meine ersten Handarbeiten und mein neues Heim!
Die nächsten Tage verbringe ich damit, weiteres Werkzeug zu reparieren, die Wohnstube entgültig abzudichten, zu entrümpeln und zu reinigen.
Nach jeder erledigten Arbeit, empfinde ich ein unglaubliches Gefühl der Freiheit, etwas Sinnvolles getan zu haben, ein Gefühl, das mir bisher fremd war. Nach jedem vollendeten Werk, schreit ein innerer Drang nach mehr.
Es ist phantastisch.
Nachmittags, nach Erledigung meines selbstauferlegten Tagespensums streife ich im Umland umher und sammle Nüsse, Beeren, Früchte und allerlei brauchbare Hölzer. An die zahlreichen Pilze wage ich mich nicht.
Nach und nach wird mir die Umgebung vertrauter. Bald kenne ich jeden Baum und jede Wurzel. Einige Tiere gewöhnen sich so schnell an mich, dass ich ihre regelmäßigen Besuche bereits am Morgen erwarte.
Besonders schnell freunde ich mich mit einem jungen Rehbock an. Nach einigen Tagen ist er derart zutraulich, dass er, wenn ich vergesse die Türe zu verriegeln, die Hütte auf der Suche nach Nüssen, gemäß seinen Vorstellungen wild und chaotisch, umgestaltet.
Die beleidigten Blicke des jungen Bockes, wenn ich ihn ins Freie treibe, werde ich sicher nie vergessen.
Nicht einmal den Mäusen, die nachts meine Vorräte dezimieren, bin ich böse.
Nicht mehr alleine. Das ist das wichtigste!
Jede Gesellschaft ist mir willkommen!!
Eines Abends entdecke ich, keine Stunde Fußmarsch entfernt, einen kleinen Unterstand, der mir einen der besten Funde beschert. Eine ausgezeichnet erhaltene, übergroße Ledertasche, die mit langen Riemen über die Schultern gelegt genau an den Hüften anliegt. Mein neuer Begleiter erweist sich als außerordentlich praktisch und ich fülle in nur wenigen Tagen mehrere Tonkrüge randvoll mit Nüssen.
Das Trocknen der Beeren in der warmen Sonne rationalisiere ich, bis ich täglich mehrere Kilogramm der wertvollen Früchte haltbar trocknen kann.
Woche um Woche wächst mein Speisevorrat. Regelmäßige Eierfunde bescheren mir eine warme nahrhafte Abwechslung. Das Feuermachen, das mir anfänglich zur Stunden Tortur geriet, gelingt mir immer besser.
Manche Nächte denke ich daran Fallen aufzustellen oder auf die Jagd zu gehen. Der Gedanke an die fröhlichen Morgengesänge meiner gefiederten Freunde, die mich in dieser Welt so freundlich begrüßten, erzeugt in mir einen unglaublichen Ekel vor Fleisch. Jagd wäre jetzt wie der Mord an meinen besten Freunden. Der Gedanke, meinen, wenn auch oft rüpelhaften Rehbock, auf dem Feuer zu rösten, erscheint mir geradezu widerwärtig.
Nein, ich lebe nun schon so lange nur von Früchten, Nüssen und wildem Gemüse: nein, meine Freunde kann ich nicht essen!
Sorgen bereiten mir die mehr und mehr durchgetretenen Stiefel, die zu ersetzen, ich noch keine Idee habe. Der täglich anwachsende Vorrat an Lebensmittel und Brennholz beruhigt mich dann aber meist wieder.
Aber das Problem des Schuhwerks bleibt.
Immer wieder finde ich intakte Lederreste und auch Riemen, aus denen ich mir nach und nach Untergewand, kleine Säckchen und Taschen fertige. Aber Stiefel traue ich mir noch nicht zu.
Meine ständig anwachsenden handwerklichen Qualitäten geben mir die Hoffnung, die Stiefel werden schon so lange halten bis ich ein leidlicher Schumacher geworden bin.
Um sie zu schonen, gehe ich bei jeder nur möglichen Gelegenheit barfuß.