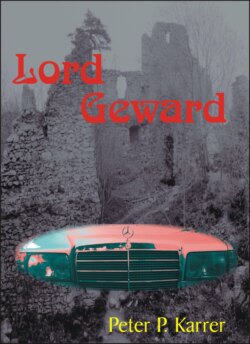Читать книгу Lord Geward - Peter P. Karrer - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление11. Tod
Diese Nacht schlafe ich keine Minute. Immer wieder betrachte ich diese Waffe aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt.
Sie zu berühren wage ich nicht mehr. Hier liegt das Böse, die Ausgeburt der Hölle. Von Menschenhand gebaut, um Menschen zu töten. Von Menschen entwickelt, die den Feind nicht kennen. Für Menschen, die einen Feind töten, den sie nicht kennen, den sie nicht hassen, aber auch nicht lieben.
Ich glaube der Albtraum, diese Nacht endet nie!
Sehe ich das wirklich oder phantasiere ich nur?
König Aldara.
Er brüllt immer wieder mit hochrotem Kopf und wutverzerrtem Gesicht: »Feuer, Feuer!«, und immer wieder: »Feuer!«
Die Geschosse sprengen Burgmauern, entzünden Teerbecken, die zur Verteidigung der Außenmauer bereit stehen. Brennende Menschen stürzen sich in den Tod. Pferde mit brennenden Mähnen trampeln die in Panik umher laufenden Menschen nieder. Ganze Türme stürzen in sich zusammen, begraben Menschen und Tiere, Träume und Hoffnungen.
Ein Mann mit Wahnsinn in den Augen läuft brüllend: »Die Strafe Gottes!« über einen leichenübersäten, blutüberströmten Burghof.
Ein Soldat liegt am Boden und schreibt mit seinem Zeigefinger bedächtig, mit langsamen Bewegungen die Initialen seiner Braut in eine zwei Meter große Blutlache, ihrer Blutlache. Er denkt an seine Liebe, an die Wärme ihres Körpers, an die zärtlichen Berührungen, aber er weiß, dieser ausgeblutete Körper, abgeschlachtet wie ein Schwein, wird keine Liebe mehr schenken und nur noch wie Abfall verwesen.
Eine Mutter, beraubt jeden Verstandes, schleift ihren toten Säugling wie eine Puppe über die Pflastersteine hinter sich her. Immer wieder schlägt der Kopf des toten Kindes, dessen Leben noch nicht einmal richtig begonnen hatte, über Stufen und Vorsprünge; aber es spielt keine Rolle mehr: dieser Körper empfindet keinen Schmerz mehr! Nie wieder Schmerzen, nie wieder Freuden, nie wieder, nie wieder. Dieses Kind wird nie wieder lachen, nie wieder »Mama« sagen, nie wieder, nie wieder.
Ein Körper lehnt blutüberströmt an einer Steinsäule. Mann oder Frau ist nicht mehr zu erkennen. An der Stelle des Kopfes ragt nur noch ein Stumpf des abgerissenen Rückgrades wie ein mahnender Finger empor. Der Strom des Lebens, der warme Strom des roten Blutes ist längst versiegt, längst in der gleißenden Sonne, wie alte Farbe, in wilden Runzeln vertrocknet.
Ein Pferd, in wilder Panik flüchtend, zerschmettert beide Oberschenkel eines zwölfjährigen Mädchens mit langen schwarzen Haaren und wunderschönen Locken. Die Worte des Kindes, im Wahnsinn gesprochen, sind kaum zu verstehen: »Mein Kleid, mein schönes Kleid! Mama ich kann nichts dafür, ich habe es nicht schmutzig gemacht!«
Das Mädchen, das wunderschöne Mädchen wird von einem herabstürzenden, Tonnen schweren Gesteinsquader augenblicklich zum Schweigen gebracht. Der schöne Mund wird für immer stumm bleiben, nie wird er die Lippen eines Geliebten im zarten Kuss berühren, nie werden die kleinen Brüste, die erst in Jahren ihre wahre Größe und Schönheit entfaltet hätten, ein Kind ernähren. Nein, dieser junge Körper ist tot, tot für immer und für alle Zeiten, einfach nur tot.
Tot! Tot! Tot.
Für immer tot!
Außerhalb der Burg lacht der triumphierend tänzelnde Satan, der wiedergeborene Teufel, König Aldara. »Feuer, Feuer, Feuer, verbrennt sie, verbrennt sie alle!« schreit er aus Leibeskräften.
Eine dunkle, nach verbranntem Fleisch riechende Wolke verdunkelt den Himmel. Einen Himmel, der noch nie von Smog und Umweltgiften belastet wurde. Ein Himmel, noch vor Minuten klar und frisch wie das Paradies, ein Himmel, der jetzt den Duft der verbrannten Leichen, das Aroma des Verwesens einatmen muss.
Ich beginne wie ein Verrückter zu schreien: »Nein, nein, nein!« Und schreie das ganze Elend meines Daseins in die dunkle Nacht, die nichts weiß von den Gräueln in meinem Kopf, den Verbrechen Aldaras. Einer Nacht die nicht friedlicher sein könnte, wenn nicht die Bilder in meinem Kopf...
In meinem Kopf?
Mein Gott wieder ein Albtraum oder ein Tagtraum?
Oder habe ich die Zukunft... Den garstigen Tod gesehen?
Den bestialischen Tod, verursacht durch eine Waffe aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt.
Ich stehe auf, versuche zur Besinnung zu kommen und schwanke wie ein Betrunkener, als trüge ich die Last der ganzen Welt auf meinem Rücken. Ich bin von Kopf bis Fuß schweißgebadet. Auch meine Blase hat wieder ihren Dienst versagt, denn meine Beinkleider sind zweifelsfrei von Urin getränkt. Mein Hals kratzt und schmerzt fürchterlich. Scheinbar muss ich mir wie ein sterbender Irrer die Seele aus dem Hals geschrien haben.
Ich ziehe mich aus, wasche mich oberflächlich mit den spärlichen Wasservorräten aus meinem kleinen Wasserschlauch und setze mich zitternd und verwirrt ins Gras.
Nein, dieser Horror darf nicht geschehen, darf nicht Wirklichkeit werden, nicht in dieser Welt, nicht in meiner neuen Heimat.
Ich werde diesen Schrecken aus dieser Welt vertreiben, werde diese Waffe, nein, werde alle Waffen aus diesem Land vertilgen.
Wieder muss ich gegen die immer wiederkehrende Panik ankämpfen.
Ich gehe auf und ab und atme tief und langsam hochkonzentriert ein und wieder aus.
Jalas knufft mich in die Seite, als wolle er sagen: »Na Kumpel, bist Du wieder klar? Wir schaffen das schon.«
Ich beginne wieder Herr meiner Gedanken zu werden.
Über die Stunden gelingt es mir, mich zu beruhigen. Ich werfe mir eine Decke über die Schultern und spüre das abklingende Zittern. Ich kaue einige Nüsse und nach einer getrockneten Zwetschge bin ich endlich wieder Herr und Meister meiner Gedanken, jedenfalls so weit, wie es nach diesen Visionen überhaupt noch möglich ist.
Ich hoffe und ich bete. Auch wenn ich nicht sagen könnte zu wem oder zu was ich bete.
Ich rekapituliere: Wenn die beiden Karren voll mit Panzerfäusten beladen sind und davon muss ich leider ausgehen, dürfte es sich um über fünfzig Stück handeln.
In meiner Zeit oder was ich früher als meine Zeit ansah nichts besonderes, aber hier in der Welt der Schwerter und Bogen eine unglaubliche Feuerkraft, der niemand etwas entgegenzusetzen hat.
Ängstlich schiele ich zu meiner Beute, die immer noch tödlich grinsend, im Sand steckt.
Ich muss akzeptieren, diese Waffe ist der einzige Verbündete gegen die anderen Mordwerkzeuge.
Behutsam hebe ich sie auf und denke mit Schrecken daran, wie ich sie letzte Nacht im Zorn, wild in die Landschaft schleuderte.
Irgendwie muss ich lernen sie abzufeuern. Aus alten Kriegsfilmen weiß ich, ich habe nur einen Schuss und der Kegel stellt das Geschoss dar. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie sie zum Schuss geschultert wird.
Mein Geist ist nur noch beherrscht von einem schier grenzenlosen Zorn.
Ein Schuss... ich habe nur einen Schuss... ich muss die Fuhrwerke entsprechend treffen, damit sich beide entzünden.
»Ich muss vernichten, muss!« Spreche ich, hart an der Grenze zum Wahnsinn.
Ich denke an meine Gaspistole, die mir mit sechzehn Jahren ein Freund verkaufte. Drei Monate Taschengeld kostete mich das Ding. Patronen konnte er mir nicht mehr besorgen, da sein Vater den Verlust der gestohlenen Waffe bemerkte und seinem Sohn sogar mit der Polizei drohte. Aber er hielt dicht und ich konnte die nutzlose Waffe behalten.
Wo ist sie eigentlich abgeblieben?
Aber ich erinnere mich genau an das „männliche“ Gefühl, sie auf dem Schulhof schwer in der Tasche zu fühlen, mit oder ohne Munition, es war ein unglaubliches Gefühl von Stärke und Macht, einfach jedem überlegen.
Was für ein Gefühl, wenn ich sie leicht nach vorne übergebeugt, um nicht entdeckt zu werden, in der Raucherecke meinen Mitschülern präsentierte, um die gierigen und beneidenden Blicke zu ernten.
Mein Gott, wie fand ich mich toll und wie fürchte ich jetzt diese Waffe, die wie angewurzelt immer noch im Sand steckt.
Sogar meine alte Gaspistole hatte eine Sicherung, meine Panzerfaust musste mindestens etwas Ähnliches besitzen.
Nach langem Betrachten gelingt es mir endlich wieder, mich der Waffe zu nähern. Ich betaste und lese die zahlreich eingravierten Hinweise und glaube oder hoffe, das Mordwerkzeug einsetzen zu können.
Ich packe sie über meine rechte Schulter, versuche das Zielsystem zu begreifen und traue mich kaum den Abzug zu berühren.
Wie einfach ist dagegen mein Schwert.
Mein Schwert: auch eine tödliche, manchmal verstümmelnde Waffe. Eine Waffe, die auch einzig und allein dafür gefertigt wurde, um einen Gegner zu töten. Einen Gegner, der einem gegenübersteht, dem man in die Augen sieht. In Augen in denen man die eigene Angst erkennt. Augen, die sich nach dem Schlag in Todesangst verzerren. Eine Waffe, die, wenn sie getötet hat, blutverschmiert und schwer in den eigenen Händen liegt. Blut, das riecht, das warm fließt, oft sogar über die eigenen Hände, die den tödlichen Schlag ausführten. Blut, das klebt und einen lange an den Tod und die grausame Verstümmelung erinnert. Das einem zuschreit: »Du hast getötet, Du bist ein Mörder!«
Wie sauber ist da doch eine Panzerfaust.
Ich muss den Gegner nur anvisieren, muss nicht die Angst in seinen Augen sehen, muss nicht sein vergossenes Blut von mir abwaschen, muss nicht seine Sorgen teilen.
Was für ein Fortschritt!
Eine moderne Waffe. Tödlicher und grausamer als mein Schwert und doch eine saubere Waffe. Ein kurzer Zug am Abzug und alles ist vorbei.
Diese „saubere Waffe“ hat nichts in dieser Welt zu suchen.
Habe „ich“ etwas in dieser Welt zu suchen?
Wenn ich mit einem Schuss beide Fahrzeuge treffe, sind diese Waffen für immer aus dieser Welt verschwunden.
In Plänen versunken, weicht der Tag der nächsten Nacht, die mit dem zunehmenden Mond von Nacht zu Nacht heller wird. Ich bin zum unsichtbaren Schatten des Tross geworden und rechne mir aus, in zwei, höchstens drei Nächten, genügend Licht zum Zielen zu haben und doch nicht entdeckt zu werden.
Drei Nächte später, zwei Täler weiter ist es so weit. Ich liege auf einer Anhöhe in hüfthohem Gras und warte auf die hereinbrechende Nacht, die Nacht des Todes. Jede Sehne meines Körpers ist bis zum Zerreißen gespannt.
Zweifel blitzen auf und verblassen wieder. Werde ich beide Fuhrwerke treffen? Werde ich viele Menschen töten? Funktioniert meine Waffe und bediene ich sie richtig? Habe ich das Recht, so in den Ablauf der Zeit einzugreifen? Bin ich ein Zeitreisender, der ein Paradoxon auslöst? Vernichte ich vielleicht nicht nur die schweren Kriegswaffen, sondern auch die Zukunft, meine Zukunft?
Jetzt ist es dunkel genug. Ich robbe los.
Das verdammte Gras verursacht einen Lärm, der mir in den Ohren dröhnt. Hoffentlich bilde ich mir das nur ein! Noch vorsichtiger schleiche ich weiter.
Jetzt bin ich am Ziel, bin in der optimalen Entfernung.
Die beiden Gefährte stehen perfekt, fünfzig Meter von mir weg, parallel zu mir, nebeneinander.
Ich bereite meine Ausrüstung vor und konzentriere mich ausschließlich auf meine Aufgabe, will nicht mehr denken, will keine Folgen mehr berücksichtigen, will keine Zeit mehr verlieren, will es nur hinter mich bringen.
Ich atme aus, atme ein, dann drücke ich ab.
Ein Zischen reißt mich aus meiner Konzentration. Zu spät denke ich daran meinen Kopf wegzudrehen. Der heiße Feuerstrahl verbrennt mir Augenbrauen und Teile meiner Haare. Realisieren werde ich das erst später.
Jetzt erschüttert ein unglaublicher Knall, gefolgt von unzähligen Explosionen die Nacht, die sich augenblicklich taghell erleuchtet.
Ich höre Männer, teils im Todeskampf teils um Orientierung bemüht, wild durcheinander schreien und sehe sie mit abgerissenen Gliedmaßen in wilder Panik ziellos durch die Gegend laufen oder Kriechen.
Nein, diese Waffe ist keine saubere Waffe.
Ich möchte mich wegdrehen, möchte das Grauen unten im Tal nicht sehen, aber ich bin wie gelähmt. Gebannt muss ich immer noch hinab sehen, muss jedes Detail sehen. Muss... muss, auch wenn ich nicht will.
Immer noch gewaltigere Explosionen vernichten jedes Leben dort unten.
Eine gewaltige Welle aus Feuer und Hitze, die langsam, aber unaufhaltsam zu mir herauf zieht, überfällt mich im Gesicht, wie ein Topf siedendes Wasser.
Immer noch laufen einige wenige Männer wie brennende Fackeln, in wilder Panik, um Hilfe schreiend, durcheinander.
Mein Gott, beende dieses Horrorspiel. Hilf mir, Gott!
Immer noch kann ich meine Augen nicht von diesem entsetzlichen Grauen wenden.
Tod, Feuer und immer neues Leiden.
Dann sehe ich das unfassbare...
Die andauernden Druckwellen der schweren Detonationen, lösen gegenüber einen Murenabgang aus.
Mein Gott, der ganze Hang bewegt sich.
Ein Hang groß wie ein Berg, bewachsen mit Bäumen und Sträuchern, rutscht nach unten. Immer schneller und schneller bewegt sich die alles vernichtende Masse. Das Geräusch der langsam abklingenden Explosionen wird durch das Donnern der Geröllmassen, die immer schneller werden, abgelöst. Riesige Felsen, die sich ihren Weg nach unten bahnen. Felsplatten, mindestens fünfzig Quadratmeter groß, reißen Bäume wie Streichhölzer aus und mit sich in die Tiefe.
Ein unvorstellbarer Berg an Geröllmasse begräbt Männer, Pferde und Wagen unter sich.
Am Ende schwebt nur noch eine Wolke aus Rauch und Staub über dem grausigen Ereignis.
Es ist absolut still, nichts ist zu hören, nicht einmal ein Vogel wagt die Ruhe des Sterbens zu unterbrechen.
Es ist still, totenstill.
Was habe ich getan?
Mein Gott, was habe ich nur getan.
Ich hoffe, alles nur geträumt zu haben und bete, ich möchte aus diesem Albtraum erwachen, aber ohne Erfolg.
Endlos lange verharre ich reglos auf der Stelle.
Niedergeschlagen, traurig, ohne eine Spur von Stolz, mein Ziel erreicht zu haben, trete ich den Rückweg an.
Die restliche Nacht verbringe ich in tiefer Depression.
Im Morgengrauen beginne ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich mit Inbrunst zu beten. Auch meine Gebete sind wirr und irre. Meine Gebete helfen nicht das Erlebte zu verarbeiten, aber sie bringen mich immerhin zurück ins Leben. Ich weiß nicht zu wem, oder zu was ich bete, aber ich bete.
Ich sehe mir das Schlachtfeld aus der Nähe an. Ich weiß nicht warum, aber ich muss die Folgen meines Verbrechens sehen, muss mich vergewissern.
Beinahe glaube ich, alles nur geträumt zu haben. Nichts erinnert mehr an die Karawane, keine Wagen, keine Menschen, keine Tiere, nur eine riesige Geröllfläche.
Der Deckel eines Massengrabes.
Ich habe Menschen, so viele Menschen getötet. Ich wollte doch nur andere Menschen schützen, wollte niemanden töten, nur die Waffen vernichten.
Mein Gott, wie soll ich damit leben?
Ich sehe Kinder, die nach ihren Vätern schreien; Mütter die um ihre Kinder trauern.
Eine alte Frau ruft nach ihrem Bruder, der sie seit acht Jahren versorgt, ihre Windeln wechselt, sie umbettet, wäscht und mit Brei füttert. Die gelähmte Frau, dessen Bruder ich mit vielen anderen getötet habe, ruft, winselt, fleht. Die halb toten Lippen formen immer wieder die selben Worte: »Heiner, Heiner, wo bist du? Heiner, wann kommst Du zurück? Heiner, hilf mir bitte. Hilfe, Heiner Hilfe, Hilfe!«
Die schrecklichen Bilder der Angehörigen verfolgen mich immer noch. Ich muss dagegen kämpfen. Wieder höre ich »Hilfe!«, kann mich nicht losreißen »Hilfe!«, kann keinen Abstand zu meinen Horrorphantasien schaffen: »Hilfe!« und wieder »Hilfe!«. Nein, ich phantasiere nicht, ich bin hell wach und wieder höre ich leise aber deutlich »Hilfe!«
Hier ist ein Mensch, der noch lebt und meine Hilfe benötigt.
»Hilfe!«
Ich drehe mich um, suche, horche; ja hier unter einer riesigen ausgerissenen Wurzel bewegt sich eine Hand.
Mit meinem Schwert hacke ich in zwei Stunden übervorsichtig einen Halbmeter großen Durchgang.
Mein Schwert, meine tödliche Waffe rettet ein Menschenleben. Vielleicht wird doch noch alles gut.
Nach einer weiteren Stunde, in der ich Stein für Stein mit den Händen bei Seite schaffe und Geröll aus dem Loch balanciere, kann ich die Schultern des mittlerweile Bewusstlosen greifen und ihn nach zwei vergeblichen Versuchen endlich heraus ans Tageslicht ziehen.
Erst jetzt erkenne ich ihn. Es ist der junge Mann am Lagerfeuer, der mir durch seine Trunkenheit erst die Möglichkeit zu diesem Massaker gab.
Aber er ist kein junger Mann, er ist ein Knabe und ein zierlicher dazu, von höchstens fünfzehn Jahren. Ich schultere den bewusstlosen Körper, der keine fünfzig Kilo auf die Waage gebracht hätte, und trage ihn in mein Lager.
Ich lege ihn auf die Satteldecke und stütze seinen blutverschmierten, schrammenübersäten Kopf mit der linken Hand, während ich ihn mit einem feuchten Tuch versuche, etwas zu reinigen.
Wie schwer mag er verletzt sein?
Mit einem kurzen Stöhnen und einem tiefen, nicht enden wollenden Seufzer meldet sich sein Bewusstsein wieder zurück. Er öffnet kurz seine jungen Augen. Jetzt glaube ich, er muss noch viel jünger sein. Dann schließt er seine Augen wieder. Ich bin sicher, diese leeren Augen sehen oder begreifen noch nichts.
Nach und nach beruhigt sich seine ungleichmäßige Atmung. Ich hoffe, dass er schläft. Mangels Kissen lege ich seinen Kopf auf meine weichen, zusammengerollten Stiefel.
Eine weitere Stunde später blubbert ein kräftiger Brei über dem Feuer, während ich auf sein Erwachen warte.
Ich werde von den Worten geweckt: »Vater, Vater wo bist Du?«
Scheinbar bin ich nach den Strapazen der letzten Tage auch kurz eingeschlafen.
Ich knie mich neben den Jungen, der mit geöffneten Augen, senkrecht nach oben in den Sternenhimmel starrt.
Er flüstert: »Vater was ist passiert? Wo bin ich?« Ich nehme seine Hand und frage ihn so sanft wie möglich, »Junge, wie heißt du?« Nach einer unendlichen Kraftanstrengung stottert er, »Ar... Armedus... wo ist mein Vater?«
Ich schäme mich unendlich und bringe nur ein Wort heraus: »Tot.«
Armedus zeigt keine Reaktion. Entweder hat er gar nicht begriffen, was ich ihm sagte oder er ahnte es bereits und ich habe ihm nur den Tod seines Vaters bestätigt.
»Wo bin ich?« Stöhnt Armedus.
Ich beuge mich über ihn, erleichtert eine so leichte Frage beantworten zu dürfen: »In Sicherheit, Junge... Wie alt bist Du Armedus?«
Er ist zäher, als ich nach seiner zarten Statur vermutete, denn diese Frage beantwortet er bereits wieder mit fester Stimme ohne ein Zögern: »Zwölf, ich bin zwölf Jahre alt.«
Innerlich zucke ich zusammen. Zwölf Jahre jung und der einzige Überlebende meines Massakers.
Ich füttere ihn, seinen Kopf auf meine Füße stützend, mit dem vorbereiteten Brei.
Mit jedem Löffel hoffe ich meine Schuld etwas mehr abzubauen.
Mein Gott, was habe ich nur angerichtet?
Mehr als fünf Löffel schafft er nicht, dann schläft er wieder ein.
Ich fühle mich so hilflos!
Noch nie in meinem Leben war ich so hilflos!
Was soll ich nur tun? Was?