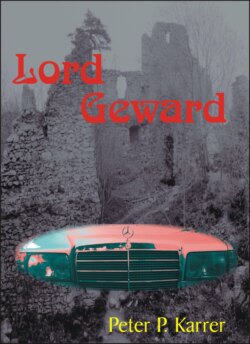Читать книгу Lord Geward - Peter P. Karrer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление9. Lord Geward
Heute Vormittag beschert mir das Glück eine besondere Köstlichkeit: Saftige, kleine Walderdbeeren. Diese wilden Früchte kann ich nicht haltbar machen. Leichte Trauer überfällt mich. Wenn ich Zucker hätte, könnte ich mir Marmelade einkochen. Aber ohne Zucker? Ich weiß nicht einmal wie oder aus was Zucker hergestellt wird.
Den Gedanken verscheuchend, genieße ich noch einige der kleinen Erdbeeren. Eine Hand voll nehme ich zur Hütte mit. Vielleicht halten sie bis morgen?
Gegen Mittag döse ich unter rauschenden Birken, genieße das goldgelb gefilterte Licht und betrachte die unzähligen Tageskerben in meinem Wanderstock, als ich jäh aufgeschreckt werde.
Deutlich höre ich galoppierende Pferde. Blitzartig schießt es mir durch den Kopf weder ein Lasso zu besitzen, noch es werfen zu können. Unsinn, auch wenn ich mir ein Pferd fangen könnte, wäre ich nicht in der Lage es zu zähmen oder gar zuzureiten.
In meinem Eifer hetze ich über den kleinen Hügel. Wenigstens sehen möchte ich die Wildpferde, die meinen Aktionsradius immens erweitern könnten.
Oben auf dem Hügel fährt mir der Schrecken, wie ein Blitz, tief ins Herz. Ich drohe zu stolpern, werfe mich nur noch wie ein tollkühner Torwart zu Boden und hoffe im Moos zu versinken.
Was ich sehe, trifft mich wie eine eiserne Faust mitten ins Gesicht. Das Unerwartete überrollt mich im größten Frieden, nichts ahnend, es könnte hier im Paradies etwas Böses geben.
Seit langer Zeit greife ich wieder nach meiner Waffe, aber der Griff geht ins Leere. Zufrieden mit mir und der Welt, hatte ich sie schon vor Wochen gegen meinen bequemeren und praktischeren Wanderstock eingetauscht und sie achtlos gegen den Kamin gelehnt und eigentlich schon längst vergessen.
Die Staubwolke, die immer bedrohlicher wird, hält wie ein reißendes Tier, die Klauen nach mir ausstreckend, genau auf mich zu. Details kann ich noch nicht erkennen, aber es sind etwa zwanzig bis dreißig Pferde im wilden Galopp und weit auswehender Mähne, vor einer Wolke aus Staub herstürmend.
Es sind große, schwarze und kastanienfarbene Tiere. Die meisten von ihnen tragen einen Reiter, einige dienen nur zum Lastentransport. Soweit ich es erkennen kann, tragen drei der Reiter eiserne Rüstungen.
Ich kann meine Panik kaum mehr beherrschen. Will mich einfach tot stellen. Ja, der Tod wäre die Lösung.
Die Welle der anrollenden Gewalt verlangsamt sich und hält keine hundert Meter vor mir am Fuß des Hügels an.
Ein hünenhafter, mindestens zwei Meter großer, breitschultriger Krieger, der offenbar das Kommando führt, brüllt seinen Begleitern etwas zu. Es ist unheimlich, der Krieger verwendet eine Sprache, die ich sicher noch nie zuvor gehört hatte und doch verstehe ich jedes Wort.
Offensichtlich bin ich nicht ihr Ziel, sie haben mich noch nicht einmal entdeckt. Trotzdem begreife ich zweifelsfrei, sie verfolgen jemanden, den sie offensichtlich verloren haben.
Ein zweiter Reiter, der in gebührendem Abstand hinter dem ersten sein Pferd stoppte, lässt es jetzt wenige Schritte nach vorne gehen, um auf gleicher Höhe zu stehen.
Er richtet das Wort an den Hünen, den er mit, »Mein König« anspricht. Offensichtlich bezweifelt er den Nutzen einer weiteren Verfolgung. Er endet mit einer angedeuteten Verbeugung: »Nie, sind Landlose so weit gekommen, mein König.«
Der Hüne entgegnet ihm freundlich aber bestimmt: »Ihr habt Recht, lasst uns hier lagern und Morgen zurückreiten.«
Einige der Männer beginnen die Füße der Pferde zu binden, während andere Zelte mit riesigen Mittelstangen aufbauen. Vor dem größten Zelt errichten sie einen mindestens drei Meter hohen Fahnenmast, an dem sie ein gigantisches Banner stecken.
Das tiefrote Banner ist aufwendig mit goldenen Stickereien verziert. Die untere Mitte ziert ein überlebensgroßer Raubvogel, der seine Krallen in einen Totenschädel vergräbt. Über dem Raubvogel erkenne ich ein Wappen aus dunkelblauen und gelben Rauten, ebenfalls mit einem Greifvogel auf einem Schädel. Oben wird das Banner mit einer Querstange geführt, an deren Ende je ein kleiner, menschlicher Schädel an einer langen Quaste hängt. An der Unterseite des Banners hängen mehrere, dreißig Zentimeter lange, in Gold eingefasste Pfauenfedern.
Männer, die offensichtlich Holz holen waren, legen in unglaublicher Geschwindigkeit eine Feuerstelle an.
Zwei kleine und sehr junge Reiter, vielleicht fünfzehn Jahre alt, die mir bisher nicht aufgefallen sind, reiten mit je einem Raubvogel am Sattel genau in meine Richtung.
Mit vorsichtigen Rückwärtsbewegungen, einer Schlange gleich, ziehe ich mich aus der vermuteten Zielrichtung zurück. Zusätzlich finde ich Schutz unter einem entwurzelten Baum.
Die beiden, in schweres dunkles Leder gekleideten Reiter nähern sich immer schneller meinem Versteck.
Keine zehn Pferdelängen entfernt werden ihre Pferde plötzlich unruhig. Nur mit größtem Geschick gelingt es ihnen die steigenden Pferde zu beruhigen. Auch die Vögel stoßen gellende Pfiffe aus, als wollten sie schreien, »Hier ist er Euer Gesuchter, hier unter dem alten Baum!«
Der erste, dicht gefolgt von dem zweiten Reiter, dirigiert sein Pferd einige Schritte rückwärts, um es zu beruhigen.
Die markerschütternden Schreie der Greifvögel verstummen, aber die Nervosität ist ihnen noch deutlich anzusehen.
Vier Augen suchen jetzt, wie eine Zieloptik, jeden Meter der Umgebung ab. Die gezogenen Schwerter ähneln meinem zum verwechseln, nur meines lehnt sicher und behütet am Kamin. Obwohl ich mir sicher bin auch mit meiner Waffe gegen die kampferprobte Übermacht nichts ausrichten zu können, würde mein Schwert mich doch beruhigen.
Was bin ich nur für ein Narr?
Immer weiter drücke ich mich unter den Stamm.
Sekunden später geschieht das Unausweichliche.
Die Augen des ersten Reiters treffen die meinen. Schlagartig weicht jedes Blut aus meinem Gesicht. Ich bin erstarrt und unfähig nur die kleinste Bewegung zu wagen.
Der Reiter ist zweifellos jung, maximal fünfzehn, wahrscheinlich nicht einmal das; er könnte mein Sohn sein, aber sicher ist er mir an Kraft und Geschick weit überlegen.
Seine Worte treffen mich wie Pfeile: »Rauskommen, zum Lager!«
Keines der beiden Vögel trägt eine Kappe über den Augen, wie ich es einmal in einer Falknerei sah. Ich spüre die nackte Gier der Raubvögel, mich zu zerfleischen, die Krallen in mein Gesicht zu schlagen, den Schnabel in meine Augen zu hacken. Wie zur Bekräftigung meiner Ängste, schreien sie mir laut ihren Zorn entgegen.
Mit meiner Eskorte, die mich in leichtem Trab vor sich hertreibt, stolpere ich Richtung Lager.
Im Lager angekommen, stoppt mich der Ausruf: »Halt!«
Augenblicklich bleibe ich, einer Salzsäule gleich, stehen. Ich wage nicht mich umzudrehen, nicht einmal aufzublicken. Ich starre den Boden an, als würde ich ihn beschwören, mich zu verschlingen.
Ich höre einen Reiter absteigen, höre das Geräusch Leder auf Leder, Kleidung auf Sattel. Als er dicht an mir vorbei geht, erkenne ich in ihm den zweiten Häscher, der offensichtlich noch jünger als der andere ist.
Unmittelbar nach dem er in einem Zelt verschwindet, tritt der Hüne heraus und direkt auf mich zu.
Seine stechenden Augen ängstigen mich noch mehr als sein Schwert, das so groß ist, dass das meine daneben wie ein Dolch gewirkt hätte oder bilde ich mir alles nur ein?
Er ist sicher nur wenige Jahre älter als ich, auch wenn der ergraute Bart ihm Alter und Würde verleiht. Ohne ein Wort mustert er mich von oben bis unten, um schließlich seine Augen wieder in die meinen zu bohren.
Zitternd spüre ich eine unnatürliche Wärme zwischen meinen Beinen, ich spüre die Nässe an meinen Schenkeln nach unten laufen. Meine Blase konnte der Anspannung und der Angst nicht mehr standhalten. Ein nichtendender Schwall an Urin bahnt sich seinen Weg nach unten. Ich kann nicht aufhören. Ich stehe bereits in einer beachtlichen, dampfenden Pfütze, aber ich kann nicht aufhören. Es läuft immer noch und ich kann den Strom nicht stoppen, bis nicht auch der letzte Tropfen Urin seinen Weg in die Freiheit gefunden hat.
Die Augen meines Gegenübers verändern sich und sein Mund wird schärfer.
Mein Gott, das ist das Ende. Ich sehe das Schwert mich enthaupten, sehe Blut spritzen, sehe meinen Kopf ins Feuer rollen und höre das Lachen, höre das...
Höre das Lachen des Hünen, ein ungestümes Lachen aus einem weit aufgerissenen, mit schlechten Zähnen gespickten Mund.
Immer lauter höre ich das ungestüme Lachen.
Ich lebe, bin nicht geköpft, lebe und höre immer noch das Lachen. Einer nach dem anderen steigt in das befreiende Lachen ein.
Beinahe lache ich mit. Ich entspanne mich, sinke mit beiden Knien in den nassen Sand, spüre nichts, bin nur erleichtert, nicht tot. Ich lebe.
Langsam, ganz langsam, nach endlosen Minuten, die mir wie Stunden erscheinen, beruhigt sich das Gelächter und ebbt allmählich ab, in ein Schnaufen und Grunzen. Mit abklingender Geräuschkulisse richtet der Hüne sein Wort an einen am Feuer stehenden, gut genährten, immer noch prustenden Mann: »Er soll sich waschen, dann gebt ihm trockene Sachen und bringt ihn zu mir.«
Erst jetzt, nachdem ich mich gewaschen habe, überfällt mich die Scham über mein Missgeschick. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, als Kind in die Hosen gemacht zu haben, aber hier...
Ein junger Mann, mit einem auffallenden Mädchengesicht, gibt mir Unterwäsche, die mir wie ein Geschenk des Himmels erscheint nach der langen Zeit der Nacktheit unter meinem Umhang und den kläglichen Versuchen, mir später aus Lederresten Unterwäsche zu schneidern. Die Unterwäsche zum Binden, aus weicher Schafswolle, empfinde ich wie einen Traum aus Watte, denn ich spüre sie kaum auf meiner abgehärteten Haut.
Wie befohlen werde ich zum größten der Zelte geführt.
Das Banner erscheint mir aus der Nähe noch furchterregender und grausamer. Was werden die Männer mit mir anstellen?
Im Zelt mustert mich der Hüne mit neugierig forschenden, aber nicht unbedingt feindseligen Augen.
Meine innere Anspannung bleibt, aber wenigstens lässt die Angst etwas nach.
Ich fühle eine Spur Wohlwollen in meinem Gegenüber. Das Lachen nach meinem peinlichen Malheur klang ehrlich und herzhaft. Nicht wie das zynische Gelächter von Schlächtern, die ihre Opfer vor der Exekution noch verhöhnen.
Die beiden anderen Männer im Zelt tragen ebenfalls, die mir durch mein eigenes Schwert so vertrauten, Waffen. Der Kleinere der beiden füllt mehrere Becher Wein und reicht den ersten, mit einer von einem Lächeln begleiteten Verbeugung, dem Hünen. Nach und nach reicht er jedem einen Becher. Als letztes erhalte auch ich einen vollen Becher.
Der Becher - eher ein filigraner Kelch - liegt schwer in meiner Hand und die unerwartete Begrüßung verunsichert mich mehr als sie mich beruhigt. Auf der Weinoberfläche erkenne ich nicht nur die sich spiegelnde Innenseite des Kelches, sondern auch die durch mein Zittern verursachten kleinen Wellen. Vergeblich versuche ich den Becher ruhig zu halten. Mir zuprostend, einen Schritt auf mich zugehend, richtet der Hüne das Wort an mich: »Lord Geward, ich freue mich Euch in meinem Zelt begrüßen zu dürfen.«
Während er den übrigen Männern ebenfalls mit größter Höflichkeit zuprostet, überschlagen sich meine Gedanken.
Meinen verwunderten Gesichtsausdruck gewahrend, dreht sich der Hüne um. Jetzt erst bemerke ich das Schwert auf dem altarähnlichen Tisch. Er nimmt meine Waffe und tritt direkt vor mich und reicht sie mir.
Es ist mein Schwert, zweifellos, ich erkenne deutlich die von meinen Gravierarbeiten abgenutzten Stellen. Seinen auffordernden Blick folgend, nehme ich es an mich.
Immer noch weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll und suche fieberhaft nach einem Ausweg.
Mit einem Anflug von Unsicherheit oder besser Unwissenheit, lächelt der Hüne mir zu und sagt: »Lord Geward, Bruder, seid versichert, wir alle sind froh Euch am Leben anzutreffen. Die Nachricht, vor über zwei Jahren, Ihr seid im Kampf um Konys gefallen, hat das ganze Land erschüttert. Aber erlaubt mir eine Frage, wie konntet Ihr entkommen und wo wart Ihr die letzten zwei Jahre? Niemand, bis auf einige Lastpferde, hat das Gemetzel überlebt. Wir alle möchten auch unser Bedauern ausdrücken, Euch nicht sofort erkannt zu haben. Aber Ihr müsst zugeben, Ihr habt Euch sehr verändert und... und ohne Euer Schwert, wir haben es in einer Schäferhütte gefunden... und warum zum Teufel habt Ihr Euch nicht zu erkennen gegeben.«
Etwas zornig setzt er noch nach: »Und was sollte Euer Auftritt am Feuer, Euch zu nässen wie ein Kleinkind. Ihr habt uns und Euch dem Spott aller ausgesetzt. Was sollte das?«
»Ich... ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, ich weiß nicht, wo ich war und was geschehen ist«, stammle ich verzweifelt - obwohl das eigentlich sogar die reine Wahrheit ist.
Das Stottern und den Unwissenden zu spielen, fällt mir nicht schwer. Ich weiß ja wirklich nicht, was vorgeht.
Die zornige Miene des Hünen entspannt sich und er erwidert: »Ja, ja Lord Geward, ich habe mir schon etwas Derartiges gedacht.«
»Sicher, wurdet Ihr in Konys so schwer verletzt, dass Euer Verstand das Erlebte ausradierte und einer dieser nichtsnutzigen Bauern hat Euch schlecht versorgt, anstatt Euch auf Burg Aldara zu bringen. Zweifellos wurdet Ihr auch noch ausgeraubt, wenn ich Eure Kleidung so betrachte. Wenn ich das Bauernpack finde, werde ich ihm mit eigener Hand, die Haut vom Körper reißen!«, ereifert sich der Hüne.
Immer noch weiß ich nicht, wie mir geschieht.
»Und Lord Geward, was Euer Missgeschick, zweifellos durch Eure Krankheit verursacht, angeht, habe ich Order gegeben, darüber zu schweigen. Wer das Schweigen bricht, dem schneide ich persönlich die Zunge aus seinem verlogenen Maul und esse sie mit heißem Öl zum Frühstück!«, setzt er immer noch ernst hinzu.
»Auf Eure Gesundheit, Lord Geward«, lacht er.
Mit diesen Worten prostet er mir zu. Die Angelegenheit scheint damit beendet zu sein.
Ich setze, seinem Beispiel folgend, meinen Becher Wein an die Lippen. In dem Bewusstsein seit Wochen keinen Alkohol mehr getrunken zu haben, nippe ich nur. Um Zeit zu gewinnen, die Gedanken und die neuen Eindrücke zu verarbeiten setze ich den Becher als letzter ab und stelle ihn zu den anderen, auf eine aufwendig mit Schnitzereien und Goldeinlage verzierte, kleine Truhe, gerade so groß, dass ein Lastpferd sie noch tragen kann.
Tausende Gedanken rasen durch meinen geplagten Kopf. Wie konnte eine so kleine Reitergruppe ein solch prunkvolles Zelt ausrüsten. Ich schiebe die Frage zur Seite. Schließlich wurde der Hüne von den anderen als König Aldara angesprochen. Ein König, der mich offensichtlich als seinen Gefolgsmann, Lord Geward ansieht.
Erleichtert bemerke ich, im Moment beobachtet mich niemand besonders und ich habe Zeit die Eindrücke der letzten halben Stunde zu sortieren.
Nachdem alle Becher geleert sind, entscheidet König Aldara, »Es ist Zeit zu Essen.«
Gleich darauf weist König Aldara einen älteren Mann mit grauem Stoppelbart und runzliger Haut, gleich einem Schrumpfkopf, an, mir angemessene Kleidung zu geben.
Eine Stunde später sitze ich an einer prachtvoll gedeckten Tafel. Es gibt Berge verschiedenen Fleisches und frischgebackenes, mit gehackten Nüssen verfeinertes Brot. Seit Wochen träume ich von frischem Brot und jetzt halte ich es in Händen. Ich betrachte das Brot wie ein Wunder! Es muss ein Wunder sein, ein Geschenk Gottes: nach der trockenen Wüste und meinem Einsiedlerleben in der Hütte.
König Aldara bemerkt mein Zögern das Brot zu essen und ruft mir verschmitzt lächelnd zu: »Verzeiht mir, Lord Geward, hätte ich gewusst, Euch hier zu treffen, hätte ich sicher Euren geliebten Honig als Proviant mitgeführt. Aber nachdem keiner meiner Männer dem Honig, wie sonst nur die Frauen, verfallen ist, müsst Ihr mit den harten Speisen der Männer vorlieb nehmen und Eure süßen Gelüste bis Burg Aldara zurückstellen.«
Augenblicklich brüllt die ganze Tafel über den Witz des Königs. Scheinbar bin ich in dieser Welt ein Schleckermaul und Süßes ist scheinbar wohl den Frauen vorbehalten. Zufrieden und entspannt reihe auch ich mich in das laute Gelächter ein.
Während die Becher immer wieder mit frischem Wein gefüllt werden, den auch ich mit jedem neuen Becher mehr und mehr in vollen Zügen genieße, verschlinge ich Berge an Fleisch und dem fremdartigen, aber ausgezeichneten Nussbrot.
Meinen Vorsatz, kein Fleisch mehr zu essen, habe ich bei diesem Anblick an Überfluss längst vergessen.
Auch König Aldara bleibt mein Fleischhunger nicht verborgen und auch er, bereits schwer vom Wein geschlagen, grölt in die Runde: »Lord Geward, mögen die Götter wissen, wie Ihr überlebt habt, vielleicht haben die Götter persönlich Euch geheilt, aber ordentlich verpflegt haben sie Euch sicher nicht!«
Das einsetzende Grölen übertönt jedes andere Geräusch und vertreibt auch noch den letzten Rest Argwohn gegen diese Männer, die mich so herzlich aufnahmen und mich verköstigen wie einen Ehrengast.
Nach und nach ergreifen immer mehr Männer das Wort.
»Es lebe Lord Geward, der oberste Kriegsherr des Königs«, höre ich aus der anderen Seite der Tafel.
Ein betrunkener Junge, vielleicht sechzehn, steht von einigen anderen gestützt, auf und lallt: »Lord Geward ist zurück, es lebe Lord Geward.«
Zwei Plätze neben mir schreit ein alter, grauhaariger, auffallend kleiner Mann: »Ich wusste er lebt! Ich wusste es immer! Hab ich es Euch nicht gesagt? Er lebt! Ein Hoch auf Lord Geward!!!«
Er setzt den vollen Becher Wein an und unter Aller Beifall leert er ihn in einem Zug, wobei eine gehörige Menge davon links und rechts aus den Mundwinkeln über sein kunstvoll besticktes Hemd läuft.
Die ungezügelte Freude reißt auch mich mit. Ich genieße das Fleisch, den Wein und die Gesellschaft meiner neuen Freunde.
An das Ende des Abends kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube noch zu wissen, die zarte Morgendämmerung erhellte längst die vergehende Nacht, als wir immer noch laut lachten und tranken.
Gegen Mittag werde ich geweckt. Der Lagerplatz ist bereits geräumt, die Zelte abgebaut und mindestens fünfzig Packpferde beladen.
Meine gestrige Einschätzung es mit zwanzig, höchstens dreißig Pferden zu tun zu haben, erweist sich als grundfalsch und ich muss beinahe laut lachen. Um mich herum bereiten sich geschäftig etwa vierzig schwer bewaffnete Reiter mit Pferden und sicher zweihundert oder wahrscheinlich sogar dreihundert Fußsoldaten mit Armbrust, Schwertern und kurzen Dolchen auf den Abmarsch vor.
Die Staubwolke, die mich gestern so erschreckte, war offensichtlich nur die kleine Spitze einer riesigen Armee.
Der ältere, narbengesichtige Krieger, dem zwei Finger der linken Hand fehlen und den ich schon von gestern kenne, reicht mir einen Becher Wasser und ermahnt mich gleichzeitig zur Eile.
»König Aldara wünscht, dass Ihr mit ihm an der Spitze reitet. Ich habe Euch einen schwarzen Hengst besorgt. Er ist aus der gleichen Zucht wie jene, die Ihr gewöhnt seid, mein Lord.«
Mit einer angedeuteten Verbeugung zieht er sich zurück und ein bleichgesichtiger Junge oder eher noch ein Kind bringt mir den versprochenen Hengst.
Er übergibt mir mit unsicherem Blick die Zügel, zieht seine Hand sofort zurück, als befürchte er, ich würde ihn beißen und verlässt mich unverzüglich.
Mein Gott, das Pferd ist hoch wie ein Haus!
Nie in meinem Leben bin ich geritten, noch nie war ich einem Pferd so nahe, nie erkannte ich diese Größe. Wie soll ich bloß da hinaufkommen. Ich muss mich schon strecken um überhaupt den Sattelknopf zu erreichen.
Unruhig sehe ich nach allen Seiten und erkenne, jeder ist mit allerlei Aufgaben beschäftigt und niemand hat Zeit, sich um mich zu kümmern.
Ich versuche mich zu konzentrieren, versuche ruhiger zu werden, spreche mit dem Pferd, spreche mit Jalas.
Ja, es ist Jalas, mein geliebter Jalas, dem ich vor Jahren geholfen habe auf die Welt zu kommen.
Stopp, Stopp, was geschieht hier? Ich war noch nie bei der Geburt eines Pferdes dabei. Ich kenne auch keinen Jalas. Träume ich schon wieder? Aber ich kenne das Pferd!
Jetzt erkennt auch Jalas mich. Sein zärtliches Schnauben und das zärtliche Stupsen mit seinem Kopf in meine Rippen...
Ja, Jalas hat mich auch erkannt und ich bin froh darüber, meinen alten Freund wieder zu haben.
Ohne Probleme, mit größter Selbstverständlichkeit, steige ich auf. Das Gefühl auf seinem starken Rücken zu sitzen ist überwältigend. Mit Mühe drücke ich eine Träne weg, dann preschen wir los, durch das Tal, in Richtung Spitze des gewaltigen Heeres.
Die weitausladenden Königsbanner weisen uns den Weg und nach nur wenigen Minuten ereiche ich König Aldara, der mich freudig, aber auch mit stolzem Blick begrüßt.
»Wie Ihr seht, Lord Geward, habe ich die Bergvölker aus dem Westen endlich davon überzeugen können, dass auch sie jederzeit das Schicksal von Konys treffen könnte und nur wir gemeinsam die Mitländer aus unserem Land für immer vertreiben können. König Barusy, der seit einem Jahr auch die Bergvölker befehligt, hat mir weitere zweihundert Bogenschützen, achtzig ausgebildete Kriegspferde und dreihundert Packmulis zugesagt. Er selbst wird sich mit sechzig Berittenen an der Grenze zu Konys mit uns treffen.«
Ich nicke zustimmend, obwohl ich nicht begreife, worüber König Aldara spricht.
»Ich habe heute Morgen einen Boten zu ihm gesandt, der ihm die Nachricht Eurer Rückkehr bei bester Gesundheit mitteilt. Ich bin sicher, er wird mit der Nachricht - mein oberster Kriegsherr lebt - weitere Gefolgsleute in den unzähligen Bergtälern für unsere Sache gewinnen können!«, strahlt er.
Ein Reiter schießt mit scharfem Galopp auf uns zu und teilt mit: »Alles ist zum Aufbruch bereit!«
König Aldara gibt mit einer knappen Kopfbewegung den Befehl und der riesige Tross setzt sich in Bewegung. Es ist erstaunlich, wie das Fußvolk mit dem Tempo der Pferde mithält.
Die nächsten Stunden bis zum Abend vergehen zum Glück in Schweigen und es gibt mir etwas Zeit über alles nachzudenken. Um Jalas muss ich mich nicht kümmern, der ist es scheinbar gewohnt an der Seite des königlichen Tieres zu laufen, einem ebenfalls glänzenden schwarzen Hengst.
Wie es aussieht, kann ich meine Tagträume dazu benutzen, mich in andere Welten zu integrieren.
Oder bin ich oder war ich einmal Lord Geward?
Keiner der Männer hätte je daran gezweifelt, dass ich Lord Geward, der Kriegsheld des Königs bin, sondern nur der schlechtbezahlte Sachbearbeiter aus einer anderen, einer kalten, sterilen, vollklimatisierten Welt.
Auch das Reiten fällt mir so leicht und bereitet mir mindestens soviel Freude wie die sonntäglichen Ausflüge mit meinem Daimler.
Selbst mein Herr, König Aldara...
Mein Gott, jetzt sehe ich in ihm schon meinen Herrn! Lebe ich doch in dieser Welt? Gehöre oder gehörte ich schon immer hier her?
Ich weiß es nicht. Egal, ich kann es nicht ändern.
Selbst König Aldara ist fest davon überzeugt, seinen für tot erklärten obersten Kriegsherrn wieder an seiner Seite zu haben.
Mehr und mehr finde ich Gefallen an meinem neuen Leben.
Die nächsten Tage enden immer mit einem üppigen Mahl an der königlichen Tafel, Seite an Seite mit König Aldara.
Tag für Tag erfahre ich mehr über mich:
Ich bin tatsächlich ein Kriegsheld. Alleine die Nachricht meiner Rückkehr veranlasst immer mehr Leute sich uns anzuschließen. Selbst Bauern, nur mit Dreschschlegel oder Axt bewaffnet, schließen sich uns begeistert an.
Am sechsten Tag unseres Marsches entscheidet König Aldara, ab sofort immer nur zwei Tage zu reiten und den dritten Tag zum Ausbilden der im Kriegshandwerk unerfahrenen Bauern zu verwenden.
Immer wieder hält er mich an, die Ausbildungsplätze zu besuchen und die Waffenübungen zu überwachen. Ich kann es mir nicht erklären, aber Tag für Tag fällt es mir leichter, die Fehler in den Übungen zu erkennen und die Leute in der Ausbildung zu unterstützen.
Mehr und mehr genieße ich das berauschende Gefühl, wenn ich beobachte, wie die Bauern nur durch meine Anwesenheit ihre Bemühungen verdoppeln.
In nur wenigen Tagen hat sich das Fußvolk mehr als verdreifacht. Stündlich treffen weitere Gefolgsleute ein. Vom achtjährigen Knaben mit einem Holzschwert, bis zum greisen Veteran auf Krücken. Selbst junge Frauen, die sich als Männer verkleiden, wollen in den Krieg ziehen!
Mit der anwachsenden Zahl der Köpfe verlangsamt sich unser Marsch immer mehr. Die meisten Reiter sind nur noch damit beschäftigt das Fleisch für die hungernden Mägen zu jagen, während andere es sofort weiterverarbeiten und im Lager verteilen.
Am Abend, am Ende der dritten Woche, bittet mich König Aldara in sein prunkvolles Zelt.
Beim Betreten sehe ich ihm die Sorgen und Nöte deutlich ins Gesicht geschrieben. Der stolze, uneingeschränkte Herrscher sitzt wie versteinert, den Kopf gesenkt, lange schweigend vor mir. Er gibt mir ein Zeichen mich zu setzen und reicht mir stumm einen Becher Wein.
Schweigend setzt er immer wieder, einen kleinen Schluck Wein nehmend, den glänzenden Kelch an seine Lippen.
Nach einer kleinen Ewigkeit beginnt er leise zu sprechen. »Lord Geward, der Feldzug ist verloren, bevor wir ihn überhaupt begonnen haben. Wir sitzen fest. Alleine das Erlegen, Zubereiten und Verteilen der Verpflegung verschlingt den ganzen Tag. Die meisten meiner Vertrauensmänner und altgedienten Kämpfer sind Tag und Nacht nur noch auf der Jagd oder damit beschäftigt die immer häufiger auftretenden Streitereien zwischen den einfachen Soldaten und den Bauern zu schlichten. Auch die verschiedenen Clans geraten immer öfter aneinander.«
Ich nicke zustimmend.
»Auch haben sich immer mehr geschäftstüchtige Frauen ins Lager geschlichen und verkaufen meistbietend ihre fleischlichen Reize, was zu weiteren Streitereien führt. Mein eigener Friedensmann ist seit Tagen nur noch damit beschäftigt, die Söldnerinnen, welche die Dirnen verachten, von ihnen zu trennen. Letzte Nacht hat der Streit um eine Hure sogar das Lager meiner edlen Ritter erreicht. Dabei wurde ein Ritter getötet und der andere so verstümmelt, dass - sollte er überleben - er nur noch für die Feldküche taugen wird.«
Lange fixieren mich die scharfen, aber jetzt traurigen Augen, dann fährt er zögernd fort. »Lord Geward, ich frage Euch jetzt, nicht als Euer König, sondern nur als bescheidener Bittsteller: Welchen Rat könnt Ihr mir geben?«
»Mein König, wie könnte ich Euch raten?«, versuche ich so diplomatisch wie möglich zu antworten.
König Aldara reicht mir, offensichtlich um Zeit zu gewinnen, einen frischen Becher Wein, seufzt und erklärt: »Lord Geward, wenn Ihr mir nicht raten wollt, bedenkt nicht nur Eure Zukunft, bedenkt auch die Zukunft meiner Tochter, Eurer Verlobten.«
Das trifft mich wie ein Blitz!!! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin mit der Tochter des Königs verlobt. Diese Welt scheint immer wieder eine weitere Überraschung für mich bereit zu halten.
Jetzt begreife ich auch die Wärme und Nähe und das beinahe grenzenlose Vertrauen, das König Aldara mir von Anfang an entgegen brachte.
Mich zur Ruhe zwingend, bitte ich den König um Bedenkzeit.
Mit einem Anflug von Hoffnung in den Augen entgegnet er mir: »Ja, Lord Geward, bedenkt alle Möglichkeiten, aber überlegt nicht zu lange! Es gibt im Lager sicher genügend Spione, die den Mitländern längst mitgeteilt haben, welche träge Schnecke hier als leichte Beute auf sie wartet!«
Er senkt seinen Kopf und weist mich an zu gehen, ganz wieder der König: überlegen, fehlerlos und der uneingeschränkte Herrscher über sein Land und seine Untertanen. Der Anflug von Vertrautheit und Unsicherheit ist wie ausgelöscht.
Diese Tatsache akzeptierend, verbeuge ich mich tief und verlasse im Rückwärtsschritt das königliche Zelt.
Um Ruhe zu finden oder nur der Situation zu entfliehen, gehe ich einige hundert Meter aus dem Camp und setze mich unter eine mächtige Eiche, als suchte ich unter ihr Schutz und Hilfe.
Ich bin verwirrt und begreife nicht, was mich mehr beunruhigt, die anstehende Entscheidung als Stratege und Kriegsheld oder die Verlobung mit der Tochter des Königs, meines Königs.
Immer wieder werde ich aus meinen Gedanken gerissen.
Einmal fragt mich ein schleimiger, diensteifriger Lakai: »Mein Herr, wünscht Ihr noch Wein oder andere Speisen?« Ich verneine dankend und schicke ihn weiter.
Kurz darauf pirscht sich ein sicherlich keine vierzehn Jahre altes, Abenteuerlustiges Mädchen an mich heran. Ich vermute, sie will die Trophäe des Triumphes, den obersten Kriegsherrn des Königs verführt zu haben, erringen. Ich wimmle sie höflich ab, ohne sie mehr als nötig zu enttäuschen.
Zu meiner Schande muss ich mir dabei eingestehen, sie ist ein außerordentlich hübsches, wenn auch aus einfachsten Verhältnissen stammendes Bauernmädchen.
Nur Augenblicke später, die für ihn richtige Gelegenheit abgepasst, überfällt mich ein hagerer Bauer. Er erzählt mir von seinem Großvater, der einst auch schon das Land verteidigt habe. Stolz zeigt er mir sein rostzerfressenes, vom Alter und der langen ungenutzten Liegezeit gezeichnetes Schwert.
Er hantiert damit derart ungeschickt, dass ich es ihm am liebsten abgenommen und gegen eine ihm vertrautere Mistgabel ausgetauscht hätte.
Ich bekunde ihm meine Dankbarkeit für sein Kommen, erinnere ihn nachdrücklich an die morgen früh stattfindenden Waffenübungen und belehre ihn, er müsse unbedingt daran teilnehmen.
Stolz marschiert er zurück zum Lager der Neuankömmlinge. Ich sehe ihm nach und überlege, ob ihn meine Worte tatsächlich um einige Zentimeter wachsen ließen oder ob ich mir das nur einbilde.
Eindeutig ist, dieser Bauer hat noch nie ein Schwert getragen. Belustigt beobachte ich ihn. Bei jedem zweiten Schritt verheddern sich seine dünnen Beine in der langen Waffe. Er muss sein ganzes Geschick aufbringen, um nicht zu stolpern. Schmunzelnd erinnere ich mich an meine eigenen Probleme, mit der unhandlichen Waffe zu gehen.
Laut lache ich auf. Jetzt ist er tatsächlich über sein geliebtes Erbstück gestolpert und zappelt wie ein auf den Rücken gefallener Käfer, um sich wieder aufzurichten.
Als mich jetzt auch noch ein übereifriger, profilierungssüchtiger Soldat - der mich sehr an meine ständig mobbenden Arbeitskollegen aus meinem klimatisierten Büro erinnert - nach meinem werten Befinden fragt, platzt mir der Kragen. Ich scheuche ihn mit ungewollter Schärfe von mir weg an seine Aufgaben.
Offenbar beleidigt oder sich ertappt fühlend, schleicht er gebückt und leise fluchend zurück ins Lager.
Erst weit nach Mitternacht beruhigt sich das Lager unter mir.
Ich kann König Aldara nur Recht geben. Das Lager ähnelt wirklich mehr einer Kleinstadt als einem Heereslager.
Immer weniger Fackeln brennen im Lager. Aber sicher brennen in noch vielen Zelten die Kerzen und Öllampen, die nur zu schwach sind, die Zeltwände soweit zu erhellen, um ihren Schein bis zu mir zu tragen.
Allmählich komme auch ich zur Ruhe.
König Aldara hat Recht: Der Feldzug ist tatsächlich zum Stillstand gekommen. Zwischen den einzelnen Zeltlagern wuchsen in den letzten Tagen wie aus dem Nichts Verkaufsstände für alles Nötige und auch Unnötige.
Ich erinnere mich daran, am Nachmittag einen Eselskarren voller Stoffballen für die edelste Abendgarderobe betuchter Ladys gesehen zu haben und kurz darauf eine vielleicht vierzigjährige, kleine Frau in einfacher aber gepflegter Tracht, die ein riesiges Sortiment an Damenkämmen, Haarspangen und bunten Tüchern durch die Zeltgassen schleppte, immer auf der Suche nach Soldaten, die noch ein kleines Geschenk für die Geliebte, die Frau, Schwester oder Mutter benötigten.
Das Lager gleicht wirklich einer kleinen Stadt.
Ich erinnere mich zurück:
Richtig, schon vor Tagen ist der Feldzug zum Stehen gekommen. Ich hatte bereits da den schleichend wachsenden Dorfplatz in der Mitte der verschiedenen Zeltlager beobachtet, ohne die Konsequenzen zu erahnen. Sogar Kinder liefen alsbald kreuz und quer und vergnügten sich mit Fangen oder allerlei sonstigen Spielen. Andere drängten sich um einen Stand mit gerösteten Nüssen in süßem Honig. Ich hörte sogar das Gerücht, ein Puppenspieler und einige Artisten hätten ihre Kunststücke für die nächsten Tage angesagt.
Ich seufze deutlich auf, denn damals hatte ich die Tragweite dieser Entwicklung noch nicht begriffen.
Lachend sage ich laut zu mir selbst: »Es würde mich nicht wundern, wenn morgen Bauern die ersten Felder pflügen würden.«
Ich gewinne langsam den Eindruck, das ganze Land versammelt sich, einer unbekannten Kraft folgend, in unserem Lager. Ich, ja ich, muss einen Weg finden, diese Menschenmasse wieder in Bewegung zu bringen, oder der Krieg ist verloren, bevor er überhaupt begonnen hat.
Mein Gott was tue ich da, was denke ich da?
Ich bereite einen Krieg gegen einen Feind vor, den ich nicht einmal kenne; einen Feind, der vielleicht gar kein Gegner ist. Ich sonne mich als oberster Kriegsherr und zukünftiger Schwiegersohn eines Königs, den ich erst seit kurzem kenne und der vorgibt, oder es wirklich glaubt, mich zu kennen.
Wie kann er mich kennen, wenn nicht einmal ich mich kenne?
Ich bin ein kleiner Angestellter in einem kleinen Büro und kein Krieger in einem Krieg, den ich nicht verstehe. Ich habe noch nie einen Menschen getötet, außer in Gedanken meinen Boss aus einer anderen Welt. Jetzt soll ich einen Feldzug vorbereiten, der sicher Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen, die ich auch nicht kenne, das Leben kosten wird oder sie für immer verstümmelt, verurteilt ein Leben lang dahinzuvegetieren und auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein.
Nein, das kann ich nicht, das darf ich nicht!
Oder doch, ist das mein neues Leben, mein nächstes Leben? Bestand mein Leben bisher nur aus einzelnen Episoden? Ist dies hier nur eine neue Episode?
Bin ich unsterblich, ein Wanderer durch die Zeit? Aber ich altere doch.
Was soll ich tun?
Ins Paradies zurück kann ich nicht. Zurück in die tödliche Wüste will ich nicht und zu meinem Daimler finde ich nicht zurück.
Ich bin hier, auf einem Hügel, eine riesige Armee unter mir, die meine Befehle erwartet.
Aber ich will nicht hier sein! Ich will nicht befehlen!
Wie kommt es eigentlich, dass ich mich mit allem so leicht zurechtfinde. Ich kann besser reiten als jeder andere hier, kenne alle Verhaltensweisen und den Ehrenkodex der Ritter. Tag für Tag werde ich mehr ein Krieger dieser Welt und werde der Mensch, der ich nicht sein will. Ich lebe mich immer mehr in die Rolle des Kriegsschergen ein.
Aber ich will das alles nicht... niemals!
Ein kräftiges Rütteln an meiner Schulter holt mich in die Realität oder was ich momentan dafür halte zurück.
»Lord Geward, entschuldigt die Störung, König Aldara hat mir aufgetragen Euch mitzuteilen, dass er Euch bei Sonnenaufgang in seinem Zelt erwartet.«
Ich danke dem Boten, der mir die angsteinflößende Botschaft überbrachte und stehe müde und unsicher auf.
Wie lange musste er nach mir gesucht haben, bis er mich hier fand?
Langsam, jeden Schritt bedächtig vor den anderen setzend, gehe ich in der ersten Morgendämmerung zurück zum Lager.
Es riecht bereits wieder nach kandierten Früchten, Honig und Nüssen. Der Duft nach frisch gebackenem Brot lässt meinen Mund wässrig werden und wieder überrascht es mich, obwohl ich es längst besser wissen müsste, wie früh die Bäcker ihr Handwerk beginnen.
Ja, das Lager ist weiß Gott zu einer kleinen Stadt angewachsen; verdammt, Aldara hat wirklich Recht. Die durchwachte Nacht und die wunderbaren Gerüche wecken meinen Appetit und wie auf Befehl, zupft mich eine vom Alter gekrümmte Frau am Ärmel: »Herr, wollt Ihr mein frisches Nussbrot probieren? Es ist ganz frisch und noch warm. Ich habe es selbst gebacken, bitte nehmt!«
Im Vorbeigehen nehme ich das Brot aus einer unendlich alten Hand, die von Jahren schwerster Arbeit tief gezeichnet ist, die mir die Köstlichkeit eifrig und zitternd entgegenstreckt, dann gehe gedankenverloren weiter.
Ich erschrecke bei dem Gedanken, der alten Frau nicht einmal die kleinste Gabe oder Freundlichkeit, geschweige denn, den ihr zustehenden Lohn gegeben zu haben.
Die Feuerröte steigt mir ins Gesicht und ich schäme mich bodenlos. Was ist bloß aus mir geworden?
Ein schmarotzender, auf Kosten anderer lebender, Möchtegern-Adeliger, ohne Skrupel eine arme Frau zu bestehlen, die sicher nur aus Angst die Bezahlung nicht einforderte.
Traurig gehe ich weiter.
Der schwere Gang Richtung Königszelt erinnert mich an den letzten Weg eines zum Tode Verurteilten. Ein Verurteilter, der nur noch wenige Minuten hat, sein Leben Revue passieren zu lassen und es irgendwie, auch wenn er nicht weiß wie, abzuschließen versucht. Förmlich rieche ich den süßwürzigen Geruch des dunklen, im kalten Morgen noch feuchten Holzes, der schweren... mein Gott, das Fallbeil ist noch größer, als ich dachte; ich höre das helle, schabende Sirren des Testes und sehe den zufriedenen Gesichtsausdruck des Henkers: »Ausgezeichnet, alles in Ordnung.« Ich sehe den Henkersgehilfen das Fallbeil neu spannen. Entdecke die hölzerne Bank und den Halteriegel. Der Korb, der meinen blutspritzenden Kopf auffangen soll, steht ebenfalls schon bereit. Mein Gott, es gibt kein Entrinnen. Keine Möglichkeit der Flucht. Mein Kopf wird wild rollend, mit einem leisen Plop in den Weidenkorb fallen und Hunderte begeisterte Zuschauer werden klatschen und johlen. Väter werden ihre Kleinsten auf die Schultern nehmen, um nichts zu verpassen. Kinder werden vergnügt gebrannte Mandeln kauen und junge Frauen werden kokett kichern und meine toten Augen werden in den Morgennebel starren oder vielleicht im dunklen Boden des Korbes ertrinken und dann...
... Finde ich endlich wieder aus meinen Ängsten zurück.
Überall in den Zeltgassen ist Leben. Leben, das mir die Angst nimmt; Leben das mich zurückholt, aber diese Kleinstadt wird sicher in keinen Krieg ziehen, nie mehr, niemals!
Es hat sich tatsächlich ein Dorfplatz gebildet. Jetzt im Morgengrauen sind noch viele Buden geschlossen, aber in Kürze, nach Sonnenaufgang, werden die eifrigen Handwerker und Händler lautstark ihren Geschäften nachgehen.
Das Gerücht hatte also gestimmt: Keine fünfzig Schritte vor mir sehe ich drei Fuhrwerke mit über zwei Meter hohen, knallbunt bemalten Aufbauten. Eindeutig Gaukler, Artisten oder Puppenspieler.
Immer näher komme ich dem Zelt des Königs, ohne eine Lösung für den Krieg gefunden zu haben. Meine Schritte verlangsamen sich immer mehr. Wie der Feldzug komme auch ich zum Stillstand.
Ich drehe um. Schließlich habe ich bis zum Sonnenaufgang, noch etwas Zeit. Ich bin fest entschlossen meine Gnadenfrist bis zur letzten Minute zum Nachdenken zu benutzen. Vielleicht geschieht ein Wunder, vielleicht finde ich eine Lösung für mich und meinen König.
Halt Stopp! Nein, nein, was rede... was denke ich da: »Mein König«. Unsinn! Ich bin kein Sklave, kein Diener irgendeines Königs, auch nicht, wenn dieser mich als Schwiegersohn auserkoren hat.
Was interessiert mich seine Tochter? Ich kenne nicht einmal ihren Namen. Eine namenlose Braut, was für ein Witz. Sicher ist sie hässlich, dumm und verzogen. Sonst hätte er sicher eine bessere oder reichere Partie für sie gefunden und nicht mich, Lord Geward, der nur der Sohn König Abis, dem Bruder König Aldaras ist.
Zwei Königreiche, die zusammen sicher größer und mächtiger als das ganze Mitländerreich mit seinen unzähligen, untereinander verfeindeten Kleinstkönigreichen wäre.
Meine Heirat mit der Tochter Aldaras wäre doch eine lohnende Verbindung, welche die zwei größten Reiche für immer verbinden könnte. Nach Vaters und Onkels Tod wäre ich der Herrscher über ein Megareich, das zu durchwandern Monate des intensiven Reitens erfordern würde.
Mein Gott, welche Macht werde ich besitzen.
Im Grunde ist es doch gleich, wie die Prinzessin, deren Name ich immer noch nicht kenne, aussieht. Wie sagte einmal ein weiser Trunkenbold: »In der Nacht sind alle Katzen grau.«
Die Prinzessin wird mich so wenig lieben, wie ich sie, aber ich müsste meine Kammer ohnehin nur so lange mit ihr teilen, bis mindestens ein Erbe geboren ist. Kein Problem und sicher kein großes Opfer für das größte Reich aller Zeiten. Die beiden Reiche zusammen könnten in nur wenigen Wochen die Mitländer überrollen und restlos für alle Zeiten auslöschen. Ihre fruchtbaren Felder im Mittelland werden uns dann vorzüglich ernähren. Alleine die Felder im Süden Mittlands ernähren leicht dreißigtausend Soldaten.
Mit einer derart gut genährten Armee, die nicht von Nachschubproblemen behindert ist, beherrsche ich dann in spätestens zwei Jahren, auch die Länder am See und die Bergländer im Osten werden sich, ohne die Lebensmittellieferungen aus den Tälern, sicher kampflos ergeben.
Den Seenomaden mit ihren riesigen Handelsschiffen ist es egal, wer ihr Herr ist, solange sie nur ihren einträglichen Geschäften nachgehen können.
In weniger als dreißig Monaten bin ich der uneingeschränkte Herrscher über das ganze Land.
Mit meinem Vater und meinem Onkel werde ich nach meiner Hochzeit schnell fertig. Ein Becher vergifteten Weines, ein Sturz von der Mauer oder ein bezahlter Meuchelmörder, und auch Jagdunfälle passieren doch immer wieder.
Ja, in nicht einmal drei Jahren bin ich der Herrscher der Welt.
In größenwahnsinnige Gedanken versunken, stolpere ich über eine flache Wurzel.
Bäuchlings falle ich in eine von der Nacht noch feuchten Mischung aus Gras und Moos. Ein herrlicher Geruch.
Der Geruch des Paradieses, das ich verloren habe.
Oder ist auch hier das Paradies?
Ich denke an den friedlichen See.
Denke an...
Denke an den Mord, Macht und Habgier, Krieg und wieder Tod.
Nein, das ist kein Traum!
Es ist die Wirklichkeit. Ich bin hier, um Krieg zu führen, um Länder zu erobern, bin sogar bereit eine Frau zu heiraten, die ich nicht kenne, nur um...
Nein! Schluss! Ich verschwinde. Gehe weg von diesem blutigen Ort, bevor er mich ganz verschlingt.
Ich bin der Wanderer, der einsame Wanderer und der Wanderer geht jetzt fort, geht zu seiner Hütte, zurück zu seinem kleinen Paradies.
Ich gehe zur Koppel, sattle Jalas und führe ihn ohne beachtet zu werden in Richtung Dorfplatz. Scheinbar haben auch die Wachen längst jede Aufmerksamkeit verloren.
Die ersten Händler bestücken bereits ihre Verkaufsstände und von Minute zu Minute steigt ihre Geschäftigkeit. An einem kleinen Stand fülle ich meine Satteltaschen randvoll mit Trockenbrot, Dörrobst, Nüssen und reichlich Salzfleisch.
Dieses Mal vergesse ich nicht zu bezahlen und gebe, wahrscheinlich um mein Gewissen wegen meines Betruges an der alten Frau zu beruhigen, einen großen Goldtaler.
Blitzartig erkenne ich, dass gerade der Goldtaler meine Flucht verrät, der mit den Worten empfangen wird: »Lord Geward, Ihr seid so großherzig zu dem niedrigsten Eurer Untertanen.«
Ich versuche meinen Fehler damit zu korrigieren, indem ich dem Händler erkläre, in geheimer, diplomatischer Mission im Namen des Königs unterwegs zu sein und er über meinen Aufbruch schweigen müsse.
Mit nicht enden wollenden Verbeugungen versichert er mir seine absolute Verschwiegenheit.
Ich glaube ihm nicht, lasse es aber auf sich beruhen. Was sonst hätte ich auch tun können, ohne nicht noch mehr Aufsehen zu erregen?
Im Versorgungslager fülle ich meine beiden Wasserschläuche und verlasse kurz nach Sonnenaufgang das Lager.