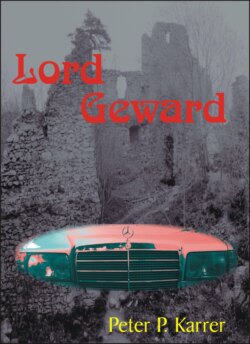Читать книгу Lord Geward - Peter P. Karrer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление6. Erkenntnis
Der nächste Tag beginnt mit einem Schock.
Mein Besucher, mein einziger Freund ist verschwunden. Sicher, eigentlich rechnete ich damit, aber trotzdem, die Wahrheit ist doch traurig.
Langsam, meine Gedanken sortierend, suche ich vergeblich nach Spuren am Ufer und auch unsere Lagerstätte zeigt mir nur meine eigenen Spuren. Alle Abdrücke sind barfüssig oder profillos wie meine weichen Stiefel, also meine eigenen. Aber Abraham Lincoln trug Lederschuhe oder Stiefel mit dicken Sohlen, genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall aber mit Absätzen, welche tiefe Spuren im feuchten Sand hinterlassen hätten.
Nicht der kleinste Abdruck ist zu finden.
Spielen mir das Alleinsein und die Einbildung einen Streich? Oder träume ich schon wieder?
Nein, mein Besucher war real und ich bin wieder allein.
Einsam, in einem Land in dem jeder vergisst, nur ich nicht. Im Gegenteil. Jeder Morgen ist wie der vergangene. Jeder Tag gleicht dem anderen. Jede Landschaft ist wie die gestrige.
Doch ich erinnere mich jeden Tag an immer mehr. An meinen verhassten Job im Büro und an meinen Daimler. Ich erinnere mich sogar an meine Nachlässigkeit, die treue Kaffeemaschine nie zu entkalken.
Die durchzechte Nacht liegt vor meinen Augen, als wäre es gestern gewesen. Die Enttäuschung, wieder nicht die Liebe meines Lebens in stinkenden Bierkneipen gefunden zu haben. Das Akzeptieren der harten Wahrheit... Frauen lernt man nicht in Kneipen - zumindest nicht in meinen Kneipen - kennen.
Mir fällt mein nächtlicher Beichtvater, hinter dem schmuddeligen Tresen, in der letzten Kneipe ein.
Ein Barkeeper mit wässrigen, vom Rauch geröteten Augen und aufgedunsenem Gesicht und blasser Haut, immer bemüht, aufmerksam zu wirken. Dem Mann, den ich mein ganzes Leben erzählte. Ihm, den ich nicht einmal kannte, beichtete ich den ganzen Kummer meines Daseins.
Ein Barmann, der sicher Hunderte gleicher, ach so traurige Schicksale, auswendig aufsagen konnte und doch jedem aufmerksam zuhörte und jeden ausgesprochenen Schicksalsschlag, mit einem aufmunternden Kopfnicken quittierte.
Barkeeper! Ein Geistlicher der Industriezeit. Ein Vater für Familienlose, im Büro gepeinigter, von der Liebe enttäuschter Menschen, die mit dem Leben abgeschlossen haben.
Ein Mann, der zuhört, wenn auch nur für ein gehöriges Trinkgeld und astronomischer Umsatzbeteiligung.
Aber doch zuhört.
Wie oft habe ich meine Trauer, Wut und Enttäuschung mit ihm geteilt.
Einem Mann, den ich hinter dem Tresen gefangen sah und der mir und meinen Sorgen, nicht entfliehen konnte.
Der Frust und die eigenen Vorwürfe am nächsten Morgen wieder viel zuviel erzählt zu haben und sich einfach unter der Last der Sorgen und des reichlichen Alkohols lächerlich gemacht zu haben.
Die eigenen Vorwürfe einfach mit dem Argument, „In der Kneipe kennt mich ja niemand und wenn doch, scheißegal!“, beiseite zu drängen.
Ja, ich kann mich erinnern, und wie ich mich erinnern kann!
Mein Gott ja, aber wo bin ich? Wo soll ich hin?
Aus den Erinnerungen losreißend, zelebriere ich, wie jeden Morgen, mein Bad im frischen See. Immer wieder ertappe ich mich dabei, mich zum Ufer umzudrehen, um Abraham Lincoln oder einen anderen Besucher zu sehen. In der Mitte des Sees wende ich und beobachte mindestens zwanzig Minuten lang meinen Lagerplatz.
Schwankend zwischen der Enttäuschung wieder alleine zu sein und der Furcht ein neuer Fremder könnte ein Feind sein, schwimme ich ans leere Ufer zurück.
Heute kleide ich mich sofort wieder an. Der Schock nackt vor Präsident Lincoln gestanden zu haben, steckt noch tief in jeder Faser meines Körpers. Selbst meine Stiefel, die ich meist nur während der Wanderung trage, ziehe ich sofort an.
Alleine mit meiner Enttäuschung lasse ich mich auf meinem kargen Lager nieder.
Ich lasse meine Gedanken kreisen, aber immer darauf bedacht, nicht wieder in die verhassten Tagträume zu versinken.
Welch seltsamer Ort ist das? Ein Ort, an dem man träumt, vergisst und endlos alleine wandert.
Der Gedanke alleine zu sein, droht mich wieder zu überrollen. Abschütteln, nur nicht in Panik geraten, nicht in eine Traumwelt flüchten!
Ich konzentriere mich und besinne mich auf meinen Meister. Der Shaolin Mönch, wie ihn Hollywood nicht besser hätte zeichnen können, der mich in Meditation unterwies - der Grundlage jeder Konzentration.
Eine Übung bestand darin, eine Schale mit Nüssen abzudecken. Der Lehrling konzentrierte sich, die Schale wurde kurz aufgedeckt und der Lehrling musste die Anzahl der Nüsse nennen.
Als Anfänger versuchte ich immer, in dem kurzen Augenblick die Nüsse zu zählen. Ein Versuch, der immer scheiterte.
Mein Meister unterwies mich, nicht die Nüsse zu betrachten, sondern sich auf die ganze Schale zu konzentrieren und das Bild, während des kurzen Aufdeckens, im Kopf zu behalten. Nach dem erneuten bedecken der Schale, die Augen zu schließen, das Bild sich ins Gedächtnis zurückzurufen und in Ruhe die Nüsse zu zählen.
In nur wenigen Wochen konnte ich die Anzahl der Nüsse so präzise nennen als wäre die Schale nie abgedeckt gewesen.
Achtung, schon wieder ein Tagtraum. Ich war nie in einem Shaolin Kloster, nicht einmal als Tourist. Aber wie sagte Abraham Lincoln: »Hier gibt es keine Träume, es sind nur Deine Erinnerungen.«
Ich beginne zu fühlen oder zu glauben, dass meine Tagträume nicht meine Rivalen sind. Im Gegenteil, mehr und mehr lerne ich sie zu steuern, zu benutzen, nicht abzugleiten, nur zu nutzen als einen riesigen Wissensschatz. Nach und nach lerne ich, in meinen Träumen und Fiktionen, wie in einem riesigen Lexikon zu blättern.
Mit jedem Tagtraum wächst mein geistiges Lexikon. Beinahe glaube ich alles zu wissen, wenn ich mich nur genügend konzentriere und gleichzeitig meinen Träumen genügend Raum gebe, andererseits vergesse ich schneller, als ein durchlöcherter Eimer.
Ich beschließe analytisch und wissenschaftlich alle Fakten über diese Welt zu sammeln und versuche das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen.
Was bleibt?
Das Land ist scheinbar endlos und wiederholt sich im Inhalt, aber nicht im Detail.
Abraham Lincoln empfand oder erkannte es als das Land seiner Kindheit. Er kannte die Früchte, die mein Überleben seit Tagen sichern. Für ihn als Kind waren es die Lieblingsbeeren.
Sicher ist, ich gehöre nicht hierher!
Lincoln fühlte sich hier zu Hause. Ich bin, auch wenn ich nicht weiß wie oder warum, in seine Welt eingedrungen.
Ich bin der Eindringling, der Feind, der archaisch schwer bewaffnet in die Welt seiner Kindheit eingedrungen ist.
Ich muss diese Welt verlassen. Mein Weg nach Westen hält mich gefangen. Es muss einen anderen Weg geben! Einen Weg zurück in mein Leben. Raus aus der Welt der Wiederholungen, der immer gleichen Kulisse.
Sicher ist jedenfalls, das Wandern gegen Westen ist sinnlos, es führt nur in die Unendlichkeit. Ich muss prüfen, in wie weit diese Welt unendlich ist oder sich nur laufend erneuert. Ich denke wieder an den Film: Und täglich grüßt das Murmeltier.
Der erste Einsatz für mein Schwert, wenn auch etwas entwürdigend, ist gefunden. Ich ritze Markierungen in die Bäume der Umgebung. Von einer Birke schlage ich einen winzigen Ast ab.
Die Hebelwirkung und die Ungeheuere Wucht meiner Waffe überrascht und begeistert mich zugleich. Vor meinen Augen erscheint ein Ritter zu Pferd, der sein Schwert schwingend, eine gewaltige Menschenmasse niedermetzelt. Ich sehe Köpfe rollen, verstümmelte Arme und Beine wild verstreut durch die Luft fliegen und höre schwer Verwundete im Todeskampf schreien.
Ich kürze das abgeschlagene Holz auf ungefähr zwanzig Zentimeter und lasse es in den tiefen Taschen, meines Umhanges verschwinden.
Ich denke an ein Puzzle. Wenn ich später eine Birke mit abgeschlagenem Ast finde, könnte ich prüfen, ob mein Stück passt.
In Erinnerung an meine erste Jugendliebe graviere ich meine Initialen in mühsamer, schweißtreibender Arbeit in einen kleinen Felsen, der mir bisher als Rückenlehne diente.
Als Letztes leere ich den Beerenstrauch bis zur letzten Frucht. Die Beeren, die ich nicht in meine Taschen stopfen kann, verteile ich am Boden. Etwas unwohl wird mir bei den Gedanken: Soll ich mich freuen den leeren Strauch wieder zu finden und zu verhungern, nur um zu beweisen wie diese Welt beschaffen ist und sie doch nicht so endlos ist?
Ein Märchen aus der Kindheit versetzt mich endgültig in Panik.
Wie war das noch? War da nicht die Sache mit dem Teller, der sich immer wieder füllte, solange nur immer ein kleiner Rest auf ihm zurückbliebe. Sollte mein Strauch keine Beeren mehr hervorbringen, weil ich nicht nur die benötigten erntete, sondern den Rest achtlos auf dem Boden verschwendete und zum Vertrocknen verurteilte. Mein Gott, was habe ich getan!
Nein, Tagträume, nur Tagträume!
Mit einem letzten Blick auf mein Lager, präge ich mir möglichst viele Details ein. Im Losgehen markiere ich noch einen Pfeil in den weichen, feuchten Sandboden, dann halte ich inne, überlege und beschließe mein Experiment noch zu verfeinern. Ich schlage einige, ein Meter lange, dünne Äste eines schlanken, mit roten Blättern bewachsenen Haselnussstrauches ab und packe so viele wie möglich unter meinen linken Arm.
Bei jedem Wanderstopp ramme ich einen in den Boden, in der Hoffnung meine zurückgelegte Strecke später peilen zu können.
Während der stundenlangen Wanderung denke ich an Albert Einstein.
Wie war das? Zwei Parallelen treffen sich in der Unendlichkeit, Raumkrümmung und lauter so Sachen, von denen ich noch nie besonders viel verstand und zugegebener Maßen auch nie besonders interessierten.
Immer wieder drehe ich mich um und stelle fest, meine Wanderroute gleicht eher einem Zickzackkurs als einer geraden Linie, aber wenigstens halbwegs in eine Richtung: nach Westen. Meine Sehschärfe aber habe ich weit überschätzt. Schon nach kurzer Zeit kann ich meine ersten Markierungen nicht mehr sehen. Mein Experiment, zumindest der Teil des Peilens, ist kläglich gescheitert.
Nach mehreren Tagen erkenne ich resigniert, auch mein Vergleichsast ist wertlos. Einzig und allein meine Erinnerung hilft mir weiter. Täglich gehe ich einen ähnlichen Weg, treffe auf den selben, den gleichen, oder einfach nur ähnlichen See, aber nie finde ich meine alten Markierungen am Lagerplatz.
Leichte Veränderungen entdecke ich immer, oder ich bilde sie mir ein. Einmal ist der See breiter, ein anderes Mal sind die Bäume größer.
Die einzige, wenn auch wichtige Erkenntnis des tagelangen Experimentes, sind die bisher immer reichlich mit Früchten gefüllten Sträucher.
Mein einziger Trost: wenigstens finde ich genug zu Essen.
Nach weiteren vier Tagen sinnloser experimenteller Wanderung ändere ich meine Richtung um zirka neunzig Grad, Richtung Norden. Oder ist es Süden? Mit den Himmelsrichtungen bin ich mir immer noch nicht sicher.
Egal, wichtig ist die Marschrichtung um neunzig Grad zu verändern - hoffe ich.
Auch dieser letzte, verzweifelte Versuch änderte nichts. Am Abend finde ich wieder meinen mittlerweile verhassten See mit dem verteufelten Ufer und den immer gleichen reifen, blauen Beeren.
Wie hasse ich jetzt diese kleinen klebrigen Dinger!
Den einzigen Trost gibt mir mein Schwert, das sich nicht verändert, das nicht wiedergeboren wird. Ich kann ganz deutlich die Abnutzungen erkennen, die entstanden, als ich vor werweiß wie vielen Tagen den Felsen mit meinen Initialen kennzeichnete.
Der heutige Tag ist der Schlimmste, seit ich diese Welt betrat oder besser in diese Welt geschleudert wurde.
Seit dem Morgen jagen mich unkontrollierbare Tagträume, gefolgt von tiefer Niedergeschlagenheit. Abends in meinem verhassten, immergleichen Lager sinke ich in einen Strudel von Depressionen und wirren Träumen.
In endlosen Albträumen jagt mich ein schwarzer Ritter mit dem Gesicht Abraham Lincolns, ich werde vor ein Gericht gestellt und meine Kaffeemaschine klagt mich wegen mangelnder Fürsorge an und für das Eindringen in Abraham Lincolns Kindheit werde ich zu ewiger Wanderschaft verurteilt...
Gott, was für Visionen muss ich erleiden!
Meine liebgewordene Gewohnheit, im See zu baden, fällt heute aus.
Ich weine, schluchze und schreie mit aller Luft meiner Lungen, will diesen Horror nicht einmal mehr verlassen, will nur noch sterben, nie mehr aufwachen, nie mehr wandern, nie mehr an einen See ankommen, einfach nur sterben.
Aber was, wenn ich bereits tot bin? Wenn dies hier, das ewige Leben ist. Mein Gott, was soll ich nur tun?
Hilf mir Gott, bitte hilf mir!
Wut und Verzweiflung übermannen mich. Bis zur völligen Erschöpfung schlage ich wie ein Verrückter mit meinen Fäusten auf den blanken Boden ein. Außer Atem, von Tränen geschüttelt sinke ich erschöpft und niedergeschlagen in den immer gleichen warmen gelben Sand.
Auch in der nächsten Nacht plagen mich Horrorfantasien und Panikattacken. In endloser Trauer im Meer des Selbstmitleides ertrinkend, den Morgen herbeisehnend, wälze ich mich durch die nicht enden wollende Nacht.
Ich zähle die Tage nicht mehr, fürchte mich nur noch vor den Nächten, wache bis zum Morgen und verstecke mich vor der nächsten Nacht.
Nach Tagen der Lethargie trifft mich der Blitz der Realität. Die Beeren, sie sind weg, wachsen nicht mehr nach! Jetzt muss ich verhungern.
Das Ende der Wanderschaft ist gekommen.
Diese Erkenntnis löscht, wie eine eiskalte Dusche nach einem heißen Saunagang, jede Depression. Ich bin hell wach.
Ich will überleben, nicht sterben, nicht in dieser endlosen Kulisse, muss zurück zum letzten Lagerplatz, muss ihn finden, muss neue Früchte finden, muss muss muss...
Ich bade ausgiebig und sortiere meine spärliche Ausrüstung. Am Abend von meiner Wanderung zurück schlafe ich, zu meiner eigenen Verwunderung, ruhig und ohne Depressionen ein. Meine letzten Gedanken vor dem Einschlafen sind: Ich lebe, werde überleben, werde in mein Leben zurückkehren, werde diese Welt verlassen.