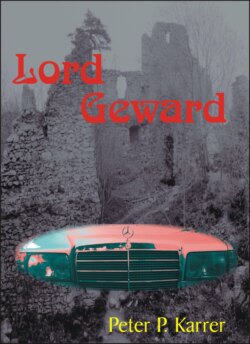Читать книгу Lord Geward - Peter P. Karrer - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление10. Die Karawane
Nach wenigen hundert Metern sporne ich meinen treuen Freund Jalas zu einem schnellen, aber immer noch leisen Schritt an und spüre mit jedem zurückgelegtem Meter mehr das wunderbare Gefühl der Befreiung.
Langsam glaube ich wieder, ich selbst zu werden.
Gegen Mittag rasten wir ausgiebig an einem Bach, der an einem kleinen Laubwald entlangfließt.
Nachdem Jalas und ich den ersten Durst löschten - das Wasser schmeckt ausgezeichnet - bedient er, Jalas sich nun an dem üppigen, im Schatten immer noch frischen Gras und ich verschlinge in einem Anflug von Heißhunger und dem Gefühl, gerade noch rechtzeitig entkommen zu sein, einen halben Laib Nussbrot und drei armlange Streifen Salzfleisch. Zur Sicherheit, obwohl ich noch genügend Wasservorräte habe, gieße ich die Wassersäcke aus und fülle sie randvoll mit frischem Wasser.
Am Abend bereite ich mir ein Nachtlager auf einem annähernd hundert Meter hohen Felsplateau und beobachte bis weit in die Nacht hinein, das hinter mir liegende Tal und zu meiner Zufriedenheit entdecke ich keine Verfolger.
Nach einem üppigen Mahl aus Nüssen und getrockneten Früchten - ein Feuer für eine warme Mahlzeit wage ich noch nicht zu entfachen - schweifen meine Gedanken ab.
Ich rieche den herben Duft der schwarzen Ledersitze meines Daimlers, spüre die Kälte im ewigen Eis Grönlands, höre das Knarren des alten Holzbodens bei den endlos monotonen Schlossführungen meines Großvaters, höre die Worte Abraham Lincolns: »Sicher bin ich schon tausende Male wiedergeboren!«, spüre das weiche Wasser meines Sees und fühle die Schmerzen der mit Sand gefüllten Augen in der tödlichen Welt der Wüste.
Wie bin ich in die Höllenglut geraten und wie bin ich daraus entkommen?
Die Erinnerungen daran erschrecken mich und ich fühle das Brennen der verbrannten Haut und beginne den trockenen Staub zu riechen.
Seit langem habe ich wieder Angst vor der Nacht. Wache ich morgen neben Jalas auf oder in einer tödlichen Welt oder in den Fängen König Aldaras, der mich für meinen Verrat sicher eigenhändig erschlagen wird?
Ich habe Angst einzuschlafen, versuche wach zu bleiben, denke an schöne Dinge, an mein Schloss, meine Hütte, mein Reich, in dem ich so glücklich war. Erinnere mich an...
Weit weg, ein knirschendes und polterndes Geräusch.
Verteufelt, Aldara hat mich entdeckt!
Wie hat er das nur geschafft? Wie konnte er mir folgen, ohne von mir im Tal entdeckt zu werden?
Jetzt bin ich hell wach, keine Spur mehr von Müdigkeit. Auch Jalas muss sie gehört haben. Um ihn zu beruhigen, tätschle ich seinen Hals und er quittiert es mit einem unterdrückten, leisen Schnauben.
Es ist nichts zu sehen. Nur das deutliche Geräusch von schweren Fuhrwerken und Stimmen, die ich nicht verstehen kann.
Aldaras Truppen? - Unmöglich!
Aldara würde eine Schar schneller Reiter hinter mir her senden und keine Ochsenkarren. Auch wenn meine Flucht sofort entdeckt worden wäre... und Fuhrwerke hätten mich sowieso noch nicht eingeholt. Das ist absolut unmöglich!
Aber was höre ich dann?
Den ganzen Tag über sah ich keine Felder, keine Bauern und keinen Hof. Auch wenn ich sie übersehen hätte, kein Bauer fährt seine Ernte in stockfinsterer Nacht ein.
Wieder höre ich vereinzelte Stimmen. Verstehen kann ich sie immer noch nicht. Sicher sind es nur die leisen Worte der Kutscher, die ihre Gespanne durch die beinahe mondlose Nacht dirigieren.
Sicher bin ich mir nur, schwere Fuhrwerke mit eisenbelegten Rädern, die sich ihren Weg auf dem steinernen Weg unter mir bahnen, zu hören. Das Geräusch wird deutlicher. Immer öfter höre ich das Murren der unwilligen, mit der schweren Last überforderten Zugtiere.
Es müssen mehrere Gespanne sein.
Jetzt werden die Geräusche leiser und ich erkenne die ersten Fackeln.
Die Fuhrwerke müssen gestoppt haben und in der eintretenden Stille gelingt es mir, einige Wortfetzen zu verstehen: »Wir... kein Weiterkommen... verdammte Nacht... Pferde... alle Knochen... Ruhe wollt ihr... sie uns... entdecken... halt sie still... nicht mit der Fackel... was geht mich der scheiß Krieg an.«
Ich lege, ohne das geringste Geräusch zu verursachen, mein Schwert, das mich nur behindert hätte, neben Sattel und Satteltasche, dann schleiche ich leise nach unten.
Auf halber Strecke rutsche ich aus, Steine rieseln, ich erstarre, lausche, aber das Stimmengemurmel hat seinen Klang nicht verändert. Noch vorsichtiger, jeden Schritt genau prüfend, bevor ich mein ganzes Gewicht darauf lege, bewege ich mich weiter in Richtung der unheimlichen Besucher.
Bis auf fünfzig Meter kann ich mich anschleichen, dann beginnt eine breite, strauchlose Geröllgasse, die mir keine Deckung mehr gibt. Erst nach mehreren Minuten beruhigen sich Puls und Atmung und ich kann die Stimmen wieder deutlicher verstehen.
Ein knappes Dutzend Männer richten sich ein offenes Lager ohne Zelte ein. Genauso wie ich, verzichten sie auf ein offenes Feuer und löschen auch die wenigen abgedunkelten Fackeln. Ich gewinne den Eindruck, auch sie möchten nicht entdeckt werden.
Inwieweit das gut für mich ist, traue ich mich nicht zu fragen: Ich habe Angst vor der Antwort!
Ich nehme eine bequemere, fast liegende Haltung ein und harre der Dinge, die auf mich zukommen.
Die Reiter und Kutscher wickeln sich, mit Ausnahme eines der Bewegung nach sehr jungen Mannes, der Wache bei den Pferden hält, in dicke Felldecken ein.
Bei dem Gedanken an warme Felle fröstelt mich. Mein Umhang, den ich im Lager Aldaras zurückließ, würde mich sicher besser wärmen, als die mit Silberschnallen besetzte Lederweste, die sicher meinem oder irgendeinem Stand entspricht, aber nicht dazu geeignet ist, mich auf dem kalten Boden zu wärmen.
Da ich in der kalten Nacht, frierend, sicher wenig Neues auskundschaften kann, entscheide ich mich zum Rückzug. Zurück in meinem Feuerlosen Lager, wickle ich mich in meine wollene Decke, nicht ohne mein Schwert griffbereit neben mich zu legen und versuche einzuschlafen.
Am nächsten Morgen werde ich mich wundern, wie schnell ich trotz der Ereignisse eingeschlafen bin.
Es ist bereits taghell und die Sonne steht eine Handbreit über dem Horizont. Im Aufstehen schnalle ich mir in gewohnter Routine, mein Schwert um und erkenne, meine Besucher sind bereits weitergezogen. Sie haben ihr Lager sehr gründlich abgebaut. Nichts mehr zeugt von ihrer Anwesenheit. Sogar den in der Nacht angefallenen Pferdemist haben sie, um ihre Spuren zu beseitigen, gründlich entfernt.
Jalas sattelnd und ein Stück Dörrfleisch kauend, entscheide ich mich, mangels besseren Wissens und neugierig, zunächst den Fremden in sicherem Abstand zu folgen.
Bereits nach nicht einmal einer Stunde, erkenne ich am Horizont, die schwerfällige Karawane. Die Sonne im Rücken, durch Hügel und niedrige Bäume geschützt, rücke ich näher an die Fremden heran.
Jetzt erkenne ich, bei Tageslicht, deutlich ein halbes Dutzend, mit Schwertern bewaffnete Reiter - Ritter sind sie aber nicht - und zwei massive Fuhrwerke, wie ich sie noch nie gesehen habe, die eine Unzahl Männer begleiten. Die Speichen der überbreiten Räder entsprechen mindestens dem Durchmesser meines vom Reiten trainierten Oberschenkels. Die seitlichen Aufbauten sind keinen Meter hoch, aber die sonst üblichen Seitenbretter sind hier massive kleine Baumstämme. Jeder der Wagen wird von vier ausgewachsenen Ochsen gezogen. Jeder Ochse wird von einem Mann begleitet und neben jedem Rad marschieren zwei weitere Männer, die regelmäßig in die Speichen greifen, um das Gefährt in Bewegung zu halten. Zwischen den beiden Fuhrwerken gehen weitere Männer und packen je nach Bedarf bei dem einen oder anderen mit an.
Wieder muss ich mir eingestehen in der Nacht die Anzahl der Männer, völlig falsch eingeschätzt zu haben. An meinen andauernden Fehleinschätzungen muss ich unbedingt arbeiten, wenn sie mir nicht einmal zum Verhängnis werden sollen.
Hier ackern mindestens drei Dutzend Männer an den Fuhrwerken, flankiert von schwer bewaffneten Männern, von denen keiner aber auch nur annähernd Ähnlichkeit mit Aldaras Leuten hat.
Dieser seltsame Tross erinnert mich unweigerlich an einen Goldtransport. Nur Gold könnte derart massive Fuhrwerke erfordern, aber trotzdem glaube ich nicht an einen Gold- oder vielleicht auch Silbertransport. Solche Ladungen werden in der Regel von Soldaten und Rittern begleitet, wie ich zu wissen glaube, aber diese Männer... nein, es muss sich um etwas anderes handeln!
Der Tross gleicht durchaus einer kleinen Armee, wenn auch die sonst üblichen Fahnen und Banner fehlen und die Schwertträger ungewöhnlich einfach gekleidet sind, aber Ritter... nein, sicher nicht, eher noch Räuber, Schmuggler oder anderes dunkles Gesindel.
Immer wieder reite ich, um in Hörweite zu bleiben, dem Schneckenzug in einem weiten Bogen voraus und verstecke mich in kleinen Tälern, Mulden oder Felsspalten.
Die Sprache ist in Nuancen anders als die bei König Aldaras Truppen, aber durchaus gut zu verstehen, wenn es mir gelingt nahe genug heranzukommen.
Ich schätze, der Tross wird, wenn er, wie ich vermute, über die Berge will, drei bis vier Wochen unterwegs sein. Eine Strecke, für die ein guter Reiter höchstens zwei Tage braucht, aber dieser Schneckenzug?
Zum Abend hin lasse ich mich weiter zurückfallen, um heute wenigstens ein kleines Feuer für eine warme Mahlzeit zu entzünden. Alleine die Vorfreude an einen Brei aus getrocknetem Getreide und Dörrfleisch lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Meinem stolzen, vor Kraft strotzenden Hengst Jalas ist die Unruhe über das seit Stunden langsame Vorankommen deutlich anzumerken. Nachdem wir die Schneckenkarawane aus den Augen verloren haben und ich mich sicher fühle, lasse ich Jalas freien Lauf. Uns ungestüm austobend, jagen wir in Richtung einer Anhöhe, um dort unser Nachtquartier aufzuschlagen. Ich bin sicher, hätte ich Jalas nur wenig länger freien Lauf gelassen, wir wären wieder am Plateau, unserem Quartier der letzten Nacht, angekommen.
Diese seltsame Karawane ist wirklich unendlich langsam. Bis zum Abend dürften sie heute nur einige Meilen geschafft haben.
Laut lachend fällt mir ein Märchen aus meiner Kindheit ein.
„Die Schneckenpost.“
Jalas hat sich ausgetobt und auch mir hat der schnelle Ritt gut getan. Mein Kopf ist frei und mein Hunger gewaltig. Ich bereite mir einen warmen Brei aus Getreide, Dörrobst, gequetschten Nüssen, etwas Honig und trockenem Brot. Wahrlich ein Festmahl, das ich mit einem faustgroßen Stück weichen Käse abschließe.
Ich schlafe satt, zufrieden und ruhig ein und nach dem Aufwachen habe ich zuerst das Gefühl, nur kurz eingenickt zu sein.
Der Sonnenaufgang ist bereits weit fortgeschritten und Jalas hat sein Frühstück auf der saftigen Wiese längst beendet und wartet nur noch ungeduldig auf den Langschläfer.
Ich entscheide die Karawane heute noch weitläufiger zu umgehen, um in den Bergen, durch die nur ein Weg führt, näher an die Wagen mit ihrer geheimnisvollen Fracht heranzukommen.
Das Jagdfieber hat mich gepackt und ich muss diese rätselhafte Fracht durchleuchten. Ich weiß nicht warum, aber ich bin wie besessen von dem Gedanken, das Geheimnis zu lüften.
Gegen Mittag, die Sonne sticht mit unbarmherziger Härte, entdecke ich eine etwa vierzig Meter breite Schlucht, links und rechts von steilen Felsen flankiert. Wenn die Karawane, wie ich hoffe, über die Berge will, muss sie hier durch kommen.
Über einen steilen Seitenweg führe ich Jalas nach oben, lege Waffe und Jacke ab und klettere nach unten in die Schlucht. Wenig über dem Boden entdecke ich einen kleinen, knapp ein Meter breiten, gut vor Blicken von unten geschützten Felsvorsprung.
Nur durch einen dürren Strauch beschattet, lege ich mich auf die Lauer.
Die Wartezeit erscheint mir endlos.
Bis auf ein paar eifrige Grillen, die ihr trauriges Lied zirpen, ist kein Geräusch zu hören.
Nach nicht einmal einer Stunde ist die Sonne soweit gewandert, dass ich keinen Schatten mehr in meinem Backofenversteck finde. Immer wieder schlafe ich ein, um kurze Zeit später schweißgebadet aufzuschrecken. Ich stehe leicht gebückt auf, versuche etwas von dem kühlen Wind, der durch die Schlucht bläst, zu erhaschen, setze mich wieder, schlafe wieder ein, phantasiere von trockenen Wüsten und riesigen, stacheligen Kakteen, die mich verfolgen, und wache wieder gequält auf.
Wie lange soll ich hier noch schmoren? Was, wenn die Karawane einen anderen Weg genommen hat?
Die Hitze in meinem Versteck ist nicht mehr zu ertragen. Für heute gebe ich niedergeschlagen auf.
Oben angekommen, völlig ausgelaugt, einem Hitzschlag nahe, erkenne ich sofort meine Dummheit. Noch weit entfernt am Horizont, noch Meilen außer Hörweite entdecke ich die Vorhut des Trecks oder besser ihre Staubwolke. Mir wird klar, dieser träge Tross wird nicht heute, wahrscheinlich nicht einmal morgen, die Schlucht erreichen.
Hier oben ist die Sonne durch den kühlen Wind kaum zu spüren. Nur gelegentliche warme Schwaden erinnern mich an die heißen Strahlen. Etwas enttäuscht, aber doch zufrieden, wenigstens die Zugrichtung korrekt eingeschätzt zu haben, verdöse ich, wie auch Jalas, den restlichen Nachmittag bis zum Abend.
In der folgenden Nacht scheucht mich ein scharfer Gewitterregen auf, der in Minuten alles durchnässt. Keine dreihundert Meter neben mir zerschlägt ein Blitz einen abgestorbenen Baum, der explosionsartig in Flammen steht.
Bis auf wenige nervöse Bewegungen und ein kurzes Zittern nach jedem Donner, der das Trommelfell zu zerreißen droht, rührt sich Jalas, obwohl ich ihn seit Tagen keine Fußfesseln mehr anlege, nicht von der Stelle. Er ist wirklich ein außerordentliches Tier.
Die Morgensonne vertreibt die letzten Wolken und verwandelt meine Umgebung in ein türkisches Dampfbad.
Ich bin fest entschlossen, das Geheimnis noch heute zu lüften.
Ein kurzer Blick zeigt mir die längst wieder aufgebrochenen Männer, die aber immer noch Meilen entfernt sind.
Warten, wieder Stunden der Langeweile.
Am frühen Nachmittag erreichen dann doch die ersten Reiter den Eingang zur Schlucht. Nachdem sie beginnen ein Lager aufzubauen, bin ich mir sicher, sie heute nicht mehr durch die Schlucht kommen zu sehen.
Ärgerlich kehre ich zu Jalas zurück. »Verdammt, wieder ein Tag verloren,« fluche ich laut und ernte den verständnislosen Blick Jalas.
Ich muss noch einen Tag warten.
»Falsch!« korrigiere ich mich laut.
Wenn die Leute tatsächlich vor der Schlucht lagern, kann ich in der Nacht über den schmalen Seitenweg, ungesehen, bis auf wenige Meter an das Lager heran kommen.
Die Unachtsamkeit dieser Männer, die offensichtlich nicht entdeckt werden wollen, verstehe ich nicht und sehe es als Warnung, noch vorsichtiger zu sein.
Wer sind diese Männer?
Zusammen mit der Abendsonne erreicht mich der traumhafte Geruch von gebratenem Wild. Die Leute müssen sich aufgrund der Berge sehr sicher fühlen.
Wieder begreife ich das Verhalten dieser Männer nicht.
Ich wage kein Feuer zu machen und kaue in endloser Langeweile an einem zähen Stück Dörrfleisch, das ich mit lauwarmem, fade schmeckendem, abgestandenem Wasser hinunterspüle. Wäre ich gestern nicht so hemmungslos über meine letzten Käsevorräte hergefallen, hätte ich wenigstens etwas zu meinen trockenen Brotresten. Beschämt über meine gestrige grenzenlose Gier, kratze ich mit Mittel- und Zeigefinger die letzten Honigvorräte aus einem Holzbecher. Gedankenverloren verschließe ich den leeren Honigbecher mit einem Lederfleck und warte auf die absolute Dunkelheit.
Gegen Mitternacht brennen nur noch zwei Fackeln und das Feuer ist einem kleinen Gluthaufen gewichen, der nur noch etwas Wärme, aber kein Licht mehr spendet.
Vorsichtig mache ich mich auf den Weg nach unten.
Bereits auf halber Höhe bestätigt sich noch einmal, dass diese Leute, sich hier sehr sicher fühlen müssen, oder zumindest nicht mit jemandem von oben rechnen. Nur in der Schlucht und weit außerhalb davor sind Posten aufgestellt. Im Lager selbst schlafen, bis auf zwei Ältere und einen Jungen, alle am ausgehenden Lagerfeuer.
Von den Dreien, die noch nicht schlafen, geht keine Gefahr aus. Sie sind derart betrunken, dass ich mir sicher bin, sie hätten nicht einmal aufstehen können, wenn der Teufel persönlich sie beehrt hätte.
Die drei sitzen sich mit den Händen im Sand stützend und mit den Knien balancierend auf dem blanken Boden. Plötzlich rutscht dem Jüngeren die Hand im Sand weg und er stürzt, wie in Zeitlupe, mit dem Gesicht flach in den Sand. Als er jetzt auch noch den anderen Arm, senkrecht wie eine Fahnenstange, den Weinbeutel fest umklammernd, nach oben streckt, können sich die beiden anderen vor Gegröle kaum mehr im Sitzen halten. Ich muss mich beherrschen, nicht lauthals mitzulachen; der Anblick ist wirklich unvergleichlich.
Nachdem das Gebrüll der beiden Anderen nicht so schnell aufhören dürfte, ergreife ich meine Chance und schleiche gebückt zu dem mir am nächsten stehenden Wagen.
Unter das Fuhrwerk geduckt, halte ich kurz inne, schaue mich um und lausche. Zu meiner Erleichterung stelle ich fest, dass einige der Männer durch das Gegröle der Betrunkenen geweckt wurden und die durch mich unruhig gewordenen Pferde jetzt den betrunkenen Kameraden zugeschrieben werden.
Von mir nimmt keiner Notiz.
Ich taste nach der Baumwollplane und klappe sie eine Armlänge zurück. Vorsichtig taste ich nach dem Inhalt. Ich fühle kalte Stahlstangen oder ähnliches. Meinen ersten Gedanken an Lanzen oder an das Quergestänge von Ochsenkarren verwerfe ich sofort als ich mehrere, ebenfalls metallische Seitenteile ertaste. An einer glatten, runden Stelle greife ich fest zu und versuche den Gegenstand vorsichtig, ohne den geringsten Laut zu verursachen, zu bewegen. Ich erstarre, als ich das Nachrutschen anderer Teile spüre und das metallene Klirren in meinen Ohren wie ein Gewitter nachhallt.
Wieder habe ich Glück. Niemand hat in dem Aufruhr, die stampfenden Pferde zu beruhigen, etwas gehört.
Aus den Augenwinkeln beobachte ich den sinnlosen Versuch des jungen Burschen sich aufzurichten. Gerade noch auf zwei Beinen stehend, mit beiden Armen wild rudernd, den Weinbeutel immer noch fest in der Hand, fällt er vorwärts, mit lautem Fluchen, mitten in die neben dem Feuer abgestellten Kupferkesseln und Kochutensilien.
Mit Gepolter und wildem Geschrei versucht er sich aus dem Gewirr aus Töpfen und Pfannen zu befreien. Der Henkel des großen Kessels will ihn gar nicht mehr loslassen und er stürzt wieder.
Das ist meine Chance. Ich packe den seltsamen Gegenstand mit aller Kraft und reiße ihn, mit einem Ruck, aus dem Wagen. Bewegungslos lausche ich. Keiner hat mich entdeckt.
Im Wegschleichen ziehe ich die Decke, über die Seitenhölzer, wieder zurück.
Immer noch kann ich meine Beute nicht erkennen. Oder glaube ich nur nicht, was ich erfühle?
Das kann nicht sein. Das darf nicht sein!
Nein, nicht in dieser Welt, nicht in dieser Zeit. Nein!
Die letzten Meter zu Jalas laufe ich, fast stolpere ich nach oben, werfe die Satteltaschen und Wasserschläuche auf Jalas Rücken, springe in den Sattel und reite einige Schritte leise, dann in rasendem Lauf weg, nur weg, weg von diesem Horror!
Nach dreißig Minuten wilder Hatz bin ich sicher, mein Feuerschein wird nicht mehr gesehen:
Ich entzünde eine Pechfackel, in der Hoffnung etwas anderes zu sehen, als ich vermute.
Mit dem Aufflammen der Fackel wird meine Hoffnung jäh zerschlagen.
Immer noch kann ich es nicht glauben, will es nicht akzeptieren.
Schwer halte ich in meiner rechten Hand eine Panzerfaust, wie ich sie bisher nur aus Kriegsfilmen kannte.
Ich stecke die Fackel in das weiche Gras neben mir, greife mit beiden Händen meine Beute, greife immer fester zu. Die Gelenke schmerzen schon und ich drücke weiter; beinahe glaube ich die Waffe aus dieser Welt quetschen zu wollen, will sie nicht sehen und wünsche einfach, sie weg zu haben.
Aber die Panzerfaust liegt fest, bedrohlich und bösartig in meinen Händen.
Zornig brülle ich mit Tränen in den Augen die Waffe an: »Verschwinde Du Scheißding, Du gehörst hier nicht her!«
Mein Zorn wird zur Raserei.
Sogar Jalas, der weder Blitz noch Donner fürchtet, scheut und springt einige Meter zur Seite.
Ich werfe die Waffe weit von mir weg in den losen Sand. Sie überschlägt sich beinahe, aber sie verschwindet nicht. Nicht aus meinen Augen und nicht aus dieser Welt.
Sie liegt nur bösartig grinsend, den Sprengkopf im Sand begraben, stumm da.