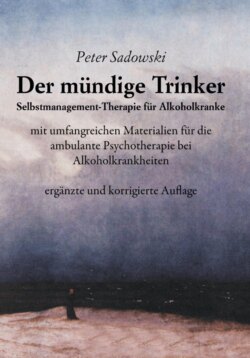Читать книгу Der mündige Trinker - Peter Sadowski - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.3 Zustandsabhängiges Lernen
ОглавлениеBei der Vermittlung von Informationen über Abhängigkeit an die Patienten fehlt in Suchtkliniken selten der Hinweis darauf, dass durch erneuten Konsum von Alkohol nach einer Behandlung die Wahrscheinlichkeit stark ansteigt, dass der Patient wieder in eine ungünstige Entwicklung abrutscht, wie sie vor der Behandlung bestanden hatte.
Unserer Begründung für das notwendige Anstreben dauerhafter Abstinenz ist folgende: Durch den Konsum von Alkohol wurde der intrapsychische Zustand verändert. Mit dem veränderten Zustand wurden im Verlauf der Abhängigkeitsentwicklung immer intensiver Gefühle und Gedanken assoziiert. Zu diesen Gedächtnisinhalten gehören z.B. eine starke Sehnsucht nach Wohlbefinden oder Gedanken, die es erlauben, die längerfristigen Folgen zu vernachlässigen oder beides (z.B.: „Ich denke jetzt nicht an meine Gesundheit.“ oder „Ich denke jetzt nicht an Partnerschaft oder Arbeit.“) 3 Dieser Sachverhalt wird gut von Patienten verstanden.
Ebenso lässt sich gut vermitteln, dass Kontextvariablen solche automatisiert ablaufenden Prozesse über Phänomene des zustandsabhängigen Lernens anstoßen können (siehe den entsprechenden Teil im Anhang unter Suchtinformation, Kapitel 8.1). „Wenn ich wieder in der Kneipe sitze, fällt mir leichter wieder ein, was ich in der Kneipe erlebt habe.“
Eine weitere Überlegung betrifft den Transfer von Informationen aus den Bedingungen der Therapie in das Alltagsleben des Patienten. Wenn ein Patient nach der Behandlung in einer als riskant identifizierten Situation ist, sollten die Bemühungen um vermehrte Selbstkontrolle (mit dem Ziel des Erhaltes der Abstinenz) zunehmend automatisierter ablaufen. Gleiches gilt für intrapsychische Zustände, die als kritisch identifiziert wurden (siehe auch Kapitel 3.2 „Individuelle Therapieziele“).
Grawe (1998) ordnet die Befunde zur Gedächtnisforschung so, dass die eben beschriebenen Phänomene dem expliziten oder konzeptuellen Gedächtnis zuzuordnen seien. Der weniger zugängliche Teil des Gedächtnisses wird bei Grawe implizit oder prozedural genannt. Der Zugriff auf diese Teile kann „nur prozedural aktiviert“ werden (Grawe, 1998, S. 240, Hervorhebung im Original).
Es wird sich also nach der Behandlung der einzelne Patient mit erhöhter Wahrscheinlichkeit an einige Gedächtnisinhalte aus der Therapie besonders gut erinnern, wenn er in gleicher Weise wie in der Therapie ritualisiert in einem Gesprächskreis mit anderen, unter Leitung eines Therapeuten, zusammensitzt; oder wenn sich in seinem Alltagsleben eine Situation ergibt, die große Ähnlichkeit mit dem Ritual des Einzelgespräches aus der Therapie hat.
Diese Überlegung spricht dafür, möglichst viele Anteile des Erlebens von Patienten an Situationen zu binden, die im Alltagsleben des Patienten Entsprechung finden. Wenn also Gespräche in einer lockeren Atmosphäre stattfinden, wenn der Patient dabei an einem Tisch sitzt, dabei möglicherweise auch Kaffee trinkt und auch mal lacht (wenn es etwas zu lachen gibt), sollte die Wahrscheinlichkeit erhöht sein, dass er einen verbesserten Zugang zu den dabei abgespeicherten Gedächtnisinhalten hat, wenn er sich in seinem Alltag in ähnlich unbefangenen Situationen bewegt.
Wenn man den Argumenten von Grawe folgt, eröffnet sich durch eine lockere, eher am Alltagsverhalten des Patienten angepasste Vorgehensweise die Chance, die Rückfallwahrscheinlichkeit zusätzlich günstig zu beeinflussen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der einzelne Patient auf Inhalte aus der Behandlung zugreifen kann, wäre auch außerhalb der als riskant identifizierten Situationen und der kritischen intrapsychischen Zustände erhöht.