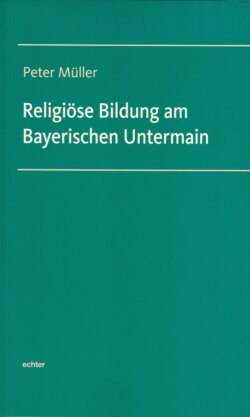Читать книгу Religiöse Bildung am Bayerischen Untermain - Peter Muller - Страница 11
2.1.4 Das Verhältnis von Spielen und Lernen im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan
ОглавлениеDer bayerische Bildungs- und Erziehungsplan baut auf dem in Schweden entwickelten „ko-konstruktiven Lernansatz“ auf. Er betont, wie im Bildungsverständnis bereits erwähnt, die meta-kognitive Ebene. Er zielt darauf ab, dass Kinder ein Verständnis für die Phänomene der Umwelt entwickeln und zugleich bewusst lernen. „Lernprozesse werden nicht mehr als bloße Wissensaneignung verstanden, sondern als aktive und kooperative Formen der Wissenskonstruktion und des Kompetenzerwerbs. Soziale und individuelle Formen des Lernens gehen Hand in Hand. Die Unterstützung der Kinder bei ihren Lernprozessen erfordert sozialen Austausch auch dann, wenn Lernbegleiter wie Medien und Bücher Einsatz finden.“28 Entscheidend für den Lernfortschritt ist die Qualität des geforderten Interaktionsgeschehens. Verantwortlich für deren Moderation ist die jeweilige Fachkraft. Der Plan betont wie wichtig es ist, das Interesse mit den Kindern zu teilen, herauszufinden, wie sie Dinge erleben und verstehen, mit ihnen gemeinsame Aktivitäten durchzuführen, sich mit ihnen im steten Dialog zu befinden und das Lerngeschehen immer wieder für Kinder zu visualisieren, z. B. durch Fotos und Aufzeichnungen. Kinder und Erwachsene werden zu einer „lernenden Gemeinschaft“, in die sich jeder mit seinen Stärken und seinem Wissen einbringen kann. Die Grenzen zwischen Lehren und Lernen verwischen. Auch hier werden Kinder zu Mitgestaltern Ihrer Lernprozesse und zu aktiven Ko-Konstrukteuren ihres Wissens und Verstehens.29
Der Plan strebt eine Überwindung des Gegensatzes von spiel- und instruktionsorientierten Lernansätzen an. Er hebt deutlich hervor: Bis zur Einschulung herrschen informelle und non-formale spielerische Lernformen vor. Grundlagen elementarer Bildungsprozesse bleiben sinnliche Wahrnehmung, Bewegung, Spiel und kommunikativer Austausch. Spielen und Lernen stellen keine Gegensätze dar. Auf beiden Seiten der gleichen Medaille wird eine Beziehung zur Umwelt hergestellt bzw. Umwelt verarbeitet. Spiel- und Lebenswelt sind eng miteinander verknüpft. Das Spiel ist „die elementare Form des Lernens. Und es ist Auslöser und integraler Bestandteil geplanter und moderierter Lernaktivitäten mit Kindern“.30
Aber zugleich will kein Kind nur spielen, es will auch mit realem Leben und ernsthaftem Tun befasst sein. Die Höhergewichtung des elementaren Bildungsauftrags hat zur Konsequenz, „dass sich das beiläufige Lernen der Kinder bei ihrem Spiel zum spielerischen Lernen entwickelt, dem mehr systematische Begleitung und didaktische Aufbereitung zuteil wird, und das durch weitere Bildungsansätze wie Projekte und Workshops ergänzt wird. Freispiel ist wichtig, sollte jedoch unterstützt werden und muss in einem angemessenen Verhältnis zu Lernaktivitäten stehen, die die Erwachsenen planen und initiieren.“31 Solche strukturierten Lernangebote müssen täglich erlebt werden und bilden somit ein Lernmodell. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist, mit allen Kindern über eine längere Zeit hinweg ungestört pädagogisch arbeiten zu können.32
Für dieses Verständnis von spielerischem Lernen werden einige Faktoren benannt, die zum Gelingen beitragen:
– Bedingung ist ein Umfeld, in dem sie sich sicher und geborgen fühlen, in dem sie täglich ausreichende Möglichkeiten zur Bewegung haben und mit allen Sinnen beteiligt sind. Lernprozesse müssen an den kindlichen Gegebenheiten wie Neugier und Experimentieren ansetzen. Gleichzeitig brauchen Kinder individuelle Lernwege, die den unterschiedlichen Lernbedürfnissen der Kinder gerecht werden.
– Unter den Stichworten Interesse, Atmosphäre und Lernumgebung wird der Zusammenhang zwischen dem Kontext des Kindes und seiner Lernfreude hervorgehoben. Kinder interessieren sich nicht in erster Linie für reine Fakten. Ihr Interesse bezieht sich auf den Zusammenhang, z. B. im Rahmen einer Geschichte, in dem ein Lernprozess organisiert wird. Entscheidend sind die Emotionen, die Lernaktivitäten begleiten bzw. aus Lernaktivitäten hervorgehen. Diese Gefühle werden mitgelernt und prägen das weitere Lernverhalten. „Wenn sie in vorschulischen Lernprozessen spielerisch mit z. B. mathematischen oder naturwissenschaftlichen Inhalten experimentieren können, dann ermöglicht ihnen dies später einen kreativen Umgang mit diesem Wissen.“33 Neben den Emotionen in den Lernprozessen spielt die Bedeutung des Raumes eine große Rolle in den vorschulischen Bildungsprozessen. „Lernumgebungen, die liebevoll und anregend gestaltet und an deren Gestaltung die Kinder beteiligt worden sind, steigern Wohlbefinden, Lernmotivation und Effizienz von Lernprozessen.“34
– Ein weiterer Faktor für das spielerische Lernen ist die Möglichkeit zum kooperativen Lernen und das Lernen am Modell, die Bedeutung von Vorbildern. Kinder konstruieren ihr Weltverständnis in erster Linie durch den Austausch über die Dinge der Welt und welche Bedeutung diese haben. Eine gemeinsame Aufgaben- und Problemlösung mit anderen Kindern und Erwachsenen und der entsprechende kommunikative Austausch darüber stellt ein „ideales Lernumfeld“ dar. Die Vorbildwirkung der Erwachsenen ist in diesem Zusammenhang, wenn mit den Kindern in ernsthaften Situationen kooperiert wird und sie hier die Erfahrung machen, ernst genommen zu werden.
– Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung des eigenaktiven und selbsttätigen Lernens deutlich. Als Grundsatz wird hier formuliert: „Zeige mir und ich erinnere. Lasse es mich selbst tun und ich verstehe.“ Intensität der Beschäftigung und Involvierung des Kindes in den Lernprozess entscheiden über Dauer und Ausmaß späterer Erinnerung.35
– Mit diesem Lernansatz wird dem Lernen aus Fehlern und dem entdeckenden Lernen ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Wenn Kinder die Möglichkeit haben, verschiedene Lösungswege zu erproben, steigert dies deren Motivation und Kreativität. Anreize der Erwachsenen, getätigte Fehler selbst zu entdecken und nach möglichen Korrekturen zu suchen, sind Teil dieses Lernverständnisses.
– Als letzter und zusammenfassender Faktor wird das ganzheitliche Lernen betont. Damit sind vielseitige und bereichsübergreifende Zugangsweisen, Verarbeitungsformen mit allen Sinnen, Emotionen und intellektuellen Fähigkeiten, sowie variationsreiche Wiederholungen gemeint. Voraussetzung ist, dass die Lerninhalte an den Lebenswelten, Fragen und Interessen der Kinder anknüpfen und an das Niveau ihres aktuellen Wissens und Verstehens angepasst werden.
Vor diesem Hintergrund ist auch das „Prinzip der Entwicklungsangemessenheit“ zu verorten. Bildungsangebote sind so zu gestalten, dass sie der sozialen, kognitiven, emotionalen und körperlichen Entwicklung des Kindes entsprechen. Dieses Prinzip gilt nicht nur für die Gestaltung der Bildungsaktivitäten. Es hat seine Gültigkeit insbesondere auch bei der Gestaltung der Räume, der Lernumgebung und des Tagesgeschehens.36