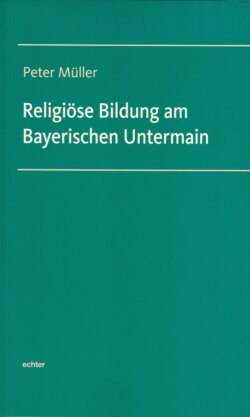Читать книгу Religiöse Bildung am Bayerischen Untermain - Peter Muller - Страница 15
2.2.1. Personale Kompetenzen
ОглавлениеPersonale Kompetenzen werden in vier Bereiche differenziert: Selbstwahrnehmung, motivationale Kompetenzen, kognitive Kompetenzen, physische Kompetenzen.
– Selbstwahrnehmung
Selbstwahrnehmung wird nochmals unterschieden in das Selbstwertgefühl und in positive Selbstkonzepte. Das Selbstwertgefühl wird als die Voraussetzung für die Entwicklung des Selbstvertrauens gesehen. Dieses Selbstwertgefühl wird in erster Linie durch die nicht an Bedingungen geknüpfte Wertschätzung und Bestätigung von Seiten der erwachsenen Bezugspersonen gestärkt. Aber auch das respektvolle und freundliche Verhalten der anderen Kinder trägt zur Entwicklung des Selbstwertgefühls bei. Positive Selbstkonzepte unterscheiden sich – als Wissen über sich selbst – in verschiedenen Bereichen: die Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen Lernbereichen (akademisches Selbstkonzept), die Fähigkeit, mit anderen zurechtzukommen (soziales Selbstkonzept), die Fähigkeit, Gefühle in bestimmten Situationen wahrzunehmen (emotionales Selbstkonzept) und ein Wissen darüber, wie fit man ist und wie man aussieht (körperliches Selbstkonzept). Pädagogische Fachkräfte tragen zur Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes bei, indem sie zu allen Bereichen differenzierte und positive Rückmeldungen geben und den Kindern die Möglichkeit eröffnen, sich dabei auch selbst wahrzunehmen.48
– Motivationale Kompetenzen
Diese motivationalen Kompetenzen differenzieren sich vor dem Hintergrund der Selbstbestimmungstheorie in fünf Aspekte. Das Autonomieerleben als grundsätzliches menschliches Bedürfnis muss in den Kindertageseinrichtungen dazu führen, dass Kinder möglichst oft die Gelegenheit erhalten, selbst zu entscheiden, was sie tun und wie sie es tun wollen. Solche zugestandenen Wahlmöglichkeiten stärken die kindliche Autonomie auch im Hinblick auf die Entwicklung von Werten und sich so zu verhalten, wie es ihrem Selbst entspricht.
Der zweite Aspekt – das Kompetenzerleben – ergibt sich aus dem ersten und einem entsprechenden menschlichen Grundbedürfnis zu erfahren, dass man etwas kann. Der Plan geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass Kinder sich deshalb auch Herausforderungen suchen, die optimal für ihre Fähigkeiten sind. Die sich daraus ergebende Aufgabe des Fachpersonals lautet, jedes Kind mit Aufgaben zu konfrontieren, die seinem Leistungsniveau entsprechen oder geringfügig darüber liegen.
Zu den beiden genannten Aspekten werden Selbstwirksamkeit und Selbstregulation als motivationale Kompetenzen benannt. Unter Selbstwirksamkeit wird die Überzeugung verstanden, schwierige Aufgaben oder Lebensprobleme aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können. Diese bildet sich einerseits durch Erfahrung und parallel dazu durch Beobachtung von anderen Kindern, die mit Selbstvertrauen an die Lösung anstehender Aufgaben herangehen. Von daher brauchen Kinder in Kindertageseinrichtungen Aufgaben, die in ihrer Schwierigkeit individuell angepasst sind. Heterogene Gruppen unterstützen den Prozess des Lernens von Selbstwirksamkeit durch Beobachtung. Darüber hinaus sind die Fachkräfte selbst Modell für Selbstwirksamkeit, indem sie in für sie selbst schwierigen oder und neuen Situationen Selbstvertrauen zeigen und diese Neue oder und Schwierige verbalisieren. Ein wesentliches Element zur Entwicklung von Selbstwirksamkeit ist die Transparenz von möglichen Konsequenzen für bestimmte Verhaltensweisen. Von daher müssen in den Kindertageseinrichtungen die Regeln bekannt sein und eingehalten werden. Eine mögliche Reflexion über das Verhalten der Kinder führt zu dem zweiten, oben genannten Aspekt: Selbstregulation. Darunter wird verstanden, „dass das Kind sein Verhalten selbst beobachtet, es selbst bewertet und abschließend sich belohnt oder bestraft, je nachdem, ob es nach seinem eigenen Gütemaßstab erfolgreich oder nicht erfolgreich war. Erfolg führt in der Regel dazu, dass das Kind seinen Gütemaßstab heraufsetzt. Nach Misserfolg setzt das Kind seinen Gütemaßstab niedriger an.“49 Solch selbstregulatives Verhalten wird durch zwei Aspekte in besonderer Weise unterstützt. Die Kommentierung der Fachkräfte von Handlungsabläufen und Problemlösungen (der Kinder oder der Fachkräfte) zeigt dem Kind, wie es sein Verhalten planen, beobachten und steuern kann. So kann z. B. die Selbstbeobachtung durch „lautes Denken“ gefördert werden. Des Weiteren ist auf angemessene Gütemaßstäbe zu achten. Entsprechende Selbstbelohnungen können durch das Modell der Erzieher/innen und anderer Mitarbeiter/innen vorgelebt werden.
Als letzte motivationale Kompetenz werden Neugier und individuelle Interessen aufgeführt. Durch die kindliche Aufgeschlossenheit für das Neue lernt es eigene Vorlieben beim Spielen und anderen Beschäftigungen zu entwickeln. Selbstwahrnehmung und motivationale Kompetenzen kommen in allen Bildungs- und Erziehungsbereichen zum Tragen. In besonderer Weise bezieht sich der BEP jedoch auf die folgenden Bereiche:
– Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte
– Sprache und Literacy
– Informations- und Kommunikationstechnik, Medien
– Mathematik
– Naturwissenschaften und Technik
– Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen (Partizipation)50
Im Hinblick auf die Perspektive dieser Studie erscheint die Hervorhebung der o. g. sechs Schwerpunkte etwas beliebig. Gerade im Bereich des Selbstwertgefühls, positiver Selbstkonzepte und auch in der Entwicklung von Autonomie, Selbstwirksamkeit und Selbstregulation erscheinen Elemente der religiösen Bildung von besonderer Bedeutung. Die Vernachlässigung des Bildungs- und Erziehungsbereichs Werte und Religiosität in der oben genannten Aufzählung widerspricht somit dem eigenen Sprachgebrauch des BEP, der, wie oben dargelegt, gerade bei der Entwicklung menschlicher Autonomie der Werteentwicklung eine besondere Stellung zumisst.51
– Kognitive Kompetenzen
Als kognitive Kompetenzen gelten: Differenzierte Wahrnehmung, Denkfähigkeit, Gedächtnis, Problemlösefähigkeit, Phantasie und Kreativität. Für die Entwicklung einer differenzierten Wahrnehmung sind alle sinnlichen Wahrnehmungsbereiche zu fördern. Darin liegt die besondere Aufgabe der Kindertageseinrichtungen. Dies wird in besonderer Weise dort unterstützt, wo Kinder aufgefordert werden, zu beschreiben, was sie beobachtet, befühlt oder ertastet haben.
Vor dem Hintergrund des präoperationalen Denkens, das in der Altersstufe vorherrschend ist, ist die Förderung der Denkfähigkeit dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes anzupassen. Die Begriffsbildung wird unterstützt, „indem Konzepte anhand konkreter Ereignisse, im Rahmen von Experimenten oder in Diskussionen präsentiert und geklärt werden. Wichtig ist, die Kinder anzuregen, Vermutungen über das (voraussichtliche) Verhalten von Dingen oder Personen zu äußern, um so z. B. das Bilden von Hypothesen zu lernen. Weiterhin werden die Kinder unterstützt beim Bilden von Oberbegriffen, Unterscheidungen, Mengenvergleichen und Relationen.“52
Die Förderung des Gedächtnisses baut auf der im Kindergartenalter in der Regel gut ausgeprägten Wiedererkennungsfähigkeit und dem Ortsgedächtnis auf. Die noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindliche Reproduktionsfähigkeit wird z. B. durch die Gelegenheit, Geschichten nachzuerzählen, das Lernen von kleinen Gedichten oder durch geeignete Spiele (Memory) gefördert. Der Erwerb altersgemäßer Kenntnisse fördert die Gedächtnisleistung und kann durch vielerlei Gelegenheiten geschehen (z. B. Zahlen, für die Kinder bedeutsame Symbole …).
Problemlösefähigkeit entwickeln Kinder in Kindertageseinrichtungen durch die Analyse von Problemen unterschiedlichster Art (z. B. soziale Konflikte, Denkaufgaben, Fragestellungen im Rahmen von Experimenten), durch die Entwicklung von alternativen Problemlösungsmöglichkeiten, durch das Abwägen dieser verschiedenen Möglichkeiten, durch das Entscheiden und angemessenes Umsetzen und die Überprüfung des Erfolgs. Fachkräfte dürfen von daher Kindern Probleme nicht abnehmen, sondern müssen sie vielmehr ermuntern, nach Lösungen zu suchen. Eine entsprechende Fehlerkultur ist für jede Einrichtung zu etablieren. Diese Kultur ist durch die Einstellung „Fehler sind kein Zeichen von Inkompetenz“ zu qualifizieren.
Phantasie und Kreativität entwickeln sich durch den originellen und individuellen Ausdruck im motorischen, sprachlichen, musikalischen und gestalterischen Bereich. Die Förderung dieser Kompetenzen gelingt durch die Ermunterung des Kindes, Reime zu erfinden, phantasievolle Geschichten zu erzählen, nach eigenen Vorstellungen zu malen und anderen ähnlichen Anregungen, die den individuellen Selbstausdruck zu entwickeln helfen.
Die kognitiven Kompetenzen kommen ebenfalls in allen Bildungsund Erziehungsbereichen zum Tragen, in besonderem Maße in folgenden Bereichen:
– Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte
– Sprache und Literacy
– Informations- und Kommunikationstechnik, Medien
– Mathematik
– Naturwissenschaft und Technik
– Umwelt
– Ästhetik, Kunst und Kultur
– Musik
– Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport
Auch hier ist auffällig, dass von 11 themenbezogenen Bildungsbereichen 9 aufgezählt werden. Gesundheit und Werteorientierung und Religiosität scheinen in der Sicht der Autoren nicht in besonderer Weise mit kognitiven Kompetenzen kompatibel.
– Physische Kompetenzen
Hierzu zählen die Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden, das Einüben von grob- und feinmotorischen Kompetenzen und die Fähigkeit zur Regulierung von körperlicher Anspannung. Zu ersterem wird der Aspekt der Hygiene und die Vermittlung einer positiven Einstellung gegenüber gesunder Ernährung hervorgehoben. Die motorische Kompetenz wird entwickelt, indem der Bewegungsdrang des Kindes ernst genommen wird und die Kinder angeleitet werden, ihren Körper zu beherrschen und Geschicklichkeit zu entwickeln. Der letzte Aspekt zielt darauf ab, dass Kinder lernen, sich für bestimmte Aufgaben körperlich und geistig anzustrengen und sich danach aber auch wieder zu entspannen. Bildungs- und Erziehungsbereiche, in denen diese Kompetenzen besonders zum Tragen kommen, sind:
– Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport
– Gesundheit53