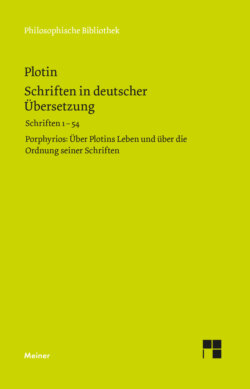Читать книгу Schriften in deutscher Übersetzung - Plotin - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die drei ursprünglichen Wesenheiten
ОглавлениеWas hat denn eigentlich die Seelen ihres Vaters Gott vergessen lassen und bewirkt, daß sie, obgleich Teile aus jener Welt und gänzlich Jenem angehörig, ihr eigenes Wesen sowenig wie Jenen mehr kennen? Nun, der Ursprung des Übels war ihr Fürwitz, das Eingehen ins Werden, die erste Andersheit, auch der Wille sich selbst zu gehören. An dieser ihrer Selbstbestimmung hatten sie, als sie denn in die Erscheinung getreten waren, Freude, sie gaben sich reichlich der Eigenbewegung hin, so liefen sie den Gegenweg und gerieten in einen weiten Abstand: und daher verlernten sie auch daß sie selbst von dort oben stammen; wie Kinder die gleich vom Vater getrennt und lange Zeit in der Ferne aufgezogen werden, sich selbst wie ihren Vater nicht mehr kennen. Da die Seelen nun sich selbst nicht und Jenen nicht mehr sahen, achteten sie sich selbst gering aus Unkenntnis ihrer Herkunft, achteten aber das Andere hoch, hatten vor allem mehr Respekt als vor sich selbst, waren von dem Andern hingerissen, staunten es an, hängten sich daran, und so rissen sie sich soweit als möglich los von dem, dem sie geringschätzig den Rücken gekehrt hatten. Somit ergibt sich, daß der Grund für das gänzliche Vergessen jenes Oberen die Hochachtung vor dem Irdischen und die Mißachtung ihrer selbst ist. Denn ein Wesen, das etwas bewundert und ihm nachjagt, gesteht eben durch diese Bewunderung und dies Nachjagen ein, ihm unterlegen zu sein; indem es sich aber selbst für geringer schätzt als die Dinge die da werden und vergehen, indem es sich für unwerter und sterblicher als alle die Dinge hält die es hochschätzt, kann es niemals den Gedanken von Gottes Wesen und Kraft fassen.
Es muß also gegenüber Menschen in dieser Verfassung eine zwiefache Beweisführung statthaben, wenn man sie auf den umgekehrten Weg, zum Ersten hin kehren und hinaufführen will bis zum Höchsten, dem Einen und Ersten. Und welches sind diese beiden? Die eine zeigt den Unwert dessen was der Seele jetzt wert ist; sie werden wir an anderer Stelle ausführlicher geben. Die andere belehrt die Seele und ruft ihr ins Gedächtnis, wie hoch sie ihrer Herkunft und ihrem Werte nach steht; und sie geht jener anderen vorauf, ihre deutliche Entwicklung wird auch jene klären; von der wollen wir jetzt handeln, denn sie berührt sich unmittelbar mit dem zu erforschenden Gegenstand und fördert jene andere. Denn das was forscht ist ja die Seele und sie muß zur Erkenntnis kommen welchen Wesens sie ist, die da forscht, damit sie zuvor von sich selber feststellen kann ob sie die Fähigkeit hat solche Dinge zu erforschen, ob sie ein Auge hat von der Art sie zu erblicken, und ob überhaupt dies Forschen sie angeht. Denn wenn die Gegenstände ihr fremd sind, wozu dann das Forschen? Sind sie ihr aber verwandt, so geht es sie an und sie vermag sie auch zu finden.
[2]So bedenke denn also erstlich jede Seele dies, daß sie selbst es ist die alle Lebewesen geschaffen hat und ihnen Leben einhauchte, welche die Erde nährt und welche das Meer, die in der Luft sind und die göttlichen Gestirne am Himmel; daß sie die Sonne und sie unsern gewaltigen Kosmos geschaffen hat, sie ihn formte, sie ihn in bestimmter Ordnung kreisen läßt; und daß sie das alles tut als eine Wesenheit die verschieden ist von den Dingen die sie formt, die sie bewegt und lebendig macht: daß sie notwendig wertvoller ist als diese, denn sie werden oder vergehen, je wie die Seele sie verläßt oder ihnen das Leben dargibt, sie selbst aber ist immerdar weil sie ‘sich selbst nicht verläßt’.
Auf welche Weise sie aber das Leben spendet im gesamten All wie bei den Einzelwesen, das mache sie sich folgendermaßen klar. Sie möge betrachten die große Seele, sie die selber auch Seele ist, und keine kleine, und dieses Betrachtens wert geworden ist wenn sie sich vom Trug und dem was die übrigen betört frei gemacht hat in einem Zustand der Stille; stille sei ihr nicht nur der Leib der sie umgibt, die brandende Flut des Körpers, sondern überhaupt die ganze Umwelt, es ruhe die Erde, es ruhe Meer Luft und der Himmel selbst sei ohne Bewegung (?). Dann stelle sie sich vor, wie von allen Seiten in den stillstehenden Himmel die Seele gleichsam von außen einströmt und sich ergießt und von überall her eindringt und hineinleuchtet; so wie eine dunkle Wolke Sonnenstrahlen, die sie mit ihrem Licht treffen, leuchten machen und ihr einen goldstrahlenden Anblick geben: so hat auch die Seele als sie in den Leib des Himmels eintrat, ihm Leben gewährt, ihm Unsterblichkeit gewährt, ihn der unbewegt lag auferweckt. Und er, durch die vernunftvolle Leitung der Seele in ewige Bewegung versetzt, wurde ein ‘glückseliges Lebewesen’. So erhielt der Himmel seine Würde erst als die Seele sich in ihn einsiedelte, welcher ehe die Seele kam toter Körper war, Erde und Wasser, oder vielmehr Finsternis des Stoffes, das Nichtseiende und ‘was den Göttern verhaßt ist’ wie es irgendwo heißt.
Noch klarer und deutlicher wird der Seele Kraft und Wesen, wenn man nur hierbei seine Gedanken darauf richtet, in welcher Weise sie den Himmel umfaßt und durch ihren eigenen Willen führt. Seiner ganzen Ausdehnung nach soweit er reicht, hat sie sich ihm dargegeben und in jedem Abstande, sei er groß oder klein, ist er beseelt, wobei die körperliche Masse anders und anders gelegen ist, das eine Stück hier das andere dort befindlich, die einen am entgegengesetzten Weltort, die andern sonst durch Abstand voneinander getrennt; die Seele aber ist mitnichten so beschaffen, sie zerstückt sich nicht in Teile und bringt dann das Einzelding mit einem Seelenstück zum Leben, sondern alles lebt vermöge der ganzen Seele, sie ist ganz allerwärts zugegen, dem Vater der sie erzeugte darin es gleichtuend, daß sie Eines und daß sie überall ist. Durch ihre Kraft also ist der Himmel, welcher ein Vieles, hier und dort Verschiedenes ist, ein Eines, vermöge der Seele ist unser Kosmos ein Gott; so ist auch die Sonne ein Gott weil sie beseelt ist, und die andern Gestirne, und wir, wenn wir denn etwas sind, sind es aus diesem Grunde, denn ‘Leichen gehören vor die Türe geworfen mehr noch als Mist’. Sie also, welche Göttern Ursache daß sie Götter sind, muß notwendig eine Gottheit sein ehrwürdiger als jene. Aber auch unsere Seele ist von gleicher Art, und betrachtest du sie nur ohne die Zusätze und nimmst sie in ihrer Reinheit, so wirst du eben das als das Wertvollste in uns antreffen was Seele ist, und wertvoller als alles was da körperlich ist. Denn das ist alles Erde; oder wenn es denn Feuer ist: was soll denn das Brennende an ihm etwa anderes sein (als Seele)? Ebenso alles aus diesem Zusammengesetzte, auch wenn du noch Wasser und wenn du noch Luft hinzunimmst. Kann all dies Körperliche aber nur deshalb Gegenstand deines Trachtens sein weil es beseelt ist, weshalb will man da sich selbst fahren lassen und nach einem andern trachten? Ist es aber die Seele, die du im andern bewunderst, so bewunderst du damit dich selbst.
[3]Da nun die Seele ein so wertvolles, ein göttliches Ding ist, so halte dich durch solche Begründung nunmehr überzeugt daß du mit einem solchen Mittel zu Gott hingelangen kannst und steige gerüstet zu ihm hinauf: gewißlich wirst du ihn nicht ferne antreffen, der Zwischenstufen sind nicht viele. Stelle dir also den ihr nach oben benachbarten Bereich vor, welcher noch göttlicher als sie, die göttliche, ist, nach dem und von dem die Seele kommt; denn obgleich sie ein Ding von der Art ist wie unsere Darlegung gezeigt hat, ist sie doch ein Abbild des Geistes; so wie der ausgesprochene Gedanke (Wort) ein Abbild des Gedankens (Wort) in der Seele ist, so ist die Seele selbst der ausgesprochene Gedanke des Geistes, die ganze Wirkungs- und Lebenskraft, die er ausströmt, um ein anderes zur Existenz zu bringen; so wie beim Feuer zu scheiden ist die ihm innewohnende und die von ihm gespendete Wärme – nur daß man beim Geist die Wirkungskraft nicht als Ausfließendes denken muß, sondern die Wirkungskraft beharrt in ihm, während die äußere als eine gesonderte in die Existenz tritt. Da also die Seele vom Geist stammt, ist sie nur geisthaft, ihr Geist bewegt sich in Überlegungen, ihre Vollendung erhält sie erst wieder vom Geist, der gleichsam wie ein Vater den Sohn aufzieht, den er als ein im Verhältnis zu ihm noch Unvollkommenes erzeugt hatte. So kommt also der Seele die Existenz vom Geist; es besteht aber auch die Verwirklichung ihres Begriffs darin daß sie den Geist schaut. Denn wenn sie hineinblickt in den Geist, so hat sie das was sie denkend verwirklicht, in sich selbst als ihr Zugehöriges, und das allein darf man tätige Verwirklichung der Seele nennen, was sie geistgemäß und als ihr zugehörig verwirklicht, während das Niedere ihr von anderwärts kommt und ein Leiden einer entsprechend niedrigen Seele ist.
So erhöht also der Geist die Göttlichkeit der Seele noch weit mehr, indem er ihr Vater ist und indem er bei ihr gegenwärtig ist; denn es ist nichts zwischen ihnen als die Andersheit, diese jedoch besteht nur in dem Sinne daß die Seele die nächste Stufe und der aufnehmende Stoff ist, der Geist aber die Form; und selbst diese Materie des Geistes ist noch schön, da sie geisthaft und einfach ist.
Von wie edler Beschaffenheit aber der Geist ist, das wird schon eben daraus deutlich, daß er höher steht als die Seele, [4]die etwas so Herrliches ist; man mag es aber auch aus folgendem ersehen. Wenn einer unsere sichtbare Welt bewundert in Anbetracht ihrer Größe und Schönheit und der Ordnung ihres ewigen Umschwunges, und die Götter, die in ihr sind, die einen sichtbar andere auch unsichtbar, und die Dämonen und alle Tiere und Pflanzen, so schreite er empor zu ihrem Urbilde, ihrem wahrhafteren Sein, und sehe wie auch dort oben dies alles vorhanden ist, als geistige Wesen, die aus sich selbst ewig beharren in dem Bewußtsein und dem Leben die ihnen angestammt sind, und als ihr Schutzherr der ‘unvermischte’ Geist, die unermeßliche Weisheit und das Leben dort oben recht eigentlich ein Leben unter Sat-ur-nus als einem Gotte welcher Sattheit und Nus (Geist) ist; er umfaßt in sich alles Unsterbliche, den ganzen Geist, die ganze Gottheit, die ganze Seele; und zwar als ewig Ruhendes, denn wozu soll er Veränderung suchen da es mit ihm gut bestellt ist, und wem sollte er nachgehen da er in sich selbst alles besitzt? Auch Zuwachs kann er nicht wünschen da er völlig vollendet ist; weshalb auch alles was bei ihm ist, vollendet ist, damit er durchaus vollkommen sei und nichts in sich trage, was es nicht sei; und da er nichts in sich hat was er nicht denkt (?), so ist sein Denken kein Suchen sondern ein Haben. Seine Seligkeit ist nicht hinzuerworben, sondern er ist in Ewigkeit alles, ist die wahrhaftige Ewigkeit. Von ihr ist die Zeit, welche die Seele umkreist, nur ein Abbild, welche das eine vorübergehen und das andere auf sich zukommen läßt; denn anderes und wieder anderes ist es was in der Seele ist, bald ein Sokrates, bald ein Pferd, immer ein bestimmtes Ding unter den seienden. Der Geist dagegen ist alles; so hat er alles als auf derselben Stelle ruhendes; er ist nur, immer gilt von ihm das ‘ist’, niemals das ‘wird sein’, denn auch in der Zukunft ‘ist’ er, noch das ‘vergangen’, denn nichts geht in der oberen Welt vorbei, sondern alles steht immerdar in Ewigkeit, da es immer dasselbe bleibt gleichsam zufrieden mit seinem Zustand. Von alledem ist jedes Einzelne Geist und Seiendes, und das Gesamte ist Gesamtgeist und Gesamtseiendes, wobei der Geist im Denken das Seiende existent macht und das Seiende, indem es gedacht wird, dem Geist sein Denken und sein Sein gibt.
Ursache aber des Denkens ist etwas anderes, was zugleich Ursache des Seienden ist; für beide zugleich also ist noch etwas anderes als Ursache vorhanden. Sie existieren nämlich gewiß gemeinsam und verlassen einander nicht, aber doch besteht dieses Eine, das zugleich Geist und Seiendes, Denkendes und Gedachtes ist, aus zweien, dem Geist als dem Denken, dem Seienden als dem Gedachten; denn es könnte gar kein Denken statthaben wenn nicht Andersheit da wäre wie auch Selbigkeit. So ergeben sich als erste Prinzipien GEIST, SEIENDES, ANDERSHEIT, SELBIGKEIT; dazu muß man auch noch BEWEGUNG und RUHE nehmen; Bewegung sofern der Geist denkt, Ruhe um der Selbigkeit willen; Andersheit, damit es Denkendes und Gedachtes geben kann (denn sonst wenn man die Andersheit ausscheidet, dann wird es Eines sein und nur schweigen; ferner müssen auch die Gegenstände des Denkens Andersheit zueinander haben); und Selbigkeit, da es mit sich selbst eines ist; aber es ist auch in ihnen allen ein Gemeinsames, so gut in ihnen, sofern sie verschieden sind, Andersheit ist. Die Mehrheit der Prinzipien, die sich so ergibt, konstituiert ZAHL und WIEVIEL, ferner die Eigentümlichkeit jedes einzelnen von ihnen WIEBESCHAFFENHEIT; und aus ihnen allen geht als aus Prinzipien das übrige hervor.
[5]Eine Vielheit also ist dieser Gott (der Geist), der über der Seele ist. Ihr aber wird zuteil im Bereich dieser Dinge zu weilen wenn sie sich daran heftet und es durchsetzt sich nicht davon zu trennen; ist sie ihm nun nahe gekommen und gleichsam eines mit ihm geworden, so forscht sie wer es denn ist der ihn erzeugt hat, der Einfache, der vor einer solchen Vielheit liegt, der die Ursache seines Seins und seines Vielseins ist, der die Zahl hervorbringt. Denn die Zahl ist nicht das Erste, liegt doch vor der Zweiheit das Eine, die Zweiheit ist erst das Zweite, sie kommt von dem Einen her, dieses ist erst ihr Bestimmendes während sie selbst von sich aus ‘unbestimmt’ ist; und erst wenn sie bestimmt wird, ist sie Zahl. Zahl aber ist gleichsam Substanz, und Zahl ist auch die Seele; denn nicht Massen sind das Erste oder Größen; die massigen Dinge hier, die die Wahrnehmung für seiende hält, sind später; so ist auch in dem Samen nicht die Flüssigkeit das Wertvolle, sondern das was man nicht sieht, und das ist Zahl und Begriff. Die Zahl also von der man in der geistigen Welt spricht, und die Zweiheit sind Formbegriffe und sind Geist; indes ist die Zweiheit unbestimmt da sie gleichsam als zugrundeliegender Stoff begriffen wird, die Zahl aber, die aus ihr und dem Einen entsteht, ist Form, indem jedes einzelne (der geistigen Prinzipien) gleichsam von den in es eintretenden Gestalten geformt wird; dabei wird es auf eine Weise durch Einwirkung des Einen, auf die andere aber durch eigenes Tun geformt so wie das Sehen in seinem Vollzuge; denn das Denken des Geistes ist ein Sehen welches blickt; und beide sind eins.
[6]Wie sieht der Geist nun und wen, und wie ist er überhaupt zur Existenz gekommen und aus Jenem geworden, daß er überhaupt sehen kann? Von der Notwendigkeit, daß die genannten Prinzipien des Geistes existieren müssen, ist unsere Seele nunmehr durchdrungen, sie verlangt aber noch nach Klärung jener ja schon von den Denkern der alten Zeit vielbesprochenen Frage, wie aus dem Einen, als einem so beschaffenen wie wirs ihm zuschreiben, zur Existenz kommen konnte irgendetwas wie Vielheit oder Zweiheit oder Zahl, wieso es nicht bei sich selbst verharrte, sondern diese ausgebreitete Vielheit aus ihm geflossen ist, die wir in der Wirklichkeit antreffen, von der wir aber fordern daß sie auf das Eine zurückgeführt werden muß. So sei denn das Folgende gesagt – zuvor aber Gott selbst angerufen nicht mit dem Schall von Worten, sondern indem wir uns mit der Seele zum Gebet nach Ihm strecken, denn auf diese Weise können wir für uns allein zu ihm allein beten – der Schauende möge seinen Blick, während Gott selbst nur bei sich ist gleichsam im inneren Heiligtum und geruhig beharrt jenseits über allen Dingen, auf die Götterbilder richten die gleichsam im äußeren Bezirk des Tempels stehen – oder vielmehr auf das erste Götterbild welches da in die Erscheinung tritt und auf die folgende Weise erscheint.
Alles was sich bewegt, muß etwas haben zu dem es sich hinbewegt. Da nun Jenes (das Eine) nichts hat zu dem es sich bewegen könnte, so dürfen wir nicht annehmen daß es sich bewege; sondern was etwa nach ihm entsteht, muß notwendig entstanden sein indem Jenes unverwandt auf sich selbst gerichtet war; ganz ausschließen müssen wir dabei die Entstehung in der Zeit, da wir es zu tun haben mit dem ewig Seienden; sondern wir legen ihnen nur dem Ausdruck nach Entstehung bei, um damit dem Verhältnis von Ursache und Wirkung und ihrer Rangordnung gerecht zu werden, und müssen also sagen, daß das was in diesem Sinne aus dem Ersten entsteht, entsteht indem Jenes sich nicht bewegt. Denn wenn es sich bewegte während etwas entsteht, so würde das Entstehende erst nach der Bewegung als ein Drittes eintreten und nicht gleich als Zweites. Wenn also etwas Zweites, unmittelbar nach Jenem seiendes dasein muß, so muß es in die Existenz getreten sein, während Jenes unbewegt war, sich nicht zu ihm neigte oder einen Entschluß faßte oder überhaupt sich irgend bewegte.
Aber wie kommt das zustande und als was muß man es sich denken? Es umgibt Jenes, ist ein rings aus ihm strahlender Glanz, aus ihm wobei Es aber beharrt; so wie der Glanz der Sonne der sie gleichsam umspielt der ständig aus ihr geboren wird wobei sie aber beharrt. Alle seienden Dinge lassen so, solange sie Bestand haben, aus ihrem Wesen notwendig ein Existentes zur Wirklichkeit werden, welches außen um sie liegt und abhängt von der Gegenwart ihrer Kraft, als ein Abbild gleichsam der Urbilder aus denen es hervorwuchs: das Feuer die von ihm ausstrahlende Wärme; auch der Schnee verschließt die Kälte nicht nur in seinem Innern; vorzüglich bezeugen das alle wohlriechenden Stoffe, denn solange sie da sind, strömt ein Etwas ringsum aus ihnen hervor, und daher gewährt ihre Existenz allem Benachbarten Genuß. Ferner aber: alles was soweit gelangt ist daß es reif ist, zeugt; das nun was ewig reif und vollendet ist, zeugt ewig und ein Ewiges, zeugt aber ebenfalls etwas das geringer ist als es. Was muß man also von dem Allervollkommensten und Reifsten erwarten? Nichts kann aus Ihm hervorgehen als das Größte nach ihm; das Größte aber nach ihm ist der Geist und folgt ihm sogleich als Zweites. Sieht doch der Geist Jenen und bedarf allein seiner, während er des Geistes in keiner Hinsicht bedarf. Auch muß das was aus einem Höheren als der Geist erzeugt wird, Geist sein; der Geist ist höher als alle andern Dinge, denn die sind nach ihm, wie denn auch die Seele der Gedanke des Geistes und sozusagen seine Wirksamkeit ist, so wie der Geist die des Einen. Nun ist der Gedanke in der Seele nur ein dunkler, denn er ist gleichsam nur ein Nachbild des Geistes, und darum muß sie auf den Geist blicken; der Geist aber gleichermaßen auf Jenen, damit er Geist sei. Er sieht Ihn aber nicht als von ihm getrennter, sondern weil er unmittelbar nach Jenem ist und nichts dazwischensteht, wie auch nichts zwischen Seele und Geist. Es verlangt ja ein jegliches nach seinem Erzeuger und liebt ihn, und ganz besonders wenn Erzeuger und Erzeugtes allein sind; ist aber der Erzeuger auch noch das höchste Gut, so ist das Erzeugte mit Notwendigkeit bei ihm, so daß es allein durch die Andersheit von ihm geschieden ist.
[7]Wir nennen aber, denn wir müssen uns deutlicher ausdrükken, den Geist ein Abbild von Jenem erstlich darum, weil das Erzeugte in gewissem Sinne ein ‘Jenes’ sein, vieles von Ihm bewahren und Ähnlichkeit mit ihm haben muß, wie sie auch das Licht mit der Sonne hat. Aber doch ist Jenes nicht Geist; wie kann es da den Geist erzeugen? Nun, in dem Gerichtetsein auf sich selbst erblickte es sich selbst, und dies Erblicken ist der Geist (Denken). Denn das was dies Auffassen tätigt, ist etwas anderes als Wahrnehmung oder Geist … Die Wahrnehmung als Linie und so weiter … Aber der Kreis ist doch seiner Beschaffenheit nach teilbar, während das Eine sich nicht so bewegt. Nun, es gilt auch hier, daß es Eines ist, aber dies Eine ist Vermögen und Möglichkeit aller Dinge; die Dinge also deren Vermögen es ist, erblickt das Denken das sich gleichsam abspaltet von diesem Vermögen; denn sonst wäre es nicht Geist. Hat doch das Eine schon von sich selbst aus eine Art Selbstgewahren von seinem Vermögen, davon, daß es die Substanz hervorzubringen vermag. Bestimmt doch auch der Geist durch sich das Sein für sich vermittels des Vermögens das vom Einen ausgeht, und weil das Sein sozusagen ein Teil der Dinge ist die Jenem gehören und aus Jenem kommt, erhält es von Jenem seine Kraft und wird zum Sein vollendet von Jenem und aus Jenem. Mit sich selbst nun als einem das gleichsam abgeteilt ist aus sich, dem dabei doch Ungeteilten, sieht Es das Leben, das Denken und alle Dinge, weil Jenes nichts von allen Dingen ist; denn deshalb können ja alle Dinge von Jenem stammen, weil Jenes durch keinerlei Form eingenommen ist. Denn Jenes ist nur Eines; wäre es alles, so gehörte es zu den seienden Dingen; deshalb ist es nichts von den Dingen die im Geiste sind, sondern diese stammen aus ihm. Sie sind daher auch Wesenheiten; denn sie sind bereits bestimmt und ein jedes hat sozusagen seine Form. Denn dem Seienden kommt es nicht zu im Unbestimmten gleichsam hin- und herzuschweben, sondern durch Bestimmung und Begrenzung befestigt zu sein, durch Ständigkeit; Ständigkeit (Status) aber ist für die geistigen Dinge Begrenzung (Bestimmung) und Form, und durch sie kommen sie überhaupt zur Existenz.
‘Dies fürwahr ist die Sippschaft’ aus welcher der Geist von dem wir handeln stammt; denn es ist des Geistes als des Allerreinsten würdig, aus keinem andern Ursprung als aus dem ersten Urgrund zu erwachsen, und indem er in die Entstehung tritt nunmehr alles Seiende mit sich selbst zugleich zu erzeugen, die Ideen in all ihrer Schönheit und alle die geistigen Götter. Indem er aber erfüllt ist mit dem was er zeugte da er es gleichsam wieder verschlingt, damit er es in sich behalte und es nicht aus ihm herausstürze in die Materie, nicht großgezogen werde bei der Rhea, wie die Geheimkulte und die Göttersagen es versteckt andeuten wenn sie lehren Saturn, der weiseste Gott vor der Entstehung des Zeus, trage wieder in sich was er erzeuge, weshalb er auch erfüllt ist und Geist in Sattheit; dann aber erzeuge er Zeus, welcher dann die Sattheit (der Sohn) selbst ist: denn der Geist erzeugt die Seele da er Geist in voller Reife ist. Da er nämlich in voller Reife steht, mußte er zeugen, da er eine so große Kraft war, konnte er nicht zeugungsunfähig sein. Aber auch hier konnte das Erzeugte nicht besser sein, sondern es mußte geringer, mußte eine Nachbildung von ihm sein, ebenfalls unbestimmt, aber seine Bestimmtheit erhaltend und gleichsam zur Gestalt gemacht von seinem Erzeuger. Das Erzeugnis aber des Geistes ist irgendwie Gedanke und Existenz, nämlich das Organ welches nachdenkt; dieses ist es das sich um den Geist herumbewegt, ist das vom Geist ausstrahlende Licht, ein Nachklang, fest an ihn gebunden, nach der einen Seite hin von ihm bewirtet und so sich ersättigend, genießend, Teil an ihm nehmend und ihn denkend, nach der anderen Seite hin aber sich befassend mit den Dingen die nach ihm selbst sind, vielmehr auch seinerseits diese Dinge erzeugend, die notwendig geringer sind als die Seele; von ihnen aber ist später zu handeln.
[8]Aus diesem Grunde lehrt auch Plato drei Stufen: ‘Alles’, das heißt das Erste, ‘ist um den König aller Dinge’, sagt er, ‘und das Zweite um das Zweite und um das Dritte das Dritte’. Auch sagt er daß ‘das Ursächliche einen Vater’ habe, und zwar meint er mit dem Ursächlichen den Geist; denn der Geist ist für ihn der Weltschöpfer, von ihm sagt er daß er die Seele schafft in jenem ‘Mischkrug’; Vater nun dieses Ursächlichen welches der Geist ist, nennt er das Gute, das jenseits des Geistes und jenseits des Seins Stehende. Weiter nennt er an vielen Stellen das Seiende und den Geist Idee. Somit hat Plato gewußt, daß aus dem Guten der Geist und aus dem Geist die Seele hervorgeht. Diese Lehren sind also nicht neu, nicht jetzt erst, sondern schon längst, wenn auch nicht klar und ausdrücklich, gesagt, und unsere jetzigen Lehren stellen sich nur dar als Auslegung jener alten, und die Tatsache daß diese Lehren alt sind, erhärten sie aus dem Zeugnis von Platos eigenen Schriften.
Angerührt hat ja schon vorher Parmenides eine derartige Auffassung, insofern er Seiendes und Geist zusammenfallen ließ und das Seiende damit nicht unter die Sinnendinge setzte: ‘denn dasselbe ist Denken wie Sein’ sagt er; er bezeichnet dies Seiende auch als unbeweglich, obgleich er ihm das Denken beilegt, er schließt nämlich jede körperliche Bewegung von ihm aus damit es sich gleich bleibe, und vergleicht es einer Kugelmasse, weil es alles umschließend in sich hat und weil sein Denken nicht außen ist sondern in ihm selbst. Indem er es aber in seinen Schriften Eines nannte, konnte man ihm den Vorwurf machen daß dieses Eine ja als Vielheit angetroffen wird. Da spricht der Parmenides bei Plato genauer, er scheidet voneinander das erste Eine, das im eigentlichen Sinne ‘Eine’, das Zweite, welches er ‘Eines Vieles’ nennt, und das Dritte, ‘Eines und Vieles’; so stimmt er ebenfalls überein mit der Lehre von den drei Wesenheiten. Anaxagoras [9]ferner, indem er den Geist rein und unvermischt nennt, setzt ebenfalls das Erste als ein Einfaches und das Eine als abgetrennt (transzendent); doch hat er Genaueres zu geben infolge seiner Altertümlichkeit unterlassen. Auch Heraklit hat gewußt daß das Eine ewig und geistig ist, denn er wußte daß die Körper immer im Werden und Fließen sind. Und für Empedokles scheidet der Streit, die Liebe aber ist das Eine; dies faßt er ebenfalls als unkörperlich, während die Elemente die Stelle der Materie einnehmen. Später nennt dann Aristoteles das Erste abgetrennt und geistig, wenn er aber behauptet daß es selbst sich selbst denke, so macht er es wiederum nicht zum Ersten. Indem er weiter noch viele andere geistige Wesen ansetzt, und zwar soviele wie Sphären im Himmelsraum sind, damit jede von ihnen von einem einzelnen geistigen Wesen bewegt werden kann, stellt er die geistige Welt abweichend von Plato dar: er setzt, da er keine Notwendigkeit zur Verfügung hat, nur ein Wahrscheinliches ein. Man kann aber zweifeln ob diese Lehre auch nur die Wahrscheinlichkeit für sich hat; es ist doch eher wahrscheinlich, daß alle Sphären einem einheitlichen System angehören und nach einem und zwar nach dem Ersten sich richten. Man mag fragen, ob für ihn die Vielheit der geistigen Wesen aus einem, dem Ersten stammen oder ob es in der geistigen Welt viele Prinzipien geben soll. Sollen sie aus einem stammen, so müssen sie sich doch offenbar analog verhalten wie die Sphären in der Sinnenwelt, wo eine die andere umschließt und die eine, äußere regiert; dann also wird auch in der geistigen Welt das Erste alles andere umfassen, es wird ein geistiger Kosmos existieren, und wie hier unten die Sphären nicht leer sind sondern die Erste erfüllt von Sternen ist und die andern auch Sterne in sich haben, so werden auch dort die Beweger vieles in sich haben, und zwar wird das dort das eigentlichere Sein sein. Soll aber jedes einzelne dieser geistigen Wesen Prinzip sein, dann müßten die Prinzipien etwas zufälliges sein; weswegen werden sie dann aber zusammenwirken und zu einem einheitlichen Werk, dem Einklang des gesamten Kosmos, die Eintracht besitzen? Und wie können dann die Sinnendinge am Himmel von gleicher Anzahl sein wie die geistigen Wesen, die Beweger? Wie können sie dann überhaupt, als nur unkörperliche, Vielheit sein, wenn die Materie sie nicht scheidet? –
Von den alten Denkern haben demnach diejenigen die sich besonders an die Lehren des Pythagoras und seiner Nachfolger anschlossen, sich an diese Wesenheit (das Eine) gehalten; allerdings bildeten nur einige die Lehre in ihren Schriften durch, die andern legten sie nicht in Schriften sondern in nicht aufgeschriebenen Unterredungen dar oder ließen sie überhaupt unbeachtet.
[10]Daß man also den Sachverhalt so anzunehmen hat, daß das jenseits über dem Seienden Liegende das Eine ist (und zwar von solcher Beschaffenheit wie unsere Darlegung wollte, soweit es möglich war über derartige Gegenstände etwas anzudeuten) und daß dann das Seiende und der Geist folgt und das Dritte die Wesenheit der Seele ist, das ist nunmehr dargelegt. Wie nun in der Welt diese drei genannten Wesenheiten vorhanden sind, so, muß man annehmen, sind sie auch in uns vorhanden; ich meine nicht in uns als Sinnendingen, denn jene Prinzipien sind transzendent, sondern in uns sofern wir außerhalb des Sinnlichen sind, ‘außerhalb’ in dem Sinne wie jene oberen Wesenheiten außerhalb des Weltalls sind; so ist es auch beim Menschen, in dem Sinne wie Plato vom ‘inneren’ Menschen spricht. So ist denn auch unsere Seele ein Göttliches und höheren Wesens, so beschaffen wie das Gesamtwesen Seele; zu ihrer Vollendung aber gelangt die Seele welche den Geist in sich hat; der Geist aber scheidet sich in einen welcher denkt und einen welcher das Denken verleiht. Dies Denkende also in der Seele, welches zu seinem Denken keines leiblichen Werkzeugs bedarf, sondern seine eigene Wirksamkeit ganz im Reinen hält (denn nur so kann es überhaupt rein denken), darf man wohl ohne fehlzugehen als Transzendentes, mit dem Leibe Unvermischtes im ersten geistigen Bereich ansetzen. Denn wir dürfen nicht nach einem Ort suchen auf dem wir es sich gründen lassen, sondern müssen es außerhalb allen Raumes setzen; denn nur dann kann es das an sich Seiende, das außerhalb und unstofflich ist, erfassen, wenn es rein für sich ist und nichts von der Leibeswesenheit Ausgehendes an sich trägt. Deshalb heißt es auch vom All daß der Gott die Seele ‘auch noch außen’ um es legte, womit er auf den Teil der Seele hinweist der im Geistigen verharrt; bei uns aber sagt er, dies nur andeutend, daß er die Seele ganz oben, im Schädel ansiedelte. So meint auch die Mahnung zur Abtrennung nichts Räumliches (der obere Seelenteil ist ja seinem Wesen nach abgetrennt), sondern daß man sich durch Nichthinabneigen, also mit den Vorstellungen vom Leibe trennt und ihm fremd wird, vielleicht daß einer so auch die übrige Seele hinaufführen, auch das mit nach oben tragen könnte, was von der Seele hier unten angesiedelt ist, welches allein Schöpfer und [11]Bildner des Leibes ist und sich mit ihm zu beschäftigen hat. Da nun die denkende Seele sich mit den gerechten und schönen Dingen beschäftigt und ihr Nachdenken fragt ob dies ein gerechtes, jenes ein schönes ist, so muß es notwendig auch ein fest stehendes Gerechtes geben, von dem aus dies Nachdenken in der Seele überhaupt zustande kommt; denn wie könnte sie es sonst ermessen? Da nun ja die Seele über diese Dinge bald nachdenkt bald aber auch nicht, so muß nicht der Geist, welcher über das Gerechte nachdenkt, sondern der es immer in sich hat, in uns sein; also auch der Urgrund und die Ursache des Geistes, Gott; nicht als wäre er geteilt in uns; sondern indem er verharrt und nicht im Raume ist, zeigt sich anderseits in der Vielheit bei jedem, der ihn aufzunehmen vermag, gewissermaßen ein zweiter Er, so wie auch der Kreismittelpunkt für sich ist und doch jeder Radius des Kreises einen Punkt in jenem liegen hat zu dem dann die Linien das Individuelle hinzufügen; mit einer solchen Stelle in uns berühren auch wir Ihn, sind mit ihm vereinigt und verknüpft, ja haben in ihm unser Fundament, soweit wir nach dort oben gerichtet sind.
[12]Aber wie kommt es daß wir eines so erhabenen Besitzes gar nicht innewerden, sondern dies herrliche Vermögen die meiste Zeit ruhen lassen, ja in manchen Fällen überhaupt nicht betätigen? Jene Wesenheiten in uns üben ewig ihre eigene Wirksamkeit, der Geist und das vor dem Geist Liegende, ewig in sich Ruhende; und in diesem Sinne heißt auch die Seele das ‘ständig Bewegte’. Nicht alles nämlich, was in der Seele ist, wird deshalb ohne weiteres von uns wahrgenommen, sondern es tritt in ‘uns’ erst ein wenn es in die Wahrnehmung geht; wenn dagegen ein einzelner Seelenteil an seiner Tätigkeit dem Wahrnehmungssinn keinen Anteil gibt, so ist diese Tätigkeit noch nicht bis zur gesamten Seele durchgedrungen; folglich wissen ‘wir’ noch nicht davon, denn der Wahrnehmungssinn gehört zu uns, ‘wir’ sind nicht ein Teil der Seele sondern die ganze. Da ferner jedes der Seelenvermögen immer lebendig ist, so muß es für sich selbst immer die ihm eigene Tätigkeit ausüben; das Wissen aber darum ergibt sich erst, wenn ein Mitteilen und Wahrnehmen davon zustande kommt. Mithin muß man, wenn von dem so in der Seele Vorhandenen eine Wahrnehmung zustandekommen soll, eben den Wahrnehmungssinn nach innen wenden und ihn dorthin seine Aufmerksamkeit richten lassen. Gleich wie jemand, der auf eine Stimme lauscht, die er hören möchte, sich allen anderen Stimmen verschließt und sein Ohr horchen läßt auf den Laut erwünschter als alles was er eben hört, ob er nicht endlich nahe, so gilt es auch hier, die sinnlichen Laute fortzutun, es sei denn soweit ein Zwang vorliegt, und das Wahrnehmungsvermögen der Seele zu bewahren rein und bereit zu hören die Töne von oben.