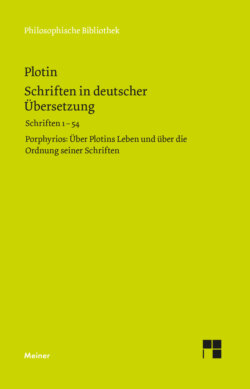Читать книгу Schriften in deutscher Übersetzung - Plotin - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Seiende, obgleich eines und dasselbe, ist zugleich als Ganzes überall (I)
ОглавлениеWohnt die Seele überall dem All bei, weil der Körper des Alls von dieser bestimmten Ausdehnung ist, da es ihr Wesen ist, sich „an den Körpern zu teilen“? Oder ist sie schon selber überall? Freilich nicht, wo sie vom Körper jeweils hingeführt wird, sondern der Körper findet sie vor als eine, die schon vor ihm überall ist, so daß er je dort, wohin er gestellt wird, die Seele findet als vorhanden, bevor er in dem betreffenden Teile des Alls seinen Platz fand, und daß der ganze Körper des Alls gesetzt wurde in die Seele als eine vorhandene. Indessen, wenn sie so ausgedehnt ist und, bevor der so ausgedehnte Körper kam, seinen ganzen Raum erfüllte, wie soll sie dann nicht Größe haben? Und was könnte das für eine Weise sein, vor der Entstehung des Alls im All zu sein, wo es doch das All noch nicht gab? Ferner, wenn sie teillos und größelos sein soll, wie kann man da hinnehmen, daß sie überall ist und doch keine Größe hat? Und wenn einer sagt, daß sie sich mit dem Körper ausdehne, ohne selber Körper zu sein, so schafft er auch so keinen Ausweg aus der Schwierigkeit, indem er ihr die Größe als Akzidentielles gibt; denn folgerichtig könnte man auch diesmal begründet fragen, wieso sie denn akzidentiell Größe erhält. Denn so wie die Qualität, z. B. Süße oder Farbe, am ganzen Körper ist, so ist es doch keineswegs mit der Seele. Denn das sind Affektionen der Körper. Daher erfaßt die Affektion das gesamte Affizierte; sie ist nichts auf sich Beruhendes, sondern ein Etwas des Körpers und wird da als solches erkannt; weshalb sie denn auch notwendig die entsprechende Ausdehnung hat. Ferner, das Weiße eines Teiles empfindet nicht mit dem Weißen eines andern Teiles; auch ist beim Weißen das Weiße an einem Teil mit dem Weißen an einem andern Teil wohl der Art nach, nicht aber der Zahl nach identisch, während bei der Seele das, was im Fuß ist, der Zahl nach identisch ist mit dem in der Hand, wie die Wahrnehmungen beweisen; und überhaupt ist bei den Qualitäten das Identische als ein geteiltes anzusehen, bei der Seele als ein nicht geteiltes, welches nur in dem Sinne als geteilt bezeichnet wird, als es überall ist. So wollen wir also von Grund auf über diese Fragen sprechen, ob uns vielleicht deutlich und annehmbar werden kann, wie sie, die körperlos und größelos ist, zu größter Erstreckung sich ausdehnen kann, sei es vor den Körpern, sei es an den Körpern; und wenn sich ergeben sollte, daß sie schon vor den Körpern dies vermag, so würde es vielleicht leichter werden, das Entsprechende auch an den Körpern hinzunehmen.
[2]Es stehen sich gegenüber einerseits das wahre All, anderseits das Nachbild des Alls, die Wesenheit dieser sichtbaren Welt. Das All im eigentlichen Sinne nun ist in nichts, denn nichts ist vor ihm. Aber was etwa nach ihm ist, das ist dann allerdings zwangsläufig im All, wenn es überhaupt sein soll, hängt enge von ihm ab und kann ohne es nicht beharren noch sich bewegen. Denn auch wenn jemand dieses nicht als an einem Ort ansetzen will (indem er unter Ort entweder die Grenze des umgebenden Körpers versteht, vermöge derer er umgibt, oder einen Zwischenraum, der früher zum Leeren gehörte und noch jetzt zu ihm gehört), sondern nur sofern es gleichsam im All gründet und ruht, da das All überall ist und alles zusammenhält, der möge von der Wortbezeichnung absehen und das Gemeinte dem Sinne nach nehmen. Dies aber stellen wir fest nur um eines andern willen, weil nämlich jenes All, welches das Erste und das Seiende ist, keinen Ort zu suchen braucht und überhaupt in keinem Dinge ist. So kann das All als Alles auf keine Weise an sich selber eine Lücke haben, sondern es ist in sich selber erfüllt und ein sich selber gleiches Seiendes; und wo das All ist, dort ist nur es selber; denn es ist ja das All. Und überhaupt: wenn ein Ding in dies All gestellt würde und ist ein Anderes als das All, so erhält es teil an ihm, trifft mit ihm zusammen und bekommt von ihm Kraft, ohne es doch zu teilen, sondern es findet das All als in sich ruhendes, indem es seinerseits zum All hintritt, ohne daß das All aus sich heraustritt. Denn unmöglich kann das Seiende im Nichtseienden sein, sondern, wenn überhaupt, das Nichtseiende im Seienden. So trifft es auf das Seiende als auf ein Ganzes; denn das Seiende konnte nicht von sich selber abgespalten werden. Und wenn man sagt, daß es überall sei, so bedeutet das: im Seienden, und das heißt: in sich selber. Es hat ja nichts Befremdendes, wenn das ‘überall’ bedeutet ‘im Seienden’, und ‘in sich selber’; denn hier ist ja das ‘überall’ schon gleichbedeutend mit ‘in Einem’; nur wir Menschen, die wir das Seiende als wahrnehmbar ansehen, denken uns auch das Überall so; und da wir das Wahrnehmbare für ein Großes halten, sehen wir keine Möglichkeit, wie sich in einem Großen, so Ausgedehnten jene andere Wesenheit erstrecken soll; in Wahrheit ist das aber nur das, was man einen kleinen Riesen zu nennen pflegt, und das, was man für klein hält, das vielmehr ist groß, wo es als Ganzes zu jedem Teil des Wahrnehmbaren hindringt, oder richtiger, das Wahrnehmbare geht von überall mit seinen Teilen zu jenem und findet es überall als Ganzes und größer als es selber. Wie es denn, da es in seiner Erstreckung nichts weiter erfassen konnte (dabei wäre es ja außerhalb des Alls geraten), Jenes umkreisen wollte, und da es nicht vermochte, es zu umfassen, noch auch in es einzugehen, sich zufrieden gab, die Stelle und den Rang innezuhaben, wo es Erhaltung fände, Jenem benachbart als einem ihm Beiwohnenden und doch wieder nicht Beiwohnenden. Denn Jenes steht auf sich selber, auch wenn etwas ihm beiwohnen will; und wenn an beliebigem Ort der Körper des Alls hinzutritt, findet er das All vor; so braucht er kein Weiterhinaus mehr, sondern dreht sich an der Stelle um, weil das das All ist, wo er mit jedem seiner Teile jenes genießt als eines Gesamten. Wäre nämlich Jenes an einem Orte, so müßte der Körper dort hinwandern und sich geradeaus bewegen, er müßte je an einem andern seiner Teile einen andern Teil von Jenem berühren und es gäbe dabei Nahe und Fern. Sofern es aber Nahe und Fern bei dieser Berührung nicht gibt, muß Jenes notwendig als Ganzes beiwohnen, soweit es überhaupt ‘beiwohnt’; und wirklich wohnt es jedem einzelnen von den Dingen bei, für die es weder fern noch nahe ist, die aber fähig sind, es aufzunehmen.
[3]Wird nun Jenes selber beiwohnen, oder wird es auf sich selber stehen und werden nur Kräfte von ihm zu allen Dingen ausgehen, und ist in diesem Sinne gesagt, daß es ‘überall’ sei? (In diesem Sinne sagen sie, daß die Seelen gleichsam Lichtfunken sind, indem Jenes in sich selbst gegründet ruht, die Seelen aber von ihm ausgesendet eintreten in immer neue Lebewesen.) Nun, bei den Dingen, bei denen gilt, daß Jenes nicht die ganze Wesenheit bewahrt, die in ihm selber ist, dort wird, wem es beiwohnt, nur eine Kraft von ihm beiwohnen (indessen wird auch dann nicht Jenes überhaupt nicht beiwohnen, denn auch dann ist Jenes nicht abgetrennt von seiner Kraft, die es ihm dargab; sondern der Empfangende vermochte nur so viel aufzunehmen, während das Ganze zugegen war). Wo aber alle seine Kräfte wirken, da wohnt es klärlich selber bei, ist freilich dennoch abgesondert; denn wenn es nur die Form dieses Dinges wäre, so hätte es aufgehört, alles zu sein und überall in sich selber zu sein und nur akzidentiell einem andern zu gehören. Da es aber keinem gehört von dem, was ihm gehören will, so nähert es sich, wem es selber will, nach Vermögen, es wird nicht dessen Eigentum, sondern das andere trachtet nach ihm, aber auch nicht Eigentum sonst irgend eines. So ist es also in keiner Weise befremdlich, daß Jenes in diesem Sinne in allen Dingen ist, weil es wiederum in keinem von ihnen derart ist, daß es ihnen gehörte; weshalb es übrigens vielleicht gar nicht so undenkbar ist, daß man die Seele in diesem Sinne akzidentiell mit dem Körper leiden läßt, wenn sie dabei nur auf sich selber besteht, und nicht der Materie oder dem Körper angehört, sondern der ganze Körper von ihr an jedem Teile nur gleichsam erleuchtet wird. Man darf sich auch nicht wundern, daß Jenes, ohne an einem Orte zu sein, allem, was an einem Orte ist, beiwohnt; es wäre im Gegenteil verwunderlich, ja zum Verwunderlichen noch unmöglich, wenn Jenes auch seinerseits einen eigenen Ort hätte und dann noch irgend einem andern im Orte beiwohnte, oder überhaupt nur beiwohnte, und in der Weise beiwohnte, wie wir es doch behaupten. In Wahrheit ergibt die Untersuchung, daß es notwendig, da ihm kein Ort zuteil geworden ist, dem, dem es beiwohnt, als Ganzes beiwohnt, und daß es einem Ganzen wie auch einem Einzelding beiwohnend als Ganzes beiwohnt. Sonst würde ein Stück von ihm hier sein, ein anderes anderswo, es würde folglich geteilt sein und Körper sein. Wie soll man es denn überhaupt teilen? Will man das Leben abteilen? Aber wenn das Ganze Leben war, kann der Teil nicht mehr Leben sein. Oder den Geist, und den einen Geist in einem Teil, den andern in einem andern sein lassen? Keiner von ihnen kann dann noch Geist sein. Oder das, was von ihm das Seiende ist? Aber der Teil kann nicht mehr das Seiende sein, wenn das Ganze seiend war. Und wenn einer einwendet, auch der Körper habe doch, wenn er geteilt werde, Teile, welche wieder Körper sind? Nun, die Teilung betraf nicht den Körper, sondern den so und so großen Körper, und der einzelne Teil hieß Körper nur der Form nach, vermöge derer er Körper ist, und diese enthielt nicht eine bestimmte Quantität, sondern ja überhaupt keine Quantität.
[4]Wie meint er nun das Seiende und die seienden Dinge und die Vielzahl der Geiste und der Seelen, wenn das Seiende überall Eines ist, und zwar nicht nur im Sinne des Gleichgearteten, und der Geist Einer und die Seele Eine? Die Seele des Alls ist doch, sagt er, verschieden von den Einzelseelen; das scheint doch ein Gegenzeugnis zu sein; auch hat die dargelegte Auffassung wenn auch eine gewisse Zwangsläufigkeit, so doch keine rechte Überzeugungskraft, da die Seele es für unglaubwürdig hält, daß das Eine derart überall als identisches sein soll. Vielleicht ist es nämlich besser, das Ganze nur in dem Sinne zu teilen, daß das, an dem die Teilung statthat, in keiner Weise gemindert werde, oder auch, um bessere Ausdrücke zu gebrauchen, von ihm nur eine Zeugung ausgehen zu lassen, und so Jenes bei sich selber sein zu lassen und erst das Gezeugte, das gleichsam zu seinen Teilen wird, das All vollmachen zu lassen. Indessen, wenn Jenes bei sich selber bleibt, weil es widersinnig erscheint, daß ein Ganzes zugleich überall zugegen ist, so ergibt sich der Einwand wieder bei den Seelen. Denn in den Körpern, in denen als ganzen sie als ganze sein sollen, können sie dann nicht sein, sondern entweder müssen sie dann geteilt werden, oder, wenn sie als ganze beharren, wo am Körper sollen sie ihre Kraft mitteilen? Und dann wird sich dieselbe Frage auch bezüglich ihrer Kräfte erheben, ob sie überall ganz sein können; ferner wird dann ein Teil des Körpers die Seele haben, ein anderer nur deren Kraft. Aber wie kann es denn dann die Vielzahl der Seelen und der Geiste geben und das Seiende und die seienden Dinge nebeneinander? Auch wenn sie aus den vorhergehenden Stufen nur zahlenmäßig, nicht größenmäßig hervorgehen sollen, bietet sich die gleiche Schwierigkeit, wie sie dann das All vollmachen. So finden wir also mit dem Hervorgehen aus der Vielzahl im geschilderten Sinne keinen Ausweg aus der Schwierigkeit? Nun, auch vom Seienden räumen wir ein, daß es Vieles ist vermöge von Andersheit, nicht im Sinne des Ortes; denn das Seiende ist alles beisammen, auch wenn es in diesem Sinne Vieles ist, ‘denn nah ist Seiendes dem Seienden’, es ist alles beisammen; auch der Geist ist vielfältig nur durch Andersheit, nicht durch den Ort, sondern ganz beisammen. Sind es auch die Seelen? Ja, auch die Seelen. Da es von dem, ‘was an den Körpern teilbar wird’, heißt, es sei seinem Wesen nach ungeteilt, da die Körper aber Größe haben und ihnen diese Wesenheit beiwohnt – oder vielmehr: die Körper in sie eintreten –, so wurde, da nun an jedem Teil, so weit die Körper geteilt sind, jene Wesenheit zur Erscheinung kommt, die Seele für ‘an den Körpern teilbar’ angesehen. Denn dadurch, daß sie nicht mit den Teilen zerteilt ist, sondern als Ganze überall, wird ihre Einheit, die wesenhafte Ungeteiltheit ihres Wesens offenkundig. So hebt also weder die Existenz der einen Seele die der vielen auf, sowenig wie die des Seienden die seienden Dinge, noch widerstreitet dort oben die Vielheit der Einheit, noch braucht man durch die Vielheit die Körper mit Leben zu erfüllen, noch soll man meinen, wegen der Größe des Körpers entstehe die Vielzahl der Seelen, sondern vor den Körpern ist schon da sowohl die Vielheit der Seelen wie die Eine. Denn in dem Gesamt sind die vielen bereits vorhanden, nicht nur potentiell, sondern jede einzelne verwirklicht; denn die Eine, die Ganze hindert nicht die Vielen in ihr zu sein, noch auch die Vielen die Eine. Sie scheiden sich ja ungeschieden und sind beieinander ohne Selbstaufgabe; sie sind ja nicht durch Grenzen getrennt, sowenig wie die vielen Wissenschaften in der einen Seele; die Eine Seele ist von der Art, daß sie alle in sich trägt. In diesem Sinne ist eine derartige Wesenheit unendlich.
[5]Und so ist auch ihre Größe aufzufassen, nicht als Masse; denn Masse ist etwas Kleines, da sie ins Nichts verschwindet, wenn man von ihr fortnimmt. Dort aber gibt es gar kein Fortnehmen; und wenn man etwa von ihr fortnähme, so geht sie nicht aus. Wenn sie aber nicht ausgeht, wie braucht man zu fürchten, daß sie von irgend etwas sich trenne? Denn wie kann sie sich trennen, wo sie nicht ausgeht, sondern ewig quellendes Wesen ist – ohne doch zu fließen? Fließt sie, so dringt sie nur so weit vor, wie sie fließen kann; fließt sie aber nicht – und sie hätte ja gar nicht, wohin sie fließen sollte –, so hält sie das All besetzt, ist vielmehr selber das All. Und da sie ein Größeres ist, als es der Natur des Körpers entspricht, nimmt man wohl mit Recht an, daß sie dem All nur wenig von sich dargibt, nur so viel es von ihr tragen kann. Aber man darf dies Wenige nicht für kleiner halten (als den Körper des Alls), und nicht, indem man es erst kleiner an Masse ansetzt, hernach zweifeln, als könne das Kleinere sich unmöglich erstrecken über etwas, das größer als es selber sei. Denn ‘kleiner’ darf man von ihm gar nicht aussagen, und man darf nicht messend vergleichen eine Masse mit dem Masselosen; das wäre, als wenn man die Heilkunst kleiner nennen wollte als den Körper des Arztes; noch ist anderseits ihr Größersein zu verstehen im Sinn des Messens der Quantität, ist doch auch bei der Heilkunst ‘groß’ und ‘größer als der Körper’ nicht in diesem Sinne aufzufassen. Es bezeugt aber die Größe der Seele auch der Umstand, daß, wenn die Masse größer wird, dieselbe Seele über die ganze Masse sich ausbreitet, die vorher in der kleineren Masse war. Denn es wäre wieder und wieder Torheit, wollte man auch der Seele Masse beilegen.
[6]Warum erstreckt sie sich denn nicht auch auf einen anderen Körper? Nun, jener andere Körper müßte, wenn er könnte, vielmehr sich zu ihr hinbegeben; aber der, der bereits zu ihr sich begeben hat und sie aufgenommen hat, der hat sie schon. Und ferner: hat der andere Körper denn dieselbe Seele, da er auch seinerseits die Seele hat, die er hat? Denn was ist da für ein Unterschied? Nun, durch das, was hinzugesetzt ist (die Körper). Ferner, wieso ist die Seele in Fuß und Hand dieselbe, in diesem Einzelkörper des Alls aber nicht dieselbe wie in jenem? Und wenn die Wahrnehmungen unterschiedene sind, so muß man auch die eintretenden Eindrücke für unterschieden halten. Das Beurteilte also ist verschieden, aber nicht das Urteilende; der Urteilende bleibt derselbe, wenn er auch als Richter unter immer wechselnde Eindrücke gerät, denn nicht er ist der Beeindruckte, sondern die Natur des so beschaffenen Körpers; es ist, wie wenn derselbe Mensch Lustempfinden am Finger und Schmerz am Kopf beurteilt. Warum nimmt dann aber die eine Seele das Urteil der andern nicht wahr? Nun, weil es ein Urteil ist, und nicht ein Eindruck; ferner, selbst das urteilende Vermögen sagt nicht ‘ich habe geurteilt’, sondern es urteilt nur, so wie auch beim Menschen nicht das Gesicht dies dem Gehör sagt, obgleich sie beide geurteilt haben, sondern erst der Verstand, der über beiden ist; und der ist von beiden verschieden. Auch sieht ja wirklich der Verstand oft genug das Urteil, das in einem andern stattfindet, und bringt sich so den Eindruck, der in einem andern stattfindet, zum Bewußtsein. Indes ist hierüber schon an anderer Stelle gesprochen worden.
[7]Doch wollen wir von neuem fragen, wie das, was identisch ist, über alle Dinge sich erstreckt; und das ist gleichbedeutend mit der Frage, wieso jedes einzelne unter den vielen Sinnendingen nicht ausgeschlossen ist vom Anteil an jenem Identischen, obgleich es an vielen Stellen sich befindet. Denn nach dem Gesagten ist es nicht richtig, Jenes in die vielen Dinge zu zerteilen, sondern man muß vielmehr die Vielheit der zerteilten Dinge auf das Eine zurückführen, und Jenes ist nicht herabgekommen zu diesen, sondern, weil diese Dinge verstreut sind, erwecken sie in uns die Vorstellung, daß wie diese auch Jenes zerteilt ist, so als wollte man das Bewältigende und Zusammenhaltende in gleiche Teile wie das Bewältigte zerlegen. Indessen, auch die Hand kann einen ganzen Körper und eine Stange von vielen Ellen und noch anderes bewältigen; dann reicht das Bewältigende über das Ganze hin, ist trotzdem aber nicht in dieselben Teile zerlegt wie die bewältigte Stange in der Hand; denn offenbar reicht der Umfang der Kraft so weit, als sie angreift, trotzdem aber ist die Hand umgrenzt durch ihr eigenes Quantum, nicht durch das des hochgehobenen und bewältigten Gegenstandes; ja, wenn man dem bewältigten Körper ein weiteres Stück hinzufügte und die Hand könnte es tragen, so bewältigt die Kraft auch dies, ohne in ebensoviele Teile zerlegt zu werden, wie der Körper hat. Wie nun, wenn man die körperliche Masse der Hand in Gedanken fortnähme, verwürfe aber nicht die gleiche Kraft, die vorher die körperliche Masse hochhielt, welche zuvor in der Hand war? Ist sie dann nicht gleichermaßen als identische, da sie ungeteilt ist, in dem Ganzen an jedem Teile? Und wenn man eine kleine leuchtende Masse, sozusagen einen Punkt nähme und einen größeren kugelförmigen Körper, der durchsichtig ist, herumlegte, so daß das Licht aus der Mitte auf der ganzen Umhüllung leuchtete, ohne daß dieser äußere Körper von anderswoher Licht erhielte, müssen wir da nicht zugeben, daß die Masse innen keiner Affektion unterliegt, sondern sich über den ganzen äußeren Körper ausbreitet und dabei doch beharrt, und daß das Licht, das in der kleinen inneren Masse sichtbar ist, den äußeren Körper besetzt hat? Da nun dies Licht nicht von der körperlichen Masse jenes kleinen Punktes kommt – denn nicht sofern er Körper ist, hat er das Licht, sondern sofern er leuchtender Körper ist, durch eine andere Kraft, die nicht körperlich ist –, gut, so nehme man die körperliche Masse fort und lasse nur die leuchtende Kraft bestehen: kann man da noch sagen, daß das Licht an irgend einem Orte sei, oder ist es nicht gleichermaßen drinnen und in der ganzen äußeren Kugel? Und man wird dann in Gedanken sich nicht mehr dorthin wenden, wo es vorher war, man wird nicht mehr sagen können, woher es kommt und wohin es geht, sondern darüber wird man ratlos sein und sich verwundern; zugleich wird man aber, wenn man (in Gedanken) auf diese oder jene Stelle des kugelförmigen Körpers blickt, immer hier oder dort das Licht wissen. So ist es ja auch bei der Sonne: gewiß kann man sagen, woher das Licht kommt, das den ganzen Luftraum mit seinem Leuchten erfüllt, wenn man den Körper der Sonne im Auge hat; trotzdem aber sieht man es überall als dasselbe Licht und nicht als ein abgeteiltes; das zeigen auch die Körper, die das Licht abschneiden, sie lassen es nicht nach der entgegengesetzten Seite, als woher es gekommen ist, durchgehen und zerteilen es trotzdem nicht. Wenn nun die Sonne reine Kraft wäre, die vom Körper getrennt wäre und so das Licht dargäbe, so nähme es nicht von da seinen Anfang, man könnte nicht sagen, woher, sondern das Licht wäre überall als Einunddasselbe, ohne einen Anfang und auch ohne einen bestimmten Ausgangspunkt zu haben.
[8]Beim Licht nun, da es eines Körpers ist, kann man sagen, woher es gekommen ist, da man sagen kann, wo dieser Körper ist; was aber immateriell ist und in nichts eines Körpers bedarf, da es dem Wesen nach früher ist als aller Körper, selber in sich selber gegründet, vielmehr auch einer solchen Grundlage in nichts bedürfend – das also, das solchen Wesens ist, da es keinen Ursprung hat, von dem es ausgehen könnte, auch nicht von irgendeinem Orte, noch irgend eines Körpers ist, wie soll man von ihm sagen, das eine Stück sei hier, das andere dort? Damit hätte es schon einen Ursprung, von dem es ausgegangen ist, und wäre einem Ding angehörig. Also bleibt nur übrig zu sagen, daß dasjenige, das etwa an ihm teil erhält, vermöge der Kraft des Ganzen an ihm teil erhält, ohne daß Jenes dabei affiziert wird, weder in anderer Hinsicht, noch auch indem es geteilt würde. Denn dem, was Körper hat, kann das Leiden auch akzidentiell zukommen, und insofern kann es affizierbar und teilbar heißen, da es etwas am Körper ist, z. B. Affektion oder Gestalt; was aber keinem Körper zugehörig ist, sondern der Körper möchte ihm zugehörig sein, das unterliegt notwendigerweise keiner der sonstigen Affektionen des Körpers irgendwie und kann also auch unmöglich geteilt werden; denn auch das ist eine Affektion des Körpers, und zwar primär und sofern er Körper ist. Wenn also zum Körpersein als solchem das Teilbare gehört, so gehört zum Nichtkörpersein als solchem das Unteilbare. Wie will man es denn auch teilen, da es keine Größe hat? Wenn also an dem, das keine Größe hat, das, was Größe hat, irgendwie teilnimmt, so muß es teilnehmen an ihm als einem nicht Geteilten; sonst müßte es ja wieder Größe haben. Nennt man es also Eines in Vielen, so läßt man es damit nicht selber zu Vielen werden, sondern man schiebt den Zustand der Vielen jenem Einen nur zu, weil man es zugleich in den Vielen sieht; daß es aber in den Vielen sei, ist so aufzufassen, daß es nicht ihnen im einzelnen zugehörig wird noch auch im Gesamten, sondern so, daß Jenes sich selbst gehört und es selber ist, und, da es an sich ist, nicht von sich selber läßt. Auch ist es nicht so groß wie das sichtbare All, noch wie irgend ein Teil des Alls; denn es ist überhaupt kein Quantitatives. Wie sollte es auch ein Sogroßes sein? Dem Körper muß man das Sogroß zuschreiben, dem aber, was nicht Körper ist, sondern von anderer Wesenheit, darf man keinesfalls das Sogroß zuschreiben; wo aber das Sogroß nicht ist, da ist folglich auch kein Wo; und also auch kein Hier und Da, denn das wäre bereits ein vielfältiges Wo. Wenn also Teilung im Ort stattfindet (denn das eine Stück des Geteilten ist hier, das andere hier), wie kann da dasjenige, welches kein Hier hat, Teilbarkeit haben? Unteilbar folglich muß es selber bei sich sein, auch wenn das Viele, wie es geschieht, nach ihm trachtet. Und wenn das Viele nach ihm trachtet, so trachtet es klärlich nach ihm als einem Ganzen; daher es, wenn es an ihm auch teilnehmen kann, so weit es vermag, an ihm als Ganzem teilnehmen wird. Es müssen also die Dinge, die an ihm teilnehmen, es so mit ihm halten, als nähmen sie nicht teil, indem es nicht ihr Sondereigentum ist: so kann es selber bei sich ein Ganzes bleiben und zugleich bei denen, an denen es sichtbar wird, ein Ganzes sein; denn wäre es kein Ganzes, so wäre es weder es selber, noch auch würden die Dinge teilhaben an dem, wonach sie trachten, sondern an einem Anderen, auf das sich das Trachten garnicht richtete.
[9]Ferner, wäre der Teil, der in das Einzelding kommt, ein Ganzes und damit jedes einzelne Ding ein Ansich wie das Erste, jedes aber für sich in Abtrennung, so ergäben sich zahlreiche Erste und jedes Einzelstück wäre ein Erstes. Was sollte dann aber die Ursache sein, welche diese vielen Ersten trennt, daß sie nicht alle eine einheitliche Gesamtheit bilden? Ihre Körper gewiß nicht; denn diese Ersten können ja unmöglich die Formen der Körper sein, wenn anders auch sie jenem Ersten, von dem sie kommen, gleichen. Sind aber die genannten Teile (des Ersten), die in den Vielen sind, Kräfte von ihm, so ist erstlich nicht mehr jedes einzelne ein Ganzes. Sodann, wie sind sie, nachdem sie sich von Jenem getrennt und es verlassen haben, hierher gekommen? Denn wenn sie es denn verlassen haben, verließen sie es klärlich, um irgendwohin zu gehen. Ferner, sind diese Kräfte, wenn sie hier ins Sinnliche eingetreten sind, noch in Jenem oder nicht? Wenn sie es nicht sind, so ergibt sich die undenkbare Vorstellung, Jenes sei geringer geworden und kraftlos, da es beraubt ist der Kräfte, die es zuvor hatte. Daß ferner die Kräfte getrennt von ihren Substanzen existieren, wie wäre das möglich? Sind sie schließlich sowohl in Jenem wie anderswo, so müssen sie entweder als Ganze hier unten sein oder Teile von ihnen. Wenn Teile, so sind die übrigen Teile dort oben. Wenn ganz, so sind sie entweder hier unten als eben die, die sie dort sind, nicht geteilte, und dann ist also wiederum dasselbe überall, ohne geteilt zu sein; oder die Kräfte sind jede einzeln ein Ganzes, das zur Vielheit geworden ist, und einander gleich, so daß dann jeweils die Kraft gemeinsam mit der Substanz auftreten wird, oder es wird nur eine Kraft geben, welche der Substanz verbunden ist, die übrigen aber sind bloße Kräfte. Indessen, sowenig Substanz ohne Kraft, sowenig kann es auch Kraft ohne Substanz geben; denn die Kraft ist dort oben Existenz und Substanz oder etwas Höheres als Substanz. Wenn aber die Kräfte, die aus jenem Oberen stammen, andersartig sind, weil geringer und verdunkelt, so wie ein dunkles Licht aus einem helleren, und ebenso die Substanzen, die mit diesen Kräften verbunden sind (denn eine Kraft ohne Substanz kann man nicht zulassen), so ist erstens auch bei den Kräften dieser Art, die unbedingt einander gleichartig sind, notwendig zuzugeben entweder, daß ein und dieselbe überall ist; oder doch, wenn nicht überall, so doch allemal ein und dieselbe zusamt als Ganze, nicht geteilte, z. B. wenn sie in einem und demselben Körper ist. Und wenn dies, warum dann nicht ebenso im ganzen All? Wenn dagegen jede einzelne Kraft ins Unendliche geteilt sein soll, so wird sie auch für sich nicht mehr ganz sein, sondern durch die Teilung wird sie Unkraft sein; da sie ferner dann bei jedem andern Teil als eine andere ist, so gäbe es keine Möglichkeit der Mitempfindung (Selbstbewußtsein) mehr. Zweitens, so wie das Abbild einer Sache, etwa auch jenes schwächere Licht, abgeschnitten von dem, woher es stammt, nicht mehr ist, und wie man allgemein alles, was von einem andern her seine Existenz hat und dessen Abbild ist, wenn man es von jenem trennt, nicht mehr in der Existenz belassen kann, so können auch diese Kräfte, die von Jenem herkommen, wenn sie von Jenem abgeschnitten sind, nicht sein. Und wenn das, so muß dort, wo diese Kräfte sind, zugleich auch Jenes sein, von dem sie gekommen sind; und somit ergäbe sich wiederum, daß ein und dasselbe überall zugleich ungeteilt als Ganzes ist.
[10]Wenn man aber einwendet, daß nicht notwendig das Nachbild von etwas an dem Urbild hängt (denn ein Nachbild könne existieren, auch wenn das Urbild fort ist, von dem das Nachbild stammt, auch könne die Wärme in dem Erwärmten noch existieren, wenn das Feuer fort ist), so werden wir erstens bezüglich des Nachbildes und Urbildes antworten: wenn man das Nachbild vom Maler meint, so hat dies Nachbild nicht das Urbild geschaffen, sondern der Maler; und von ihm ist es kein Nachbild, auch wenn einer sich selber malte; denn das, was malte, war nicht der Körper des Malers und nicht die nachgebildete Gestalt; nicht der Maler, sondern diese bestimmte Anordnung der Farben, sollte man sagen, bringt ein so beschaffenes Bild hervor. Es ist bei dem Gemälde gar nicht im eigentlichen Sinne Hervorbringung wie bei dem Nachbild im Wasser, im Spiegel oder bei Schatten; denn da hat das Nachbild seine Existenz im eigentlichen Sinne nur von dem Früheren her und entsteht von ihm aus, und hier ist es unmöglich, daß das Hervorgebrachte getrennt von ihm existiert. Daß aber dies die Weise ist, in der auch die schwächeren Kräfte von den höheren her entstehen, werden die Gegner zugeben. Zweitens, bezüglich des vom Feuer Gesagten, so ist die Wärme nicht als Nachbild des Feuers anzusprechen (man wolle denn etwa behaupten, auch Feuer sei in der Wärme enthalten; dann aber läßt man die Wärme nicht getrennt von der Feuerquelle sein). Sodann, wenn auch nicht sofort, immerhin läßt doch der erwärmte Körper nach und wird kalt, wenn das Feuer fortgeht. Wenn ferner die Gegner die abgeleiteten Kräfte erlöschen lassen, so können sie erstens nur noch das Eine unvergänglich sein lassen und müssen die Seele und den Geist vergänglich machen. Sodann aber lassen sie aus einer nicht fließenden Wesenheit Fließendes hervorgehen. Nun dürfte aber z. B. die Sonne, wenn sie an einen beliebigen Platz gesetzt verharrt, denselben Stellen dasselbe Licht spenden; wenn man sagt: nicht dasselbe Licht, so erhärtet man damit, daß der Körper der Sonne fließt. Indessen, daß das von Jenem Ausgehende unvergänglich ist und die Seelen und der ganze Geist unsterblich sind, das ist schon anderwärts ausführlicher gezeigt.
[11]Indessen, wenn das Geistige als Ganzes überall ist, warum nimmt dann nicht alles an ihm als Ganzem teil? Und wie kann es dort ein Erstes und dazu noch ein Zweites und nach diesem noch weitere Stufen geben? Nun, man muß annehmen, daß das Beiwohnende je nach der Eignung dessen beiwohne, das es aufnehmen soll; das Seiende ist überall im Seienden und läßt es nirgends an sich selber fehlen, es wohnt ihm aber nur das bei, was beizuwohnen vermag; und so weit wie sein Vermögen reicht, so weit, nicht im räumlichen Sinne, wohnt es ihm bei; so wohnt das Durchsichtige dem Lichte bei, das Trübe aber hat nur in geringerem Grade an ihm teil. Ferner ist Erstes und Zweites und Drittes hier nach Rang und Kraft und Unterscheidung zu verstehen, nicht im räumlichen Sinne. Denn nichts hindert, daß die so unterschiedenen Stufen beisammen existieren, so wie Seele und Geist und alle Wissenschaften, die wichtigeren wie die niederen. Nimmt doch auch vom selben Objekt das Auge die Farbe wahr, der Geruch das Wohlduftende und ein anderer Sinn noch etwas anderes, da sie alle beisammen und nicht getrennt sind. So ist also das Jenseitige mannigfaltig und vielfach? Nun, dies Mannigfache ist anderseits doch einfach, und die Vielheit doch wieder Einheit; denn seine rationale Form ist einheitlich und vielfach, und alles Seiende ist eines. Denn auch das Anders ist in ihm, und die Andersheit gehört ihm an; denn zum Nichtseienden kann sie ja nicht gehören. Und das Seiende gehört zu dem Einen, das nicht abgetrennt ist von ihm; wo das Seiende da ist, da wohnt ihm auch das ihm zugehörige Einssein bei, und das Eine wieder ist an sich selber Seiendes. Denn es gibt auch ein Beiwohnen dessen, das getrennt ist. Anders wohnen die Sinnendinge dem Geistigen bei (soweit sie beiwohnen und denen sie beiwohnen), anders das Geistige sich selber; wohnt ja auch anders der Leib der Seele bei, anders die Wissenschaft der Seele, anders die Wissenschaft der Wissenschaft, wenn beide in demselben Träger sich befinden; der Leib aber dem Leibe wieder in anderer Weise.
[12]Manchmal ertönt eine Stimme in der Luft und in der Stimme ein Wort, und ein Ohr, das gerade da ist, nimmt es auf und versteht es; stellt man nun in den leeren Zwischenraum ein anderes Ohr, so gelangt Stimme und Wort auch zu ihm, vielmehr das Ohr kommt zu dem Wort; desgleichen werden eine Mehrzahl von Augen, die auf denselben Gegenstand hinblicken, allesamt mit demselben Schaubild gefüllt, obgleich der Gegenstand sich an einem abgetrennten Ort befindet; und zwar weil das Aufnehmende hier Auge, dort Ohr war: gleichermaßen bekommt ein Ding, das es vermag, Seele, und ebenso ein Zweites, ein Drittes, und zwar von demselben her. Die Stimme, von der wir sprechen, ist überall in der Luft nicht als eine geteilte Einheit, sondern als eine überall ganze Einheit. Desgleichen hat beim Sehen die Luft, wenn sie etwa affiziert würde und die Bildgestalt an sich trüge, diese nicht als geteilte; denn wohin man auch ein Auge stelle, es erhält dort die Bildgestalt. Freilich wird diese Auffassung des Sehens nicht von jedem Standpunkt aus zugegeben; sie soll hier also nur deswegen angeführt sein, weil auch bei ihr die Teilhabe von einem und demselben ausgeht. Beim Hören aber ist es offenkundiger, daß die ganze Form überall in der Luft vorhanden ist; denn es könnte nicht jeder dasselbe hören, wenn das Laut gewordene Wort nicht an jeder einzelnen Stelle als ganzes da wäre und jedes Ohr gleichermaßen das Ganze aufgenommen hätte. Wenn also selbst hierbei keineswegs die Stimme als ganze dergestalt die ganze Luftstrecke entlang gebreitet ist, daß ihr einer Teil sich mit diesem Luftteil verbindet, ein anderer mit jenem Luftteil zugleich sich teilt, wie kann man da noch Bedenken haben, daß die Seele nicht am Körper entlang gebreitet ist und sich mit ihm teilt, sondern an jeder Stelle des Dinges, dem sie beiwohnt, zugegen ist, und so auch an jeder Stelle des Alls da ist, ohne geteilt zu werden. Wenn sie in die Körper eingetreten ist, in die sie denn überhaupt eintritt, so entspricht sie der schon in der Luft ertönenden Stimme, vor dem Eintritt in die Körper dagegen dem, das den Ton erzeugt oder erzeugen wird. Freilich, sie entfernt sich auch dann, wenn sie in den Leib eingetreten ist, dennoch nicht von der Entsprechung mit dem Tonerzeuger, welcher als tönender den Ton besitzt sowohl wie von sich gibt. Es hat eben der Vorgang des Tones mit dem, wozu er herangezogen wurde, keine Identität, aber er hat doch in gewissen Punkten Ähnlichkeit. Die Vorgänge mit der Seele aber, da sie dem andern Seinsbereich angehören, muß man so auffassen, daß nicht von ihr ein Stück in den Körpern und ein anderes bei ihr selber ist, sondern bei ihr selber ist sie als Ganzes, und anderseits tritt sie als Ganze an der Vielheit in Erscheinung. Und dann kommt wieder ein anderes, um Seele zu ergreifen, und auch dies erhält unversehens, was in den andern war. Denn die Seele war nicht in dem Sinne im Voraus bereit gemacht, daß ein Teil von ihr, der an dieser bestimmten Stelle gelegen wäre, nun in dieses Ding hinabkäme; sondern der Seelenteil, von dem man sagt, er komme herab, war im All in sich selber und ist in sich selber, obgleich er scheinbar auf diese Welt herabgekommen ist. Auf welche Weise hätte er denn überhaupt herabkommen sollen? Kommt sie also nicht herab, und wird doch als jetzt zugegen sichtbar, und zwar nicht etwa zugegen, indem sie auf etwas wartet, das an ihr Teil erhalten könnte, so steht sie klärlich auf sich und wohnt doch auch diesem Ding bei. Steht sie aber auf sich, indem sie diesem Ding beiwohnt, so kommt in Wahrheit dies Ding zu ihr hin. Wenn aber das, so gelangt, was außerhalb des wahrhaft Seienden war, hin zu solchem Sein und tritt damit ein in die schöne Ordnung der Lebendigkeit, diese Ordnung der Lebendigkeit aber steht dabei auf sich selber und steht klärlich als ganze auf sich und nicht als in ihre Masse zerteilte; sie hat ja auch gar keine Masse; so kommt denn das, was kommt, nicht zu einer Masse. Mithin nimmt an ihr teil als an einem Ganzen etwas, das nicht Teil ist. So, aber auch wenn wieder ein anderes Ding in diese Ordnung einträte, würde es wiederum als an einem Ganzen an ihm Teil erhalten; mithin wird diese Ordnung, gleichermaßen wie die in diesen beiden Dingen als ganze bezeichnet werden muß, in jedem einzelnen Ding ganz sein. Somit wird sie überall als identische und der Zahl nach eine nicht geteilt, sondern ganz da sein.
[13]Woher rührt dann ihre Ausdehnung über den ganzen Himmelsbau und die Lebewesen? Nun, sie hat sich garnicht ausgedehnt; nur die Sinneswahrnehmung, mit der beschäftigt wir dem Dargelegten keinen Glauben schenken wollen, sagt uns, daß sie hier und dort sei, die Vernunft dagegen sagt uns, daß ‘hier und dort’ nicht durch ihre Ausdehnung zu einem hier und dort wird, sondern daß alles Ausgedehnte an ihr teilhat, die selber unausgedehnt ist. Wenn nun etwas an etwas Teil erhalten soll, so ist klar, daß es nicht an sich selber Teil erhalten kann, sonst wäre es kein Teilhabendes, sondern nur es selber. Folglich kann ein Körper, der an etwas teilnimmt, nicht an einem Körper Teil erhalten; denn den hat er ja schon. Ein Körper kann also an einem Körper nicht Teil erhalten. So kann auch eine Größe nicht an Größe Teil erhalten, denn sie hat sie ja schon. Und auch wenn ihr etwas hinzugefügt wird, kann jene vorherige Größe nicht an Größe Teil erhalten; denn nicht das zwei Ellen Lange wird drei Ellen lang, sondern das Substrat bekommt eine andere Quantität, als es hatte; denn sonst wären ja die zwei selber drei geworden. Folglich, wenn nun das Zerteilte und in die Quantität Ausgedehnte an einem anderen Bereich oder überhaupt etwas an einem von sich Verschiedenen Teil erhalten soll, so darf das, an dem es teilnimmt, weder zerteilt noch ausgedehnt sein noch überhaupt ein Quantitatives. Als ganzes also muß das, was ihm beiwohnen soll, beiwohnen und als überall teilloses; und zwar nicht in dem Sinne teillos wie etwas Kleines; denn dann wäre es immer noch teilbar, würde zu dem ganzen Dinge nicht passen und ihm, wenn es sich vergrößert, nicht als dasselbe noch gesellt bleiben; auch nicht in dem Sinne wie ein Punkt, denn die Masse ist nicht ein Punkt, sondern in ihr sind unendlich viele; es müßte also auch das Beiwohnende, wenn es Punkt sein soll, vielmehr unendlich viele Punkte sein, und wäre dann nicht kontinuierlich; auch dann also würde es nicht passen. Wenn also die ganze Masse das Beiwohnende als Ganzes haben soll, muß sie es haben in der Ganzheit seines Seins.
[14]Aber wenn die Seele an jeder einzelnen Stelle identisch ist, wieso ist sie dann für das Einzelwesen seine eigene? und wie die eine gut, die andere böse? Nun, Jenes langt auch für jedes Einzelwesen hin und hat alle Seelen und alle Geiste. Denn Es ist eines, anderseits aber unendlich und alles zumal und trägt das einzelne in sich als abgetrenntes und doch wieder nicht gesondert abgetrennt. Denn in welchem Sinne sollte Es wohl unendlich heißen, wenn nicht deshalb, weil Es alles zumal hat, jegliches Leben und jegliche Seele und jeglichen Geist? Wobei aber das einzelne davon nicht durch Grenzen abgesondert ist (und insofern ist Es anderseits wieder eines). Es durfte ja nicht nur ein Leben haben, sondern unendliches Leben, dies mußte anderseits aber eines sein; es muß eben dies eine dergestalt eines sein, daß es alle Leben zumal hat, nicht verkoppelt zu einer Einheit, sondern von Einem her beginnend und verharrend, woher sie begannen, oder vielmehr begannen sie gar nicht, sondern Es besaß sie ewig so; denn in Jener Welt ist nichts Werdendes, also auch nichts sich Teilendes, sondern es scheint sich zu teilen für den, der es empfängt. So ist Jenes seit alters und von Urbeginn, das Werdende aber nähert sich ihm, scheint sich ihm zu verknüpfen und hängt von ihm ab. Wir aber – was sind wir? Sind ‘Wir’ jenes obere oder das, was sich ihm nähert, was in der Zeit wird? Nein, schon vor diesem unsern Werden waren Wir dort, andere Menschen, einige auch Götter, waren reine Seelen und waren Geist, mit dem gesamten Sein verknüpft, waren Teile des Geistigen, nicht abgesondert, abgeschnitten, nein, wir gehörten zu dem Gesamt; wie wir denn ja selbst heute noch nicht von ihm abgeschnitten sind. Freilich, heute ist zu jenem oberen Menschen ein anderer Mensch hinzugetreten: er wollte sein und machte uns ausfindig (wir waren ja nicht außerhalb des Alls) und bekleidete uns mit sich, fügte sich selbst jenem oberen Menschen hinzu, dem oberen Menschen, der jeder einzelne von uns dazumal gewesen ist (so wie wenn eine einheitliche Stimme, ein einheitliches Wort von vielen, die hier und da das Ohr anlegen, gehört und aufgenommen wird, und damit entsteht etwas aktuell Hörbares, welches das in ihm sich Verwirklichende als gegenwärtig hat); so sind wir denn die Vereinigung von Beidem geworden, und sind nicht manchmal nur das eine, das wir ehemals waren, manchmal nur das andere, das wir hernach zufügten, wenn jenes Frühere träge ist oder auf sonst eine Weise nicht zugegen.
[18]Und auf welche Weise ist dies Hinzutretende nun hinzugetreten? Nun, nachdem es die Eignung hatte, erhielt es das, wozu es geeignet war; es war aber derart, daß es Seele aufnehmen konnte. Was aber derart ist, daß es die Seele nicht ganz aufnehmen kann – obgleich sie ganz zugegen ist, nur nicht für dieses – wie die übrigen Lebewesen und die Pflanzen, das erhält nur soviel, als es zu fassen vermag; so wie bei einem Laut, der ein Wort bedeutet, die einen mit dem Klang des Lautes auch das Wort erfassen, die andern nur den bloßen Laut, nur die Erschütterung. Nachdem also ein Lebewesen entstanden war, welches bei sich zugegen die Seele aus dem Seienden hat, vermöge derer es verknüpft ist mit allem Seienden, – aber auch einen Körper hat es zugegen, der nicht leer ist und der Seele unteilhaftig, denn er war auch zuvor nicht im Unbeseelten gelegen, ist aber jetzt durch seine Eignung noch mehr gleichsam in die Nähe gerückt und nun nicht mehr bloßer Körper, sondern lebender Körper, der gleichsam durch die Nachbarschaft eines Schimmers der Seele genießen darf, nicht einen Teil von ihr, sondern gewissermaßen eine Art von Erwärmung oder Erleuchtung, die von ihr herabkommt – da erwuchs in ihm die Entstehung der Begierden, Lüste und Schmerzen; der Körper aber ist dem so entstandenen Lebewesen nicht wesensfremd. Die Seele nun, die aus dem Göttlichen stammt, verharrte in Ruhe, sie blieb in ihrer eigentümlichen Wesensart, auf sich selber fußend; der Körper aber, welcher infolge seiner Kraftlosigkeit verwirrt wurde und, selber schon fließend, noch als erster von den äußeren Stößen betroffen wird, er rief dies in die Gemeinsamkeit des Lebewesens hinein und teilte dem Ganzen seine eigne Verwirrung mit. So sitzen in einer Volksversammlung die Ältesten in ruhigem Sinnen, das Volk aber, zur Unordnung geneigt, verlangt nach Brot und beschwert sich über das, was es denn sonst zu leiden hat, und kann so die ganze Versammlung in wilden Tumult reißen; wenn nun, halten diese Ruhe, von einem Verständigen vernünftige Rede zu ihnen hindringt, so kommt die Menge zu Ordnung und Ruhe und das Niedere behält nicht die Oberhand; wenn aber nicht, so hat das Niedere die Oberhand über das ruhig bleibende Bessere, weil das Lärmende das von oben kommende vernünftige Wort nicht aufnehmen konnte: und das ist für eine Stadt und eine Versammlung das ihnen eigene Laster. Das ist aber auch beim Menschen das Laster, der seinerseits in sich eine Volksmenge von Lüsten, Begierden und Ängsten hat, die die Oberhand bekommen, wenn sich ein Mensch entsprechender Anlage solcher Volksmenge ausliefert. Wer aber diese Menge sich unterwirft und hinaufeilt zu jenem oberen Menschen, der er einstmals war, der lebt nach Jenes Weisung und ist jener und dem Leibe gibt er nur soviel, wie er ihm als einem von ihm Verschiedenen gibt. Eine dritte Art Menschen lebt bald so, bald anders; sie sind ein Gemisch aus dem Guten, das sie selber sind, und dem Bösen, welches das andere ist.
[16]Indessen, wenn jene obere Seele nicht böse wird und dies die Art ist, wie die Seele in den Körper geht und ihm beiwohnt, was hat es dann auf sich mit dem Abstieg der Seele in den Umläufen und dem Wiederaufstieg, mit den Urteilssprüchen und dem Eintreten in die Leiber anderer Lebewesen? Denn das haben wir von den Alten, die am besten über die Seele philosophiert haben, überkommen, und es ist billig, den Beweis zu versuchen, daß die gegenwärtige Erörterung in Übereinstimmung oder doch nicht in Widerspruch mit ihnen ist. Das Teilnehmen an der oberen Wesenheit erwies sich uns nicht als ein Herabkommen jener Wesenheit in diese Erdenwelt und ein sich Trennen von sich selber, sondern als ein Eintreten dieser unteren Wesenheit in jene obere und ein an ihr Teilnehmen. Somit ist klar, daß wir das, was jene ‘kommen’ nennen, auszulegen haben als den Eintritt des Körperlichen in die obere Welt, als eine Teilhabe an Leben und Seele, überhaupt nicht als ein Kommen im räumlichen Sinne, sondern wie immer denn die Art einer solchen Gemeinsamkeit ist. Somit bedeutet das Herabkommen der Seele, ihr Eintritt in die Leibeswelt, wie wir jedenfalls sagen, daß die Seele in den Körper tritt, nichts anderes, als daß sie dem Leibe etwas von ihrem Wesen dargibt, nicht aber ihm zugehörig wird, und ihr Fortgehen, daß der Leib in nichts mehr mit ihr Gemeinschaft hat; und es besteht für die Teile dieses Alls eine festgesetzte Ordnung für solche Gemeinsamkeit; die Seele aber, die gleichsam am unteren Rande des geistigen Bereiches steht, gewährt ihnen viele Male Anteil an sich, da sie ihnen mit ihrer Kraft nahe ist und ihr Abstand kürzer ist, nach dem ihr eignen Wesensgesetz. Und für sie ist solche Gemeinsamkeit ein Übel, und die Trennung ein Gutes. Warum dies? Weil sie, auch wenn sie dem Ding nicht zugehört, doch, da sie eben Seele dieses bestimmten Dinges genannt wird, in irgendeinem Sinne als ein Teil aus ihrem Ganzen heraustritt. Denn ihre Aktualität (Wirkungskraft) richtet sich nicht mehr auf das Ganze, obgleich sie dem Ganzen noch angehört; so wie der Wissenschaftler, während die Wissenschaft als ein Ganzes dabei bestehen bleibt, seine Aktualität auf einen einzelnen Lehrsatz richtet, wo doch für ihn das Gute nicht in einem einzelnen Stück der Wissenschaft liegt, sondern in der ganzen, die er besitzt. Ebenso also auch die Seele, während sie dem ganzen geistigen Kosmos angehört und in diesem Ganzen ihr Teilsein birgt, springt sie gleichsam hervor aus dem Ganzen in einen Teil hinein, den sie aktualisiert und der dabei ein Teil ihrer selbst ist; so wie wenn ein Feuer, welches alles zu verbrennen vermag, genötigt wird, nur ein kleines Stück zu verbrennen, obgleich es die Kraft für das Gesamte besitzt. Es ist nämlich die Seele, wenn sie ganz vom Niederen abgetrennt bleibt, als einzelne nicht einzeln; wenn sie aber sich absondert, nicht räumlich, sondern durch Aktualität zum einzelnen wird, so ist sie Teil und nicht ganze – freilich auch dann noch in einem andern Sinne ganze; aber wenn sie über kein Ding Herrschaft übt, dann ist sie ganz und gar ganze, und ist dann nur gleichsam potentiell Teil. Und das Kommen in den Hades bedeutet, wenn damit das Unsichtbare gemeint ist, ihre Absonderung vom Unteren. Ist aber gemeint, in einen niederen Ort, was Wunder? Wo es ja jetzt von der Seele heißt, daß sie dort an dem Orte sei, wo unser Leib ist. Und wenn der Leib nicht mehr ist? Nun, wenn sie sich von dem Schattenbild nicht losreißt, dann muß sie ja dort sein, wo das Schattenbild ist; wenn aber die Philosophie sie ganz von ihm loslöst, dann wird nur das Schattenbild allein an jenen niederen Ort kommen, sie selbst aber wird rein im Geistigen weilen, ohne daß ein Stück aus ihr herausgenommen ist. So steht es mit dem Schattenbild, welches aus solchem Vorgang entsteht. Wenn sie aber nur selber sich selber gleichsam erleuchtet, so ist sie durch die Wendung nach oben mit dem Ganzen vereinigt, ist nicht aktuell und ist doch nicht ausgelöscht. Indessen, soviel von diesen Dingen. Jetzt wollen wir die anfangs begonnene Untersuchung wieder aufnehmen.