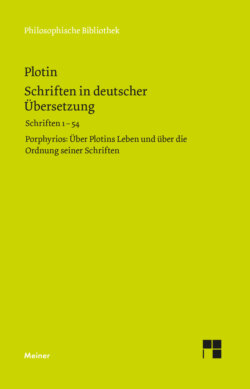Читать книгу Schriften in deutscher Übersetzung - Plotin - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die beiden Materien
ОглавлениеDie sogenannte Materie denkt man sich als eine Art ‘Unterlage’ und als ‘Aufnahmeort’ für die Formen; diese Vorstellung ist allen gemeinsam die sich einer solchen Wesenheit überhaupt bewußt geworden sind, und soweit gehen sie alle denselben Weg; mit der Frage aber, was diese ‘zu Grunde liegende’ Wesenheit sei und wieso sie aufnehme und was, damit beginnen die Meinungsverschiedenheiten. Diejenigen welche die Dinge nur als Körper und die Substanz in die Körper setzen, behaupten daß die Materie eine sei und unter den Elementen liege; sie sei die Substanz, die andern Dinge aber seien alle nur gewissermaßen ihre Affektionen, und auch die Elemente seien nur eine bestimmte Befindlichkeit von ihr; ja sie erkühnen sich sie sogar bis zu den Göttern reichen zu lassen und schließlich soll sogar Gott selbst solche bestimmt befindliche Materie sein. Sie geben dieser Materie auch einen Körper indem sie sie als qualitätlosen Körper bezeichnen und auch quantitative Größe.
Andre aber halten die Materie für unkörperlich; und einige von ihnen nehmen nicht nur eine Materie an; diese lassen unter den Körpern dieselbe Materie liegen wie jene ersten, aber es gebe noch eine andere, frühere Materie, die in der geistigen Welt unter den dortigen Formen und unkörperlichen Substanzen liegt. [2]Wir müssen also zunächst untersuchen ob es diese zweite Materie gibt, von welcher Art sie ist, und inwiefern sie ist.
‘Wenn denn ein Ding wie die Materie etwas unbestimmtes und ungestaltetes sein muß, es aber unter den Dingen der oberen Welt, die von höchster Vollkommenheit sind, nichts unbestimmtes und ungestaltetes gibt, so kann es dort keine Materie geben. Und wenn jedes intellegible Wesen einfach ist, bedarf es keiner Materie, die, mit einem andern zusammengesetzt, jenes intellegible Wesen ergäbe. Die Dinge ferner welche entstehen und aus einem in den andern Zustand überführt werden, bedürfen der Materie (von ihnen ist denn auch der Gedanke einer Materie der Sinnendinge ausgegangen), die aber nicht entstehen, nicht. Woher sollte sie denn auch gekommen sein und wie entstanden? Denn ist sie geworden, dann von jemandem; ist sie aber ewig, dann würde es mehrere Urprinzipien geben, und es herrschte Zufall unter den ersten Prinzipien. Ferner, auch wenn eine Form hinzutritt, müßte das aus Form und Materie Zusammengesetzte Körper sein; dann würde es also auch in der intellegiblen Welt den Körper geben.’ –
[3]Zuerst nun ist hiergegen zu sagen, daß man das Unbestimmte nicht überall gering achten muß, so auch nicht das was seinem Begriff nach ungestaltet ist, wenn es sich nur darzubieten geneigt ist dem was über ihm steht, den Wesenheiten von höchster Güte; so verhält sich ja auch die Seele zum Geist und zur Vernunft, sie wird geformt von ihnen und in eine bessere Gestalt erhoben. Ferner, in der geistigen Welt versteht sich Zusammensetzung in einem anderen Sinne, nicht wie bei den Körpern. Denn die rationalen Formen sind zusammengesetzt, und sie machen durch ihre Wirksamkeit zusammengesetzt diejenige Wesenheit welche hinwirkt auf die Gestaltung (der Welt); wirkt sie aber auf ein andres und erhält von ihm Wirkungen, ist sie erst recht zusammengesetzt. Die Materie ferner der vergänglichen Dinge erhält eine immer neue Gestalt, die Materie der ewigen ist aber stets dieselbe und hat stets die gleiche Gestalt. Der irdischen Materie geht es wohl umgekehrt; denn hier unten ist sie der Reihe nach alles mögliche, und jedesmal nur ein einzelnes; so bleibt nichts in ihr, da eine Form die andere hinausdrängt, sie ist also immer verschieden. Die intellegible Materie aber ist alles zugleich; es gibt also nichts in das sie sich verwandeln könnte, denn sie hat schon alles in sich. Ungestaltet ist also auch dort oben die intellegible Materie niemals, sowenig wie die irdische – allerdings beide in verschiedener Weise. Die Frage endlich ob sie ewig oder geworden ist, wird sich klären wenn wir ihr Wesen erfaßt haben. –
[4]Für den Weitergang der Untersuchung wollen wir die Existenz der Ideen für jetzt als gegeben annehmen; sie ist ja an andrer Stelle bewiesen worden. Wenn nun die Ideen viele sind, so muß es notwendig ein Gemeinsames in ihnen geben, und auch ein Eigenes wodurch sich die eine von der andern unterscheidet. Dies Eigene also, dieser absondernde Unterschied, ist die individuelle Gestalt der Idee. Ist aber eine Gestalt da, so gibt es etwas das gestaltet wird, an dem der spezifische Unterschied ist; es gibt dort also auch eine Materie, welche die Form aufnimmt und für jede das Substrat ist. Ferner wenn es in der oberen Welt einen intellegiblen Kosmos gibt, und der irdische sein Abbild ist, dieser aber zusammengesetzt ist unter anderm aus Materie, dann muß es auch dort oben Materie geben. Oder wie kann man ihn Kosmos nennen außer im Hinblick auf seine Gestalt, und wie kann er Gestalt haben wenn er nichts hat an dem die Gestalt ist? Ferner, die intellegible Welt ist durchaus und gänzlich teillos, aber doch wieder in gewissem Sinne teilbar. Wenn nämlich die Teile auseinander gerissen werden, so handelt es sich um eine Zerschneidung und Zerreißung, die nur Affektion einer Materie sein kann, denn sie ist diejenige die zerschnitten wird; ist aber der Gegenstand der Teilung zugleich unteilbar und Vielheit, so ist dies Viele, das in dem einen ist, in dem einen als in einer Materie, denn es ist seinerseits die Form des Einen. Denn dies Eine stelle dir vor als vielfältig und vielgestaltig; folglich ist es an sich gestaltlos, ehe es vielfältig ist; denn wenn man die Vielfältigkeit, die Formen, die Begriffe, die Gedanken die in dem Einen sind, wegdenkt, so ist das, was vor diesem allen ist, gestaltlos und unbestimmt, und nichts von dem was an und in ihm ist. Wollte man aber einwenden, daß deswegen weil[5] die intellegible Materie all dies immer hat und mit ihm in eins ist, beide eine Einheit sind und jenes zugrunde liegende also nicht Materie, so könnte dann auch hienieden keine Materie der Körper existieren, denn auch sie ist niemals ohne Gestalt, sondern immer ist es ein Gesamtwesen, trotzdem aber zusammengesetzt, der Geist erst findet diese Zweiheit auf; er zerlegt, bis er zu einem Einfachen gelangt das seinerseits nicht mehr weiter auflösbar ist; soweit er aber vermag, dringt er in die Tiefe des Körpers vor. Die Tiefe aber jeden Dinges ist seine Materie, weshalb sie denn auch gänzlich dunkel ist, weil das Licht Form und Geist ist. Daher die Vernunft, wenn sie die Form an dem Einzelding sieht, das was tiefer liegt, für dunkel hält, weil es unter dem Licht ist; so wie das Auge, das lichthaft ist, wenn es zum Licht hinblickt und zu den Farben, die Licht sind, das was unter den Farben ist als dunkel und stofflich anspricht, da es von den Farben überdeckt ist. Jedoch ist das Dunkle verschieden in der geistigen und der sinnlichen Welt, und verschieden ist auch die Materie so gut wie auch die Gestalt die über beide Materien gelagert ist, verschieden ist. Denn wenn die göttliche Materie das sie Bestimmende in sich aufnimmt, dann hat sie selbst bestimmtes, geisthaftes Leben, die irdische aber wird zwar zu einem Bestimmten, ist aber nicht selbst lebendig und geistig, sondern nur ein geformtes Totes. Ferner ist auch die irdische Form nur ein Schattenbild; also ist auch das irdische Substrat Schattenbild. Dort oben aber ist die Gestalt wahrhaftig, also auch das Substrat. So müßte man denn, wenn die Lehre, die Materie sei Substanz, sich auf die intellegible Materie bezöge, sie für richtig halten; denn das intellegible Substrat ist Substanz, oder richtiger, mit seiner Form zusammengedacht und als Ganzes ist es durchlichtete Substanz.
Ob aber die intellegible Materie ewig ist, diese Frage ist in derselben Weise zu stellen wie man sie auch bei den Ideen stellen könnte: beide sind entstanden sofern sie einen Ursprung haben, unentstanden sofern ihr Ursprung nicht in der Zeit liegt, sondern sie ewig von ihm bedingt sind, nicht als immer werdende wie unsere Welt, sondern als immer seiende wie die obere Welt. Denn die intellegible ANDERSHEIT welche die Materie hervorbringt, ist ewig, denn sie ist der Ursprung der Materie, sie und die erste BEWEGUNG; daher man auch die Bewegung ‘Andersheit’ genannt hat, weil Andersheit und Bewegung gleichzeitig erwuchsen. Die Bewegung nun und die Andersheit die aus dem Ersten kommen, sind unbestimmt und bedürfen seiner um zur Bestimmtheit zu gelangen; sie werden bestimmt wenn sie sich zu Jenem umwenden; davor war die Materie unbestimmt, sie war das ‘Andere’ und noch nicht gut sondern undurchlichtet von jenem. Wenn nämlich von jenem das Licht kommt, hat dasjenige was das Licht aufnimmt vor der Aufnahme ewig kein Licht; es muß das Licht als etwas von sich Verschiedenes haben, wenn anders es von einem andern stammt.
[6]Damit ist schon mehr als angemessen über die intellegible Materie aufgewiesen. Über die Materie aber die der Aufnahmeort der Körper ist, sei folgendes gesagt. Daß es etwas geben muß das den Körpern zugrundeliegt als ein von ihnen Verschiedenes, das beweist einmal die Verwandlung der Elemente ineinander. Denn das sich Ändernde geht nicht völlig zugrunde, sonst würde es ja ein Sein geben das ins Nichtseiende verschwände; anderseits kann das Werdende nicht aus dem schlechthin Nichtseienden ins Sein kommen; sondern es handelt sich um einen Wandel aus einer Gestalt in die andere; dabei bleibt dasjenige, welches die Gestalt des Werdenden aufnimmt und die des Vergehenden verliert. Ferner beweist dasselbe auch der Vorgang des Zugrundegehens überhaupt; denn er ist nur an einem Zusammengesetzten möglich; ist das Einzelding aber zusammengesetzt, so besteht es aus Materie und Form; das bezeugt auch die Induktion, die zeigt, daß das, was zugrunde geht, zusammengesetzt ist. Drittens beweist aber auch die Auflösung die Notwendigkeit der Materie: z. B. wenn die goldene Schale sich auflöst indem sie sich in einen Goldklumpen verwandelt, und das Gold in Wasser, dann wird für das Wasser ein Entsprechendes erfordert in das es sich verwandelt. Die Elemente ferner sind notwendig entweder Gestalt oder Erste Materie oder aus Gestalt und Materie. Nun können sie nicht bloße Gestalt sein; denn wie könnten sie ohne Materie im Zustand der Masse, der quantitativen Größe sein? Aber auch nicht Erste Materie; denn sie gehen ja zugrunde. Folglich sind sie aus Gestalt und Materie zusammengesetzt. Und zwar steht die Gestalt auf der Seite von Qualität und Form, die Materie auf der Seite des darunterliegenden Unbestimmten, da sie beileibe nicht Gestalt ist.
[7]Wenn Empedokles die Elemente zur Materie rechnet, so wird das durch ihr Zugrundegehen widerlegt. Und wenn Anaxagoras die ‘Mischung’ zur Materie macht, und diese nicht für alles aufnahmefähig sein, sondern alles schon aktual in sich enthalten läßt, so macht er den Geist, den er einführt, selbst zunicht, da er nicht ihn die Form und die Gestalt hervorbringen läßt, und ihn nicht vor die Materie sondern gleichzeitig setzt. Diese Gleichzeitigkeit ist aber unmöglich. Denn wenn die Mischung am Sein nur Teil hat, so ist das Seiende vorher; ist aber die Mischung selber und auch das Sein seiend, so ergibt sich notwendig über beiden ein Drittes. Muß also notwendig der Schöpfer vorher sein, wozu brauchten dann die Formen schon in kleinen Stücken in der Materie zu sein und der Geist sie mit endloser Mühe erst von der Materie zu scheiden, wo es doch freistand, wenn die Materie qualitätslos war, die Qualität und die Gestalt ganz über sie zu breiten? Daß ferner alles in allem sei, ist eindeutig unmöglich. Wer ferner die Materie als das Unendliche ansieht, der soll sagen was das eigentlich ist. Meint er unendlich ‘so daß man nicht bis zum Ende gelangen kann’, so ist klar, daß es ein derartiges Ding in der Wirklichkeit nicht gibt, weder ein ‘Unendliches an sich’ noch an einem andern Wesen, als Accidens irgendeines Körpers; das ‘Unendliche an sich’ nicht, weil dann auch sein Teil notwendig unendlich wäre; das Unendliche als Accidens nicht, weil dasjenige an dem es als Accidens ist, dann nicht an sich unendlich wäre, also nicht einfach, also auch keine Materie mehr. Aber auch die Atome können nicht den Rang der Materie einnehmen, schon weil es sie überhaupt nicht gibt, denn jeder Körper ist ins immer weiter teilbar. Ferner die Kontinuität der Körper und ihr flüssiger Zustand und der Umstand daß die Einzeldinge unmöglich ohne Geist und Seele zu Stande kommen können, welche ihrerseits unmöglich aus den Atomen stammt; ferner ist es unmöglich eine andre Wesenheit außer Atomen aus den Atomen zu schaffen; denn auch kein Schöpfer kann etwas schaffen aus einem nicht kontinuierlichen Stoffe. Diese und zahllose andere Argumente könnte man gegen die Atom-Hypothese geltend machen und hat man gegen sie geltend gemacht; deshalb ist es an dieser Stelle überflüssig länger dabei zu verweilen.
[8]Welcher Art ist denn nun diese Materie, die als eine und kontinuierlich und qualitätlos bezeichnet wird? Daß sie, wenn anders qualitätlos, nicht Körper sein kann, ist klar; als Körper müßte sie ja qualitätsbestimmt sein. Wenn wir sie als Materie von allen Sinnendingen bezeichnen, nicht etwa nur von einigen Materie und andern gegenüber etwa Form, so nennen wir z. B. den Ton Materie für den Töpfer, nicht aber Materie schlechthin – so also nicht, sondern als Materie allen Dingen gegenüber, dann dürfen wir ihrem Wesen nichts von alledem zuschreiben was wir an den Sinnendingen beobachten. Dann aber, außer den andern Qualitäten wie Farben, Kälte oder Wärme, auch keine Leichte oder Schwere, keine Dichte oder Dünne, ja auch keine Gestalt. Mithin also auch keine Größe; denn es ist ein anderes, im Zustand von Größe zu sein, ein anderes Großheit zu sein, und ebenso ein anderes gestaltet zu sein, ein anderes Gestalt zu sein. Die Materie darf auch nicht zusammengesetzt sein, sondern einfach und ihrem Wesen nach Einheit; nur so ist sie bar aller Bestimmtheiten. Derjenige der ihr eine Gestalt gibt, gibt diese ihr als etwas anderes und fremdes, und ebenso Größe und alle andern Bestimmtheiten, er fügt sie ihr aus den vorhandenen Wirklichkeiten gleichsam hinzu; sonst müßte er gebunden sein an Größe und nicht etwas von derjenigen Größe schaffen die er will, sondern wie die Materie mag; daß aber sein Wille immer gerade der Größe der Materie entspreche, ist eine bloße Fiktion. Da das schaffende Wesen früher ist als die Materie, ist notwendig die Materie in jeder Beziehung derart, wie der Schöpfer es will, und ist schmiegsam zu allem, folglich auch zur Größe. Hätte sie ferner schon Größe, so müßte sie auch Gestalt haben; dann wäre sie erst recht ein spröder Werkstoff. Erst die Gestalt also, welche in die Materie eintritt, bringt ihr alle Bestimmtheiten; die Gestalt enthält alles, die Größe und was sonst im Formbegriff liegt und unter ihn fällt. So ist denn auch bei den Gattungen jedesmal mit der Gestalt auch das Wieviel bestimmt; die Größe des Menschen, die Größe des Vogels, die Größe einer bestimmten Vogelart sind ja voneinander verschieden. Übrigens ist es gar nicht befremdlicher daß der Materie das Wieviel als ein anderes hinzugefügt wird, als daß man ihr Wiebeschaffen erst einen fremden Zusatz sein läßt; denn so gut wie das Wiebeschaffen ist auch das Wieviel Formbegriff, da es Gestalt und Maß und Zahl ist.
[9]Wie kann man nun aber ein Ding der Wirklichkeit erfassen, welches keine Größe hat? Nun, alles was nicht mit dem Wieviel zusammenfällt. Das Seiende und das Wieviel sind ja nicht identisch, und es gibt noch viele andre Dinge die verschieden sind vom Wieviel, und allgemein muß man jede unkörperliche Wesenheit als unquantitativ ansetzen; unkörperlich ist aber auch die Materie. Ist doch auch die Idee der Wievielheit nicht wieviel, sondern erst das was an ihr Teil erhält; auch daraus ergibt sich also daß die Wievielheit eine Gestalt ist. Wie nämlich etwas weiß wird durch Beiwohnen der Weiße, dasjenige aber was die weiße Farbe am Tier und ebenso die bunten Farben hervorbringt, selbst nicht bunte Farbe ist, sondern bunter, sagen wir Begriff, so ist auch das was die bestimmte Größe hervorbringt, selbst nicht groß, sondern es ist die Großheit, das heißt der Begriff, der das einzelne größebestimmte Ding hervorbringt. Entfaltet nun also die Großheit, wenn sie hinzutritt, die Materie zur Größe? Keineswegs; denn die Materie war ja nicht auf kleinem Raum zusammengewickelt; sondern sie gab der Materie die Größe, die sie zuvor nicht hatte, so wie sie auch die Wiebeschaffenheit erhielt, die sie zuvor nicht hatte.
[10]‘Als was soll ich mir aber diese Größelosigkeit an der Materie denken?’ – Und wie willst du dir sonst ein irgend Qualitätloses denken, was ist das für ein Denken, worin besteht dabei das Hinblicken der Überlegung? Offenbar muß es Unbestimmtheit sein; denn wenn man das Gleiche durch das Gleiche erkennt, so auch das Unbestimmte durch das Unbestimmte. Der Begriff des Unbestimmten ist natürlich bestimmt, aber das Hinblicken auf es muß unbestimmt sein. Wenn jede Erkenntnis auf dem Begriff und dem Denken beruht, bei der Erkenntnis der Materie aber der Begriff zwar aussagt was er denn von ihr aussagt, das aber was Denken sein will, hier nicht Denken sondern eher eine Art Undenken sein muß, dann ist ihre Vorstellung natürlich eine illegitime, nicht echte, da sie sich zusammensetzt einerseits aus einem Unwirklichen, anderseits aus dem mit diesem Unwirklichen verbundenen Begriff. Und vielleicht hat Plato das im Auge gehabt, als er sagte die Materie sei nur durch ein ‘unechtes Denken’ zu erfassen. Was ist das also für eine Unbestimmtheit in der Seele? Etwa gänzliches Nichtwissen, Unmöglichkeit jeder Aussage, oder ist das Unbestimmte Gegenstand einer gewissen positiven Aussage, und wie man mit dem Auge die Finsternis als die Materie jedes nicht sichtbaren Dinges sieht, so kann auch die Seele, wenn sie alle Eigenschaften wegdenkt die wie Licht auf den sinnlichen Dingen sind, den Rest nicht mehr bestimmen und es ergeht ihr wie dem Sehen in der Dunkelheit, sie wird in gewisser Weise dem gleich was sie sozusagen sieht. Aber sieht sie dann überhaupt noch? Nur so wie sie Gestaltlosigkeit und Farblosigkeit, das Lichtlose und ferner das Größelose sieht; sonst würde sie sie bereits zu einem Gestalteten machen. Ist diese Affektion der Seele nicht identisch mit der, wenn sie nichts denkt? Nein, denn wenn sie nichts denkt, sagt sie nichts aus, genauer, sie wird überhaupt nicht affiziert; denkt sie aber die Materie, so wird sie in dem Sinn affiziert, daß sie gewissermaßen einen Abdruck des Gestaltlosen empfängt. Denn auch wenn sie etwas das Gestalt und Größe hat denkt, denkt sie es als ein Zusammengesetztes; denn sie denkt es als etwas das Farbe, und überhaupt Qualität erst erhält; sie denkt also das Ganze als diese beiden Bestandteile. Das Denken nun oder die Wahrnehmung dessen was ‘darauf’ ist, ist klar, das des Zugrundeliegenden aber dunkel, denn das ist ohne Gestalt. Was sie also in dem Ganzen und Zusammengesetzten erfaßt zusammen mit dem was ‘darauf’ ist, davon scheidet sie das was darauf ist und trennt es ab, und was dann begrifflich übrig bleibt, das denkt sie unklar und dunkel, wie es denn unklar und dunkel ist, sie denkts und denkts doch nicht. Da nun die Materie auch selbst nicht gestaltlos bleibt, sondern in den Dingen als gestaltete ist, prägt auch die Seele ihr alsbald die Gestalt der Dinge auf; sie leidet unter der Unbestimmtheit, hat gewissermaßen Angst außerhalb des Seienden zu sein und hält es nicht aus lange bei dem Nichtseienden stehen zu bleiben.
[11]‘Aber warum bedarf es dann zur Bildung der Körper außer der Größe und allen Qualitäten noch einer weiteren Wesenheit?’ – Es bedarf einer Wesenheit welche all dies aufnehmen kann. – ‘Das ist also die Masse; und wenn Masse, doch wohl auch Größe. Wenn sie aber keine Größe hat, hat sie auch keinen Raum um etwas aufzunehmen; und was kann sie als Wesen ohne Größe überhaupt zur Bildung der Körper beitragen, wenn sie weder zur Gestalt und zum Wiebeschaffen etwas tun soll noch zur Ausdehnung und zur Größe, die doch offensichtlich, wo sie da ist, von der Materie her in die Körper kommt? Überhaupt aber, wie es Handlungen Hervorbringungen Zeiten Bewegungen in der Wirklichkeit gibt, ohne daß sie eine Unterlage von Materie in sich haben, so ist auch nicht notwendig daß die Körper der Elemente Materie haben, sondern sie können als Ganzheiten sein was sie jeder sind, und mannigfach qualifiziert sein weil sie aus Mischung mehrerer Formen zu Stande kommen. Mithin ist diese Größelosigkeit der Materie ein leeres Wort.’ –
Erstlich ist es nicht nötig, daß dasjenige, welches irgendetwas aufnimmt, Masse ist, solange ihm noch keine Größe beiwohnt; wie denn auch die Seele, welche alles in sich aufnehmen kann, alles beisammen in sich hat; wenn aber Größe zu ihren Eigenschaften gehörte, dann würde sie alles im Sinn der Größe in sich haben. Die Materie empfängt das was sie aufnimmt deshalb in räumlicher Ausdehnung, weil sie die Ausdehnung aufzunehmen fähig ist; ebenso wie die Tiere und Pflanzen mit ihrem Größerwerden zusammen mit dem Wieviel auch eine entsprechende Ausdehnung des Wiebeschaffen erfahren, und bei einer Verkleinerung eine entsprechende erfahren würden. Will man, weil bei solchen Wesen eine gewisse Größe als Unterlage für das Formende vorher da ist, deshalb nun auch bei der Materie eine solche verlangen, so ist das nicht richtig; denn hier handelte es sich nicht um die Materie schlechthin, sondern um die dieses bestimmten Einzelnen; die Materie schlechthin muß aber auch die Größe von einem andern erhalten. Es braucht also das was die Form aufnehmen soll, nicht Masse zu sein, sondern ihr Masse-Werden und die Aufnahme der Wiebeschaffenheit sind gleichzeitig; sie gibt zwar eine Vorstellung von Masse, denn sie ist gleichsam das Erstgeeignete zur Aufnahme der Masse; aber diese Masse ist leer – daher denn einige die Materie mit dem Leeren gleichgesetzt haben. Vorstellung von Masse sage ich, weil die Seele, wenn sie mit der Materie umgeht, nichts Bestimmtes erfassen kann, sondern sich ins Unbestimmte ausgießt, sie kann ihre Konturen nicht umschreiben, sich nicht auf einen Punkt richten; denn das wäre schon ein Bestimmen. Deshalb darf man sie nicht allein groß und auch wieder nicht klein nennen, sondern ‘groß-und-klein’; in diesem Sinn ist sie Masse und in diesem Sinn ohne Größe, denn sie ist Materie der Masse; wenn die Masse sich zusammenzieht aus groß in klein und ausdehnt aus klein in groß, dann durchläuft die Materie sozusagen diese Massenausdehnung. So ist die Unbestimmtheit der Materie in dem Sinne Masse, als sie Aufnahmeort der Größe in ihr ist; in der Vorstellung aber ist sie im geschilderten Sinne Masse. Was von den übrigen größelosen Dingen Gestalt ist, ist jedesmal bestimmt; bei ihnen gibt es also keinerlei Begriff der Masse; die Materie aber ist unbestimmt, sie steht noch nicht bei sich selbst, sondern gerät hierhin und dorthin in alle möglichen Gestalten, sie ist allseits gefügig, indem sie in alles überführt werden und zu allem werden kann, wird sie vielfältig und bekommt auf diese Weise die Artung der Masse.
[12]So trägt also die Materie auf das Entscheidendste zur Bildung der Körper bei. Denn die Form des Körpers ist in der Größe; an der Größe aber können die Formen nicht in Erscheinung treten, sondern nur an dem mit Größe ausgestatteten Ding. Denn wenn an der Größe und nicht an der Materie, dann wären die Formen immer noch ohne Größe und ohne Zugrundeliegendes, sie wären bloße Begriffe (wie sie in der Seele sind), und es würde keine Körper geben. Es müssen also in der sinnlichen Welt die vielen Formen ein Zugrundeliegendes haben; und das ist das mit Größe ausgestattete Ding; das aber ist verschieden von der Größe als solcher. Ferner ist es doch in unserer Welt so, daß alle Dinge die sich mischen, deshalb Zusammenkommen können weil sie Materie haben; es bedarf keines weiteren Gegenstandes an dem die Mischung sich vollzieht, weil jeder Mischungsbestandteil seine eigene Materie einbringt; trotzdem bedarf es einer Grundlage, welche die Mischung aufnehmen kann, eines Gefäßes, eines Raumes; der Raum aber ist später als die Materie und die Körper; folglich bedürfen die Körper zuvor der Materie.
Ferner trifft es nicht zu, daß weil die Hervorbringungen und Handlungen materielos sind, es deshalb auch die Körper sein könnten. Denn die Körper sind zusammengesetzt, die Handlungen aber nicht. Dem Handelnden reicht ja die Materie die Grundlage der Handlungen jedesmal dar, indem sie in den Dingen bleibt, dem Handeln selbst aber nicht sich als Materie dargibt; das wollen ja die Handelnden gar nicht. Ferner, nicht die Handlungen gehen ineinander über (dann müßten sie in der Tat auch eine eigene Materie haben), sondern der Handelnde geht von einer Handlung zur andern über; also ist er die Materie für die Handlungen.
So ist also die Materie notwendig für die Wiebeschaffenheit wie für die Größe; also auch für die Körper; sie ist keineswegs leeres Wort, sondern es gibt ein Zugrundeliegendes, obgleich es unsichtbar und größelos ist. Andernfalls müßten wir mit derselben Begründung auch die Wiebeschaffenheiten und die Größe leugnen; alles derartige wäre dann, wenn man es allein an sich selbst betrachtet, ebenfalls ein Nichts. Wenn aber diese existieren obgleich sie im einzelnen schwer erfaßbar sind, so existiert erst recht die Materie, mag sie auch nicht augenfällig sein, da sie mit den Sinnen nicht erfaßbar ist; das können weder die Augen, denn sie ist farblos, noch die Ohren, denn sie ist ohne Laut; sie hat auch keinen Geruch und Geschmack, also kann auch Nase und Zunge sie nicht erfassen; vielleicht der Tastsinn? Nein, sie ist ja nicht körperlich; der Tastsinn geht auf den Körper, denn er erfaßt dicht und dünn, weich und rauh, feucht und trocken; und all das fehlt der Materie; sondern sie ist erfaßbar nur durch einen Schluß, der nicht aus der Vernunft kommt, sondern leer schließt, weshalb er, wie gesagt, ‘unecht’ heißt. Nicht einmal die Idee der Körperlichkeit hat die Materie; denn wenn die Idee der Körperlichkeit Begriff ist, ist sie von der Materie verschieden, also ist die Materie etwas anderes; denkt man aber an sie im Zustand des Schaffens und gleichsam schon Gemischtseins, dann ist sie offenbar schon Körper und nicht mehr allein Materie.
[13]Wenn man aber das Zugrundeliegende als eine Art Wiebeschaffenheit ansehen will, die den einzelnen Elementen etwa gemeinsam sei, so sage man erstlich welches diese sein sollte. Wie kann ferner Wiebeschaffenheit ein Zugrundeliegendes sein, und wie kann man sich ein Wiebeschaffenes an einem Größelosen vorstellen, wenn es keine Materie und also keine Größe hätte? Weiter, Wiebeschaffenheit ist bestimmt; wie kann sie da Materie sein? Soll sie aber irgendwie unbestimmt sein, dann ist es keine Wiebeschaffenheit, sondern eben das Zugrundeliegende, die gesuchte Materie.
‘Aber warum soll nicht ihre Qualitätslosigkeit darin bestehen, daß sie mit ihrem Sein an keiner der Wiebeschaffenheiten teilhat, daß sie aber eben vermöge dieses Nichtteilhabens wiebeschaffen ist, indem sie durchaus eine bestimmte, von den andern verschiedene Eigentümlichkeit hat, nämlich sozusagen die Beraubung (Privation) aller andern? Ist doch auch der Beraubte wiebeschaffen, zum Beispiel der Blinde. Trägt also die Materie die Privation der Wiebeschaffenheiten an sich, so muß sie wiebeschaffen sein; wenn aber die Privation schlechthin, so erst recht, wenn anders auch die Privation ein Wiebeschaffenes ist.’ – Wer das behauptet der tut nichts andres als alle Dinge zu wiebeschaffenen und zu Wiebeschaffenheiten zu machen. Es wäre dann auch die Wievielheit Wiebeschaffenheit, ja auch die Seinsheit. Aber wenn etwas wiebeschaffen ist, muß an ihm doch Wiebeschaffenheit vorhanden sein! Es ist lächerlich, das was gerade ein anderes als wiebeschaffen, nämlich nicht wiebeschaffen ist, zu einem Wiebeschaffenen zu machen. Wenn es wiebeschaffen sein soll, weil es ein anderes ist, so ist das entweder Andersheit als solche; dann ist es nicht wiebeschaffen, denn auch die Wiebeschaffenheit als solche ist nicht wiebeschaffen; oder es ist ein bloßes Anderssein, dann ist es nicht durch sich selbst, sondern durch die Andersheit anders und durch die Identität identisch. So ist auch die Privation keine Wiebeschaffenheit und kein Wiebeschaffenes, sondern die Abwesenheit von Wiebeschaffenheit oder eines Andern, wie die Lautlosigkeit Abwesenheit von Laut, oder was es sonst sei; denn die Privation ist Aufhebung, während das Wiebeschaffene eine Bejahung enthält. Ferner ist das Spezifische der Materie die Formlosigkeit, indem sie nämlich keine Qualität und keine Gestalt hat; da ist es doch ein Unding, sie, weil sie nicht wiebeschaffen ist, wiebeschaffen zu nennen; das wäre dasselbe als wollte man ihr, weil sie keine Größe hat, eben deswegen Größe zuschreiben. Ihr Spezifisches nun ist nicht von ihrem Sein verschieden, und ist keine Zutat, sondern besteht vielmehr in ihrem Verhältnis zu den andern Dingen, daß sie nämlich ein anderes als die andern ist. Die andern Dinge sind nicht nur andere, sondern außerdem noch jedes ein Etwas, ein Geformtes, sie aber könnte man passend bezeichnen als ‘nur anderes’; oder vielleicht als ‘andere’, um sie nicht durch den Singular ‘anderes’ zu determinieren, sondern durch den Plural ‘andere’ ihre Bestimmungslosigkeit anzudeuten.
[14]Jedoch das ist noch zu untersuchen, ob sie Privation ist oder ob die Privation nur an ihr ist. Die Lehre die meint daß Materie und Privation dem Substrat nach eines, dem Begriff nach aber zwei seien, ist verpflichtet darzulegen, wie man den Begriff beider so fassen muß, daß er die Materie definiert ohne irgendeine Beiziehung der Privation und entsprechend die Privation. Entweder ist beides nicht im Begriff des andern enthalten, oder beides ist im Begriff des andern enthalten, oder drittens nur eins von beiden, gleichgültig welches. Wenn beide völlig gesondert sind und keines des andern bedarf, dann müssen sie zwei sein und die Materie etwas anderes als die Privation, wenn auch die Privation ein Prädikat von ihr sein mag, und dann darf man in dem einen Begriff das andere auch nicht potential enthalten sein lassen. Verhalten sie sich aber zueinander wie die Stumpfnase und das Stumpfe, so sind sie auch so ein Doppeltes und sind zwei. Wenn es aber ist wie bei Feuer und Hitze, wo nämlich die Hitze im Feuer enthalten, das Feuer aber in der Hitze nicht mitgesetzt ist, und ist die Materie in dem Sinne Privation wie das Feuer heiß ist, dann muß die Privation sozusagen ihre Gestalt sein, das Zugrundeliegende also etwas anderes, und dies andere muß man dann als die Materie ansetzen; übrigens sind sie auch so nicht eins. Ist also diese Einheit des Zugrundeliegenden und Zweiheit des Begriffs so zu verstehen, daß die Privation nicht die Anwesenheit von etwas, sondern die Abwesenheit bezeichnet, und gewissermaßen eine Negation des Seienden ist, so wie bei der Aussage ‘nicht seiend’ die Verneinung nichts hinzutut sondern aussagt daß etwas nicht ist, und ist also die Materie in dem Sinne Privation daß sie ‘nicht ist’? Wenn sie ‘nicht ist’, sofern sie nicht das Seiende, sondern etwas andres ist, dann sind die Begriffe immer noch zwei verschiedene, der eine erfaßt das Zugrundeliegende, der der Privation aber bezeichnet das Verhältnis zu den andern Dingen. Oder der Begriff Materie bezeichnet das Verhältnis zu den andern Dingen, wie auch der des Zugrundeliegenden, der Begriff der Privation aber könnte vielleicht, wenn er die Unbestimmtheit der Materie bezeichnet, schon als solcher an das Wesen der Materie heranreichen? Allerdings sind auch so noch beide dem Zugrundeliegenden nach eins aber dem Begriff nach zwei. Wenn jedoch die Privation, dadurch daß sie Unbestimmtheit und Grenzenlosigkeit und ohne Wiebeschaffenheit ist, mit der Materie identisch ist, dann können [15]die Begriffe nicht mehr zwei sein. Es muß also nochmals geprüft werden, ob das Unbegrenzte und Unbestimmte als Accidens der Materie als einer von ihm verschiedenen Wesenheit anhaftet und in welchem Sinne es Accidens sein kann und ob die Privation ein Accidens der Materie ist. Wenn alles was Zahl und Proportion ist, außerhalb des Unbegrenzten steht – denn es ist Grenze und Ordnung, und die andern Dinge erhalten ihre Geordnetheit erst von ihm, sie werden nicht geordnet vom Geordneten sondern das Geordnete ist etwas anderes als das Ordnende, es ordnet sie vielmehr die Grenze die Bestimmung die Proportion –, dann muß notwendig das was geordnet und bestimmt wird, unbegrenzt sein. Geordnet aber wird die Materie, und das was nicht Materie ist, sofern es an ihr Teil hat oder ihre Stelle einnimmt. Folglich muß notwendig die Materie das Unbegrenzte sein. Nicht aber ist sie unbegrenzt im Sinne eines Accidens als hafte das Unbegrenzte ihr als Accidens an. Denn erstens muß das was Bestimmung von etwas ist, ein Begriff sein; das Unbegrenzte aber ist nicht Begriff. Zweitens, welcher Art soll das sein, dessen Bestimmung das Unbegrenzte wäre? Doch wohl Grenze und Begrenztes; aber die Materie ist nicht Begrenztes oder Grenze. Ferner, wenn das Unbegrenzte an das Begrenzte kommt, muß es dessen Wesen vernichten. Folglich ist das Unbegrenzte kein Prädikat der Materie. Die Materie ist also selbst das Unbegrenzte. Auch in der geistigen Welt ist ja die Materie das Unbegrenzte; es ist eine Hervorbringung aus der Grenzenlosigkeit des Einen, oder aus seiner Kraft oder seiner Ewigkeit, da es im Einen keine Grenzenlosigkeit gibt, sondern es sie nur schafft. Wie kann nun aber das Unbegrenzte dort oben und hier unten sein? Nun, auch das Unbegrenzte ist doppelt. Und wie unterscheiden sich beide? Wie Urbild und Abbild. So ist also das irdische Unbegrenzte in geringerem Grade unbegrenzt? Nein, in höherem; denn um so mehr es zum Abbild wurde, auf der Flucht vor dem Sein und dem Wahren, so viel mehr ist es unbegrenzt; denn die Unbegrenztheit ist in dem weniger Begrenzten mehr; das Weniger im Guten ist ein Mehr im Schlechten. In Bezug auf die Unbegrenztheit ist also das Obere mehr Abbild und das Irdische weniger, und um so viel es das Sein und das Wahre geflohen und in die Seinsform des Abbildes hinabgesunken ist, ist es in umso wahreren Sinne unbegrenzt. – Ist nun ‘das Unbegrenzte und das Unbegrenztsein’ dasselbe? Wo Form und Materie vorhanden ist, sind jene verschieden; wo aber Materie allein, da muß man sie entweder für identisch halten, oder, und besser, annehmen, daß es da überhaupt kein Unbegrenztsein gibt; denn das wäre ein begrifflich Geformtes und das kann es im Unbegrenzten nicht geben wenn es unbegrenzt sein soll. So ist also die Materie als von sich her unbegrenzt anzusehen vermöge ihres Gegensatzes zur begrifflichen Form; und so wie die Form Form ist ohne noch etwas anderes zu sein, so ist auch von der Materie, als welche der rationalen Form vermöge ihrer Unbestimmtheit entgegengesetzt ist, zu sagen daß sie, ohne etwas anderes zu sein, unbegrenzt ist.
[16]Ist die Materie nun auch identisch mit der Andersheit? Nein, sondern nur mit dem Teil der Andersheit welcher den im eigentlichen Sinn seienden Dingen, die ja rationale Formen sind, entgegengesetzt ist. Deshalb ist sie, obgleich nichtseiend, in diesem Sinne ein Etwas; mit der Privation ist sie identisch, wenn man Privation als Gegensatz gegen das in der Vernunft Seiende versteht. Wird nun die Privation aufgehoben wenn das hinzutritt von dem sie Privation ist? Keineswegs; denn das Aufnehmende für einen Zustand ist nicht ein Zustand sondern eine Privation, und für die Grenze nicht das Begrenzte und nicht die Grenze, sondern das Unbegrenzte sofern es unbegrenzt ist. Wie sollte also die hinzutretende Grenze die Seinsform des Unbegrenzten zerstören, besonders da es nicht akzidentiell unbegrenzt ist? Wenn es quantitativ unbegrenzt wäre, würde sie es aufheben; nun aber nicht, sondern sie erhält es im Gegenteil im Sein; denn sie führt seine Natur zur Verwirklichung und Vollendung, wie das Ungesäte wenn es gesät wird, und wie das Weibliche wenn es vom Männlichen empfängt (?), nicht sein Weiblichsein verliert sondern in höherem Grade weiblich wird, und das heißt, in höherem Grade wird was es ist.
Ist denn Materie noch ein Böses, da sie so am Guten Teil erhält? Ja, deshalb, weil sie des Guten bedurfte, denn sie hatte es ja nicht. Denn ein Wesen welchem ein Stück fehlt und ein anderes Stück hat es, das steht vielleicht in der Mitte zwischen Gut und Böse, wenn es ein gewisses Gleichgewicht nach beiden Seiten innehält; was aber nichts hat, das muß, da es in Armut ist, vielmehr da es Armut ist, notwendig böse sein. Denn dies ist nicht Armut an Hab und Gut, nein Armut an Besonnenheit, Armut an Tugend Schönheit Kraft Form Gestalt Wiebeschaffenheit. Wie sollte sie also nicht unansehnlich, nicht durchaus häßlich, nicht durchaus böse sein? Jene obere Materie aber ist seiend; denn vor ihr liegt was jenseits des Seienden ist; hier unten aber liegt vor der Materie das Seiende; sie ist also ihrerseits nicht seiend, da sie vom Seienden verschieden und ein Zusatz zu seiner Schönheit (?) ist.