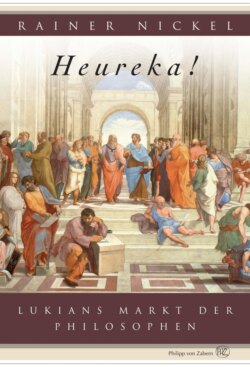Читать книгу Heureka! - Rainer Nickel - Страница 20
WIE LEBTEN DIE PYTHAGOREISCHEN LEHR MEINUNGEN FORT?
ОглавлениеDie Pythagoreer – unter ihnen vor allem Philolaos, der erster Pythagoreer, der etwas Schriftliches hinterließ – befassten sich seit dem 5. Jh. v. Chr. vor allem mit Mathematik und Astronomie. Sie vertraten die Auffassung, dass die Planeten bei ihren Kreisläufen Klänge erzeugten, die in der sogenannten Sphärenharmonie aufeinander abgestimmt seien. Schon für Pythagoras gab es keine Bewegung ohne Ton und keinen Ton ohne Bewegung.
Platon und Aristoteles haben das heutige Bild des Pythagoras entscheidend geprägt. Platon soll nach Unteritalien gereist sein, um sich dort alle pythagoreischen Lehren anzueignen (Cicero, Tuskulanische Gespräche 1, 39). In seiner Staatsschrift berichtet Cicero (De re publica 1, 16):
Platon reiste nach dem Tod des Sokrates zuerst nach Ägypten, um zu lernen, und später nach Italien und Sizilien, um die Entdeckungen des Pythagoras kennenzulernen, und dort war er oft mit Archytas von Tarent, dem engagierten Politiker und gelehrten Anhänger des Pythagoras, und mit dem Historiker Timaios von Lokroi zusammen und stieß auf die Schriften des Pythgoreers Philolaos. Weil zu dieser Zeit und in dieser Gegend der Name des Pythagoras große Bedeutung hatte, beschäftigte er sich sowohl mit den Pythagoreern selbst als auch mit deren Studien. Daher verknüpfte er, weil er Sokrates wie keinen anderen liebte und auf ihn alles zurückführen wollte, (in seinen Dialogen) die Anmut des Sokrates und den Scharfsinn seiner Gesprächsführung mit der Dunkelheit des Pythagoras und dem üblichen Ernst der meisten Wissenschaften.
Die berühmte pythagoreische These, dass die Zahl das Prinzip der seienden Dinge sei, überliefert Aristoteles (Metaphysik A und N). Stobaios (1, 21, 7b) berichtet, für den Pythagoreer Philolaos (um 400 v. Chr.) sei alles, was erkannt werde – und dazu gehörten auch Eigenschaften und Zustände –, durch Zahlen definiert. Denn es sei unmöglich, ohne Zahlen und Zahlenverhältnisse überhaupt etwas zu erkennen, zu verstehen und zu definieren. Wirklichkeit werde erst durch das Zähl- und Messbare beschreibbar:
Und tatsächlich hat alles, was erkannt wird, Zahl. Denn es ist unmöglich, dass wir ohne diese irgendetwas denken oder erkennen können.
Das heißt eben auch, dass nur diejenigen Dinge gedanklich erfasst werden, deren Struktur sich in Zahlen und Zahlenverhältnissen ausdrücken lässt.
Diese Einsicht, die auch Aristoteles (Metaphysik A 985b23–986a12) ausführlich referiert, drückt sich nicht zuletzt in der Zahlensymbolik der Pythagoreer aus: Die Elemente der Erkenntnis und des Seins sind in den ersten vier Zahlen der Zahlenreihe, der sogenannten Tetraktýs, enthalten: Die Eins bedeutet Anfang und Ursprung, aus der die gesamte Zahlenreihe hervorgeht. Die Zwei ist das Symbol der Verschiedenheit und der Nicht-Identität. Als Summe der Eins und der Zwei ist die Drei das Symbol der Synthese und der Ganzheit. Die Vier ist die Wurzel der Welt und das ursprüngliche Zeichen der Proportionalität (a:b = c:d). Die Bedeutung der Vier zeigt sich auch an den vier Jahreszeiten, den vier Elementen, den vier Säften des Körpers, und die Vier ist die erste Quadratzahl. Die Tetraktýs lässt sich grafisch mit Hilfe von zehn Zählsteinen als gleichseitiges Dreieck darstellen:
Die Zehn, der Hauptträger des Zahlensystems, ergibt sich aus der Addition der Zahlen 1, 2, 3 und 4. Die Sieben ergibt sich aus der Summe der Vier und der Drei . Sie entspricht nicht nur der heiligen Zahl des Orients, sondern ist auch der Kairos, der glückliche Augenblick.
Diogenes Laërtios (8, 1–50) sind viele anekdotische und legendäre Nachrichten zu verdanken. Der Neuplatoniker Porphyrios (vor 300 n. Chr.) schreibt über das Leben des Pythagoras. Iamblichos (um 300 n. Chr.) berichtet über die Pythagoreïsche Lebensform (De vita Pythagorica) . Es handelt sich hierbei nicht um eine Biografie, sondern um Werbung für die Vita Pythagorica . In dieser Schrift werden zahlreiche pythagoreische Lebens- und Verhaltensregeln (Symbola) wiedergegeben.
Beispiele:
Beim Anziehen der Schuhe beginne mit dem rechten Fuß, beim Waschen der Füße mit dem linken. Uriniere nicht in die Richtung der Sonne. Iss keine Bohnen. Betrachte dich nicht beim Schein einer Lampe im Spiegel.
Iamblichos (82) überliefert in diesem Zusammenhang auch eine Reihe von Sprüchen, die auf die Fragen „Was ist?“ und „Was ist am meisten?“ antworten:
Was ist das Weiseste? Die Zahl. Danach kommt das, was den Dingen ihre Namen gegeben hat. ... Was ist das Schönste? Die Harmonie. Was ist das Mächtigste? Die Einsicht.
Der römische Dichter Ovid (43 v. Chr.–17 n. Chr.) widmet Pythagoras in seinen Metamorphosen mehr als vierhundert Hexameter (15, 60–478). Er rühmt den Griechen als unermüdlichen Forscher, der alles, was die Natur dem menschlichen Blick entzieht, klar durchschaut. Er greift in den Metamorphosen den oben erwähnten pythagoreischen Kerngedanken auf und lässt Pythagoras das Verbot des Fleischgenusses in lateinischen Hexametern ausführlich begründen. Die Natur biete zahlreiche andere Nahrungsquellen. Es sei also gar nicht notwendig, dass ein beseeltes Wesen vom Mord an einem anderen beseelten Wesen lebe. In einer längst vergangenen goldenen Zeit sei man mit den Früchten der Erde zufrieden gewesen und habe seinen Mund nicht mit Blut besudelt.
Aber abgesehen von der Barbarei des Fleischgenusses nennt Ovids Pythagoras auch den wichtigsten Grund, der das Töten und Verzehren von Tieren grundsätzlich verbietet: Wenn der Körper vergeht, bleibt die Seele zwar vom Tod unberührt. Aber durch die Vernichtung des Körpers, wird sie gewaltsam aus ihrer Behausung vertrieben und muss sich eine neue Wohnung suchen.
Alles verändert sich nur und nichts geht zugrunde. Unser Geist wandert von hier nach dort und geht in alle möglichen Körper ein, gelangt aus einem tierischen in einen menschlichen und aus einem menschlichen in einen tierischen Leib ein und wird niemals vernichtet. ... Unsere Seele bleibt immer dieselbe. Aber sie wandert in unterschiedliche Körper. Daraus folgt: Damit ihr nicht eure mitmenschliche Verantwortung (pietas) der Gier des Bauches opfert, hört auf damit, verwandte Seelen durch schändlichen Mord aus ihren Behausungen zu vertreiben. Blut darf sich nicht von Blut ernähren (Ovid, Metam. 15, 165–175).
Ovid geht aber über die Pythagoreer, die nur behauptet hatten, dass die Seele von einem Körper in einen anderen übergehen kann, weit hinaus. Er glaubt nicht an ein individuelles Fortleben in einem anderen Körper, sondern an eine überindividuelle Unvergänglichkeit: Nichts geht zugrunde. Alles verändert sich nur. Im unendlichen Prozess der Verwandlung bleibt der überindividuelle Wesenskern des verwandelten Wesens in seiner neuen Gestalt erhalten. Das ist das zentrale Thema der Metamorphosen. Der Verwandelte behält in seiner neuen Gestalt zwar seinen Charakter in verstärkter Ausprägung, nicht aber seine individuelle Seele. Er erkennt sich in seiner neuen Gestalt nicht mehr als Subjekt.
Im 2. Jh. n. Chr. entsteht das Carmen aureum, das Goldene Lied, ein pythagoreisches Lehrgedicht in 71 Hexametern mit Mahnungen zur Frömmigkeit, Mäßigung und Selbstprüfung. Im 5. Jh. wird der Text von Hierokles aus Alexandria kommentiert. Im Mittelalter und in der Renaissance finden das Gedicht und sein Kommentar großen Anklang.