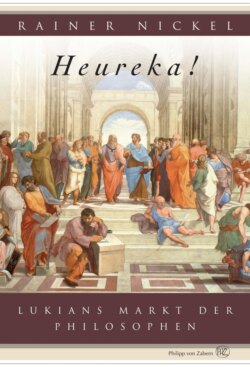Читать книгу Heureka! - Rainer Nickel - Страница 9
PHILOSOPHISCHE EPOCHEN
ОглавлениеBevor man mit den Philosophen weiter ins Gespräch kommt, ist es zweckmäßig, sich einen kurzen Überblick über die Epochen der älteren griechischen Philosophiegeschichte zu verschaffen:
Die vorklassische Epoche der sogenannten Vorsokratiker (600–430 v. Chr.) ist geprägt von Thales, Anaximander, Pythagoras, Xenophanes, Parmenides, Heraklit, Empedokles und Anaxagoras, dem Freund des Perikles, und von Demokrits Atomlehre und den Sophisten Protagoras, Gorgias oder Prodikos. Die Vorsokratiker lassen sich als die großen Anreger des philosophischen Denkens charakterisieren.
Die Philosophie der klassischen Zeit (450–350 v. Chr.) ist Sokrates, Platon und Aristoteles zu verdanken.
In der nachklassischen Epoche, spielen die Nachfolger der Klassiker die führende Rolle. Zu ihnen gehören nicht nur die Peripatetiker, unter denen Theophrast hervorragt, die Akademiker, die durch den Skeptiker Karneades berühmt wurden, und die Stoiker, unter denen Chrysipp, Panaitios, Poseidonios oder Epiktet und Mark Aurel hervorragten (vom 3. Jh. v. Chr. bis weit in die christliche Zeit). Besondere Beachtung verdienen auch die philosophischen Bewegungen des Kynismus mit Antisthenes und Diogenes und der von Epikur begründete Epikureismus.
In der spätantiken Epoche (vom 3. bis zum 6. nachchristlichen Jh.) steht der Neuplatonismus im Mittelpunkt. Maßgebend sind hier Plotin (geb. 205 n. Chr.) sowie seine Schüler und Nachfolger Porphyrios, Iamblich, Proklos und Simplikios.
Dann aber verfügt der christlich-römische Kaiser Justinian im Jahr 529 n. Chr., dass niemand mehr in Athen Philosophie lehren dürfe. Die Platonische Akademie wird endgültig geschlossen, und nach der Eroberung Alexandrias durch die Araber im Jahre 642 verlieren sich auch die letzten Spuren eines von antiker Philosophie geprägten Denkens.
Diese Epochen sind zwar nicht scharf voneinander abzugrenzen, unterscheiden sich aber durch die Fragen, die vorrangig gestellt und diskutiert werden:
Die Vorsokratiker befassen sich vor allem mit dem Wesen und dem Werden der Welt und weniger mit dem Menschen. Sie fragen nach vernünftigen Gründen, weil ihnen die Erklärungsmuster mythologischer Erzählungen über die Herkunft des Seins nicht mehr ausreichen. Als individualistische und selbstbewusste Denker – einige sind zugleich Dichter und Theologen – entwickeln sie unterschiedliche Erklärungsmuster, sodass sie sich in einer oft recht scharfen und polemisch aufgeheizten Konkurrenzsituation befinden, in der sie zugleich angreifen und angegriffen werden.
Der Gegenstand ihres Forschens ist die Vielfalt der Natur (phýsis) in ihrem Werden und Vergehen, ihrer Bewegung und ihrem Wandel. Im Zentrum ihres Interesses steht zwar die Frage nach dem Woher, d. h. nach dem Ursprung und Anfang der Welt. Aber ebenso wichtig ist ihnen die Suche nach dem Gemeinsamen, Stabilen und Unvergänglichen in oder hinter der sinnlich wahrnehmbaren Welt. Xenophanes und Parmenides wollen vor allem den Unterschied zwischen Sein und Werden, Sein und Nicht-Sein klären. Heraklit stellt die Frage nach der Entstehung und dem Wesen des Kosmos, der periodisch entstehe und wieder vergehe: Es gebe nichts Bleibendes. Alles sei im Fluss und unablässigerer Veränderung ausgesetzt, werde aber von einer höchsten Vernunft (Logos) gelenkt. Empedokles glaubt, im Weltgeschehen wirkten gegensätzliche Urkräfte (Liebe und Hass). Pythagoras fragt nach den Gesetzen, die den Dingen zugrunde liegen und nach denen diese in Erscheinung treten. Für Thales ist das Wasser der Urstoff der Welt, und Anaximander sieht in einem rätselhaften Unbegrenzten den Anfang. Demokrit glaubt, in den Atomen die kleinsten Bausteine der Welt gefunden zu haben. Sie existieren im leeren Raum, in dem sie sich zu den unterschiedlichsten Formen zusammenballen. Seit Anaxagoras befindet sich der Geist als ein von der Materie unabhängiges, aber alles bewegendes Prinzip im Gesichtskreis der Philosophie.
Die Sophisten, die Experten für Wissen und Weisheit, Sprachgewalt und Öffentlichkeitswirkung, erkannten, dass in ihrer Zeit ein öffentliches Bedürfnis nach Bildung bestand. So hatte auch Perikles, der maßgebende Politiker des 5. Jh.s, die athenische Demokratie mit den Worten charakterisiert:
Wir lieben das Schöne, ohne Verschwendung zu betreiben. Wir lieben Bildung und Wissen ohne Weichlichkeit (Thukydides 2, 40, 1).
Hier definiert Perikles das Interesse an Bildung und Wissen als Philosophie. Man philosophiert aber nicht in der einsamen Denkerklause, sondern begeistert sich an Vorträgen über vielfältige Themen. Diese Marktlücke füllen die Sophisten, indem sie mit dem Anspruch auftreten, die Tugend, die geistige Virtuosität und Schlagkraft, als Voraussetzung für ein gutes Leben zu lehren, das vor allem darin besteht, überlegen zu sein und Erfolg zu haben. Die Philosophie, die die Sophisten propagieren, besteht in einem gekonnten Umgang mit der Sprache, im brillanten Formulieren und scharfsinnigen Argumentieren und in der Fähigkeit, den Anspruch auf politische und gesellschaftliche Führung durchzusetzen, und weniger in der ernsthaften Suche nach der Wahrheit.
Auch Sokrates interessiert sich nicht mehr für die Welt, die den Menschen umgibt, sondern wie die Sophisten für den Menschen selbst. Er sucht nach den Voraussetzungen und Bedingungen des guten Lebens, das von der besonderen Tauglichkeit des Menschen getragen ist. Diese besteht aber nicht in äußerer Machtentfaltung, sondern in einem rational begründeten Handeln, das sich in der Gerechtigkeit verwirklicht. Sokrates ist der maßgebende Impulsgeber und die Identifikationsfigur aller philosophischen Schulen und Bewegungen nach ihm. Er ist der bis heute am meisten zitierte Philosoph der Antike.