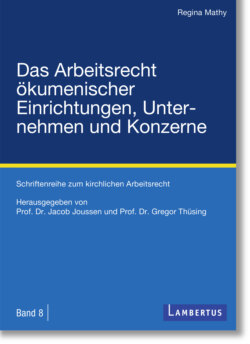Читать книгу Das Arbeitsrecht ökumenischer Einrichtungen, Unternehmen und Konzerne - Regina Mathy - Страница 90
2. Erst-recht-Schluss
ОглавлениеEinzig Thüsing unternimmt den Versuch, die Einbeziehung ökumenischer Einrichtungen in das Selbstbestimmungsrecht argumentativ zu untermauern.521 Dabei knüpft er zunächst an das bereits erörterte Verständnis der Religionsgemeinschaft an. Im Zusammenhang mit der Gewährleistung des Art. 137 Abs. 2 S. 2 WRV wonach der Zusammenschluss von Religionsgesellschaften keinen Beschränkungen unterliegt, war für die WRV anerkannt, dass sich verwandte, jedoch bekenntnisverschiedene Religionsgesellschaften zusammenschließen konnten ohne die verfassungsrechtliche Privilegierung zu verlieren.522 Nach Thüsings Ansicht könne man hierin ein „(…) Tendenzargument für die staatskirchenrechtliche Privilegierung auch der ökumenischen Einrichtungen“ sehen.523 Können Religionsgemeinschaften bereits verschiedene Bekenntnisse in sich vereinen, dürfe ein Zusammenwirken nicht zum Verlust der religionsverfassungsrechtlichen Privilegierung führen.
Thüsing geht in seiner Argumentation jedoch noch weiter, indem er den den Kirchen eingeräumten Freiheitsraum zur Ordnung und Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten näher betrachtet.524 Zu Recht weist er darauf hin, dass eine ökumenische Zusammenarbeit von beiden Konfessionen als gemeinsamer Auftrag angesehen wird. An den die Religionsgemeinschaften auszeichnenden Besonderheiten ändere sich auch durch ein Zusammenwirken zweier oder mehrerer Religionsgemeinschaften nichts, wenn sie gemeinsam eine Einrichtung mit einem spezifisch kirchlichen Zweck betrieben.525 Insofern sei es nur konsequent, dass sie auch gemeinsam von der verfassungsrechtlichen Gewährleistung profitieren könnten.526 Zum anderen, so wendet Thüsing zutreffend ein, ist bei einem Zusammenwirken mehrerer Religionsgemeinschaften das Interesse des Staates nicht größer als bei einer lediglich einer Religionsgemeinschaft zugeordneten Einrichtung.527 Insofern spricht er sich explizit für die religionsverfassungsrechtliche Zulässigkeit aus: „Wenn zwei Gemeinschaften ein Freiraum eingeräumt wird, den sie nach eigenen Vorstellungen ausfüllen können – eben dies macht Autonomie aus –, dann kann dieser Freiraum nicht dadurch gemindert werden, dass sie ihn gemeinsam ausüben.“528 Zwar dürfe das Maß der Freistellung durch ein Zusammenwirken nicht erweitert, umgekehrt aber auch nicht eingeschränkt werden.529
Dem ist zuzustimmen: Aufgrund der Reichweite des Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV wird man nicht bezweifeln können, dass ökumenische Bestrebungen einer jeden Kirche für sich grundsätzlich Teil ihrer Wesens- und Lebensäußerung sein können. Hierdurch sind jedenfalls Kooperationen ohne gemeinsame Rechtsträgerschaft vom Selbstbestimmungsrecht gedeckt. Schließlich handelt jede Kirche weiterhin für sich, jedoch für ein etwaiges gemeinsames Projekt. Die Frage ist, inwieweit sich an dieser Situation durch eine institutionelle Verbindung etwas ändert. Beide Kirchen sind dann beispielsweise über einen gemeinsamen Rechtsträger an einer Einrichtung beteiligt. Das Selbstbestimmungsrecht nur aufgrund eines gemeinsamen institutionalisierten Handelns einzuschränken, ist nicht sachlogisch. Solange jede Religionsgemeinschaft für sich ihr Handeln mit ihrer Glaubensvorstellung vereinbaren kann, kann ein Zusammenwirken – auch innerhalb eines Rechtsträgers – hieran nichts ändern. Insofern ist Thüsing zuzustimmen, wenn schon eine Kooperation der Religionsgemeinschaften ohne Weiteres möglich ist, muss dies konsequenterweise auch für eine institutionelle Verbindung gelten.530