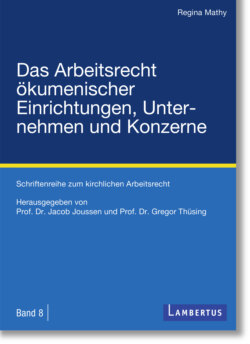Читать книгу Das Arbeitsrecht ökumenischer Einrichtungen, Unternehmen und Konzerne - Regina Mathy - Страница 92
4. Ein Blick auf § 118 Abs. 2 BetrVG
ОглавлениеDer Begriff Religionsgemeinschaft in § 118 Abs. 2 BetrVG wird ebenso verstanden wie der der Religionsgesellschaft in Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV. Das BetrVG findet gemäß § 118 Abs. 2 BetrVG als Ausprägung des verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungsrechts nicht auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen Anwendung. Der Wortlaut der Norm bezieht sich auf „ihre“ Einrichtungen. Nach teilweise vertretener Auffassung fallen hierunter nicht ökumenische Einrichtungen, die keiner verfassten Kirche institutionell zuzuordnen sind.542 Eberle führt dies auf die Entstehungsgeschichte des § 118 Abs. 2 BetrVG zurück. Bei der Konzeption des Gesetzes spielte es zwar eine Rolle, dass die Kirchen eine Autonomie gegenüber dem Betriebsverfassungsrecht genießen sollten543, nicht jedoch die Förderung der Ökumene.544 Zudem würde § 118 Abs. 2 BetrVG auch aus teleologischer Sicht lediglich den Normgehalt des Art. 137 Abs. 3 WRV vollziehen und nicht die Förderung der Ökumene bezwecken.545 Trotz der bestehenden ökumenischen Annäherung gebe es nach wie vor weder ein ökumenisches Bekenntnis noch umfassende ökumenische Kultformen. Insofern könne bei ökumenischen Einrichtungen die erforderliche institutionelle Verknüpfung546 nicht bejaht werden. Eine überkonfessionell-ökumenische Einrichtung genieße nur den einfachen Tendenzschutz nach § 118 Abs. 1 BetrVG, der unmittelbar aus Art. 4 Abs. 2 GG hergeleitet würde.547
Thüsing entnimmt dem Wortlaut des § 118 Abs. 2 BetrVG hingegen keine Einschränkung dahingehend, dass die Einrichtung von einer Kirche allein getragen werden muss.548 Er argumentiert in diesem Zusammenhang mit dem gemeinsamen Betrieb549 i.S.d. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG550: Betreiben zwei Religionsgemeinschaften zusammen einen gemeinsamen Betrieb, wäre es sachfremd anzunehmen, dieser fiele unter das BetrVG. Die Mitarbeiter agieren gemeinsam innerhalb eines organisatorischen Gebildes. Ihre Arbeitsverhältnisse bestehen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft fort. Die gemeinsame Organisation ändere nichts daran, dass für die Arbeitnehmer die spezifischen Loyalitätspflichten des jeweiligen Arbeitgebers gelten.551 Auf sie finden die jeweils in Bezug genommenen Arbeitsrechtsregelungen ihres Vertragsarbeitgebers Anwendung. Dieser Auffassung ist zuzustimmen. Eine ökumenische Rechtsträgerschaft unterscheidet sich hiervon nicht grundlegend. Zwar bestehen die Arbeitsverhältnisse nicht unmittelbar zwischen den Mitarbeitern der Einrichtung und der jeweiligen Kirche – wie es in einem gemeinsamen Betrieb der Fall ist – allerdings sind beide Kirchen an dem gemeinsamen Anstellungsträger beteiligt. Die Wahl der rechtlichen Ausgestaltung einer Zusammenarbeit kann nicht zum Verlust der verfassungsrechtlichen Privilegierung führen.552 Das gilt insbesondere, da die Rechtsformwahl gerade Teil des Selbstbestimmungsrechts ist. Andernfalls würde der Staat die Kirchen mittelbar dazu zwingen, eine Zusammenarbeit lediglich in Form eines gemeinsamen Betriebs zu organisieren. Konsequenz wäre: In einem gemeinsamen Betrieb würde kirchliches Arbeitsrecht ohne jede Einschränkung gelten, wohingegen ein gemeinsamer Rechtsträger weltliches Arbeitsrecht – allenfalls mit Tendenzschutz – anwenden müsste. Können sich die am ökumenischen Rechtsträger beteiligten Kirchen jeweils auf das Selbstbestimmungsrecht berufen und ist die Einrichtung ihnen zuzuordnen, muss konsequenterweise auch die ökumenische Einrichtung vom Anwendungsbereich des BetrVG ausgenommen sein.