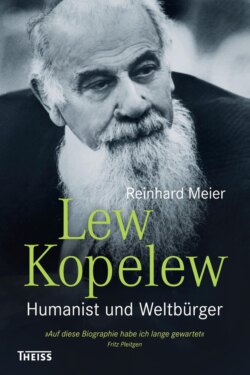Читать книгу Lew Kopelew - Reinhard Meier - Страница 13
Ukrainische, russische und deutsche „Bonnen“
ОглавлениеLew und sein Bruder Sanja sind neben dem engeren Familienkreis und seinem jüdisch-russisch geprägten Traditionshintergrund schon in ihrer frühesten Kindheit durch ihre Kinderfrauen oder Njanjas von Geschichten, Erfahrungen und Symbolen der christlich-orthodoxen und christlich-lutheranischen Kultur beeinflusst worden. Die erste Njanja, die die beiden Kinder noch im Dorf Borodjanka betreut hatte, hieß Chima. Kopelew schreibt, er habe sie mehr als alle anderen Kinderfrauen geliebt.19 Sie sprach ukrainisch und Lew lernte von ihr viele ukrainische Lieder, die er bis zu seinem Lebensende nie vergessen hat.
Nach dem Umzug der Familie nach Kiew im Jahr 1917 kamen Lew und Sanja in die Obhut der russischen Kinderfrau Polina Maximowna – von der Mutter „Bonne“ genannt, was in ihren Augen offenbar vornehmer als „Njanja“ klingen sollte. Polina liebte den Zaren und sie war eine tief religiöse russisch-orthodoxe Gläubige. Lew betete mit ihr morgens und abends kniend im Bett zum orthodoxen Gott, das Vaterunser konnte er bald auswendig. „Wir beteten heimlich, die Eltern durften es nicht wissen“, schreibt Kopelew in seinen Erinnerungen. Die russische Njanja erzählte den Kindern auch unter dem Siegel der Verschwiegenheit, dass die Eltern „einen schlimmen, den ‚jiddischen‘ Glauben hätten – ich aber könne, wenn ich erwachsen sei, mich taufen lassen und auch rechtgläubig werden und in den Himmel kommen.“20
Ende 1918 verließ die Kinderfrau Polina Maximowna die Familie – offenbar hatte die Mutter ihre christlich-orthodoxen Beeinflussungen bemerkt. Die guten Beziehungen zu ihr seien aber bestehen geblieben, schreibt Kopelew, denn die russische Njanja blieb im gleichen Haus bei ihrer Schwester, der Kassiererin im Cinematographen.
Die nächsten Kindermädchen oder Bonnen waren deutschsprachige „Fräuleins“. Die Erste hieß Jelena Franzewna, sie war hochgewachsen, hatte ein schmales Gesicht und betete nicht wie ihre Vorgängerin zu Ikonen. Sie las aber den Kindern gelegentlich aus einer kleinen Bibel vor – offenbar eine lutherische, denn bei Jelena Franzewna musste man sich nicht bekreuzigen. Auch sie sprach von Christus, erklärte aber, dass dieser und seine Jünger auch Juden waren – „gute wie wir, gekreuzigt hatten ihn andere, böse, solche wie Trotzki und die Bolschewiki, die ebenfalls gegen Christus waren“.21
Jelena Franzewna blieb bis 1920. In den drei folgenden Jahren lösten mehrere deutsche Kindermädchen einander ab, laut Kopelews Bericht mehrheitlich ältere Damen. Er wisse nicht mehr, was jede dieser „Fräuleins“ ihn und seinen Bruder gelehrt hätten, schreibt er weiter, „aber im Endergebnis schnatterten Sanja und ich fröhlich deutsch, konnten es auch lesen und schreiben.“ Und Lew war damals als Zehnjähriger „fest überzeugt, die Deutschen seien das kultivierteste Volk der Welt, außerdem die besten Freunde Russlands und die deutsche Monarchie die gerechteste aller Regierungen gewesen.“22
Diese frühe Vertrautheit mit der deutschen Sprache und Kultur wurde vertieft durch vielfältige, begeisterte Lektüre deutschsprachiger Bücher. Diese liehen Lew und sein Bruder sich in der Gemeindebücherei im evangelischen Pfarrhaus in Kiew aus. Solche deutschsprachig-religiösen Einrichtungen wurden Anfang der 20er-Jahre vom kommunistischen Regime bemerkenswerterweise noch toleriert. In späteren sowjetischen Jahren war das gewiss nicht mehr der Fall. Lew war damals schwer beeindruckt von den Abenteuerromanen Karl Mays, in denen „edle Deutsche Heldentaten in den verschiedensten Ländern der Welt vollbrachten“.23 Auch Bücher über den „Alten Fritz“, den Preußenkönig Friedrich den Großen, fesselten seine Fantasie.
Den Sommer 1921 wie auch 1922 verbrachte die Familie Kopelew auf dem Lande in der sogenannten „Maierschen Gärtnerei“, in der Lews Vater als Agronom angestellt war. Diese ehemalige private Gärtnerei war jetzt ein staatlich gelenkter Sowchos, der dem Städtischen Wirtschaftsausschuss unterstand. Geführt wurde der Sowchos vom Direktor Karl Maier, einem Deutschen, dessen Familie vor der Revolution die Gärtnerei offenbar gehört hatte und der dort nun die Funktion eines Direktors ausübte. Maiers zahlreiche Familie arbeitete mit in dem Betrieb, in ihrem Umkreis wurde offenbar hauptsächlich Deutsch gesprochen. Lew war besonders beeindruckt von Maiers Schwiegersohn, den er „Onkel Hans“ nannte. Die ältere Tochter dieses Onkels, Lilli, war gleich alt wie der damals neun- oder zehnjährige Lew – und sie war das erste Mädchen, in das er sich, wie er schreibt, „richtig“ verliebte.24