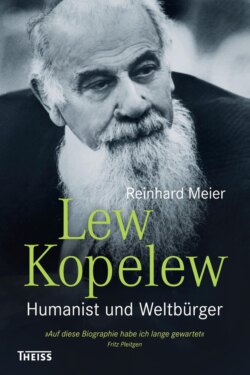Читать книгу Lew Kopelew - Reinhard Meier - Страница 8
Auftakt – Erste Begegnung mit Lew Kopelew
(1974)
ОглавлениеLew Kopelew bin ich zum ersten Mal im Herbst 1974 in Moskau begegnet. Es war an einer Abendeinladung beim Korrespondenten der „Welt“, Ernst-Ulrich Fromm, Nachbar und Kollege im sogenannten Ausländerghetto am Kutusowski-Prospekt.
Die meisten Gäste waren andere Ausländer, vorwiegend Deutsche aus der damaligen Bundesrepublik. Ich war mit meiner Frau und unserer kleinen Tochter erst vor wenigen Monaten als NZZ-Korrespondent nach Moskau gekommen. Gegen Ende des Essens kommt ein hochgewachsener Russe mit weißem Bart hinzu, zusammen mit seiner Frau. Jemand flüstert mir zu: Das ist Lew Kopelew, das Vorbild für Lew Rubin in Solschenizyns „Der erste Kreis der Hölle“.
Ich war elektrisiert. Solschenizyns Roman über das Leben in der Scharaschka, einem Sonderlager im Archipel Gulag, hatte ich einige Jahre zuvor am Ende meines Universitätsstudiums gelesen und es hatte mich tief beeindruckt – nicht zuletzt wegen der Figur des temperamentvollen Idealisten und überzeugten Kommunisten Rubin, einem russischen Germanisten und profunden Kenner des deutschen Geisteslebens.
Mit Lew Kopelew kam ich an jenem Abend schnell ins Gespräch. Er sprach ausgezeichnet Deutsch und interessierte sich lebhaft für die Schweiz und was dort gerade für Diskussionen im Gange seien. Insbesondere wollte er Neuigkeiten über Max Frisch erfahren, mit dem er seit einigen Jahren befreundet sei. Ich berichtete, dass vor Kurzem ein neues Buch von Frisch erschienen sei – „Dienstbüchlein“, eine kritisch-ironische Auseinandersetzung mit der Schweizer Armee. Und soeben sei in der NZZ eine scharfe Kritik dieses Buches erschienen, der Titel des Verrisses: „Die Kunst der Insinuation“.
Kopelew war spontan interessiert. Er wollte unbedingt, dass ich ihm diesen Artikel verschaffe. Nach der Lektüre meldete er sich sofort wieder und erklärte, er habe eine Replik auf diesen bösen Angriff gegen seinen Freund Max Frisch geschrieben – ob ich nicht für deren Publikation in der NZZ sorgen könne? Ich hatte als frisch gebackener NZZ-Korrespondent wenig Ahnung, ob sich das machen ließe. Außerdem war Kopelews Name damals im Westen praktisch noch unbekannt – und verlässliche Auskünfte zu seiner Person konnte ich der Redaktion zu jenem Zeitpunkt nicht liefern.
Dennoch schickte ich Kopelews Manuskript via die damals üblichen inoffiziellen Kanäle an die Feuilletonredaktion in Zürich. Der deutsche Text war mit Schreibmaschine geschrieben, ergänzt durch schwungvolle handschriftliche Zusätze – und er war, soweit ich mich erinnere, beängstigend lang.1 Von der NZZ-Feuilleton-Redaktion kam bald der abschlägige Bescheid, der damalige Chefredakteur Fred Luchsinger wolle den Kopelew-Text nicht veröffentlichen um die Auseinandersetzung um das „Dienstbüchlein“ nicht noch weiter aufzuheizen.
Lew Kopelew nahm, großzügig wie er war, die Ablehnung nicht krumm – jedenfalls hat er mir gegenüber dazu nie ein kritisches Wort fallen lassen. Später, als die Kopelews in Deutschland im Exil lebten, war er ein eifriger NZZ-Leser. Und als Fred Luchsinger in den 80er-Jahren einmal nach Bonn zu Besuch kam, wo ich inzwischen als Korrespondent tätig war, fuhr ich mit ihm auch zu den Kopelews in die Neuenhöfer Allee in Köln, wo sich bei russischem Tee eine angeregte Unterhaltung mit dem NZZ-Chefredakteur entspann.
Jene erste Begegnung in Moskau im Herbst 1974 mit Lew Kopelew und seiner Frau Raissa war der Auftakt zu einer langjährigen Freundschaft zwischen unseren Familien. Während unseres fünfjährigen Aufenthalts in Moskau wurde der Kontakt zunehmend enger. Dann, als die Kopelews im unfreiwilligen Exil Deutschland lebten und wir in Bonn wohnten, haben wir uns noch häufiger getroffen, mehrmals auch in der Schweiz. Später zogen wir nach Washington weiter, aber auch in jenen Jahren ist die Beziehung nie ganz abgebrochen – bis zu Lew Kopelews Tod im Jahre 1997.
Lew Kopelew war eine inspirierende, warmherzige Persönlichkeit von enzyklopädischem Wissen und unerschöpflicher Neugier. Der Bremer Osteuropahistoriker Wolfgang Eichwede hat sein Leben eine „Jahrhundertbiographie“ genannt. Sie ist tief durchdrungen sowohl von den großen Katastrophen wie auch den glücklichen Wendungen, die sich im 20. Jahrhundert in Russland und in Mitteleuropa abgespielt haben.
Aufgewachsen in einer längst versunkenen Welt des jüdischen Mittelstandes in Kiew wurde Kopelew durch deutsche Kindermädchen früh mit der deutschen Sprache vertraut. Er erlebte das Chaos des Bürgerkrieges nach dem Sturz des Zaren, wurde in Charkow (heute Charkiw) begeisterter Jungkommunist, beteiligte sich an der stalinistischen Zwangskollektivierung ukrainischer Bauern (Kulaken), die Millionen von Menschen in den Hungertod trieb. Als Propagandaoffizier der Roten Armee kämpfte er gegen Hitlers Wehrmacht. Wegen angeblichen Verrats und „Mitleid mit dem Feind“ verbrachte er fast zehn Jahre in Stalins Gulag. In der Scharaschka, einem Spezialgefängnis für Wissenschaftler und Intellektuelle, wurde er ein enger Freund von Solschenizyn.
Nach dem Tod Stalins glaubte Kopelew während des „Tauwetters“ an eine Erneuerung der „leninistischen Ideale“ – bis zur Niederschlagung des „Prager Frühlings“ 1968. Schon zuvor hatte eine tiefe Freundschaft mit dem deutschen Schriftsteller Heinrich Böll begonnen. Angesichts der verhärteten Repression des Breschnew-Regimes gegen „Andersdenkende“ entschlossen sich Kopelew und seine Frau Raissa, einen Studienaufenthalt in Deutschland zu beantragen. Dieser wurde dank der Fürsprache Bölls und anderer Persönlichkeiten schließlich 1980 bewilligt. Kurz nach der Ausreise ist ihnen die sowjetische Staatsbürgerschaft entzogen worden.
Deutschland wurde Kopelew schnell eine Art zweite Heimat. Er entfaltete eine fruchtbare Tätigkeit zur Vertiefung der gegenseitigen Kenntnisse zwischen Russen und Deutschen. In Deutschland erlebte er den epochalen Fall der Berliner Mauer und die Auflösung des Sowjetimperiums.
Seit seinem Tod 1997 sind zwei Jahrzehnte vergangen. Durch die Erzählung eines weit gespannten Lebensweges mit seinen Irrungen und Umkehrungen können uns vergangene Zeitabschnitte und ihre Lehren oft eindringlicher berühren als durch abstrakte historische Abhandlungen. Unsere Gegenwart wird untergründig immer auch von geschichtlichen Vorgängen beeinflusst. Die neuen Konfrontationen um die Ukraine – Kopelews ursprüngliche Heimat – und ihre Zugehörigkeit sind ein hochaktuelles Beispiel solcher Verschränkungen.
Die russische Dichterin Anna Achmatowa hat die unterschwelligen Verbindungen zwischen den Epochen so formuliert: „In der Zukunft glüht die Vergangenheit. In der Vergangenheit reift die Zukunft.“ Lew Kopelew zitiert diese Einsicht im zweiten Band seiner autobiografischen Trilogie als eine Leitlinie seiner Rechenschaftslegung über die eigenen stalinistischen Irrwege.2
Ein wesentliches Thema dieser Biografie ist das komplexe Verhältnis zwischen Kopelew und Solschenizyn, dem berühmtesten und in verschiedener Hinsicht einflussreichsten russischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Die fast brüderliche Freundschaft zwischen den beiden ungleichen Persönlichkeiten während der gemeinsamen Häftlingsjahre auf der Gulag-„Insel“ Scharaschka ist später, als beide im westlichen Exil lebten, endgültig zerbrochen. Die Geschichte dieser am Ende unüberbrückbaren Entfremdung spiegelt in exemplarischer Weise den alten innerrussischen Konflikt zwischen Westlern und Slawophilen wider. Dieser Konflikt hat auch im heutigen Russland seine Virulenz nicht verloren.
Die ergiebigsten Quellen für diese Biografie waren für mich die eigenen autobiografischen Aufzeichnungen von Lew und Raissa Kopelew. Sie bieten eine überwältigende Fülle von Informationen und Überlegungen zu einzelnen Abschnitten ihres bewegten Lebens. Mir ging es mit diesem Buch darum, diese Ausschnitte mit Archiv-Materialien, Zeugenerinnerungen, eigenen Erfahrungen und Forschungsergebnissen zu einem umfassenden Lebensbild zusammenzufügen. Doch es bleibt mir bewusst, dass damit noch längst nicht sämtliche Facetten von Kopelews lebenspraller Biografie berücksichtigt und bei Weitem nicht alle Zeugnisse aus seinem immensen Nachlass ausgeschöpft sind.