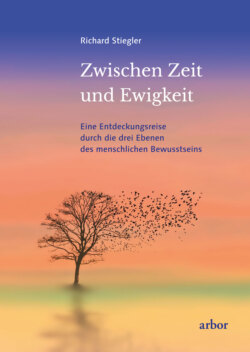Читать книгу Zwischen Zeit und Ewigkeit - Richard Stiegler - Страница 11
Bewusstseinszustände und ihre Wirkung
ОглавлениеIm Laufe eines ganz gewöhnlichen Tages durchlaufen wir unzählige Male verschiedene Bewusstseinszustände, ohne uns dessen in der Regel bewusst zu sein. Wir wundern uns vielleicht darüber, dass uns eine Zeit lang ängstliche Gefühle und eine körperliche Anspannung beschäftigen, die dann plötzlich, nachdem wir unsere professionelle Rolle übergestreift haben, wie weggeblasen sind. Jetzt spüren wir eine innere Sicherheit und fragen uns: Wo kamen diese Gefühle der Unsicherheit her? Und wo gingen sie hin?
Oder wir genießen immer wieder Momente von unbedingter Präsenz, in denen alles Tun und alles Wollen verstummt und sich eine innere Freiheit ausbreitet. Vielleicht sehnen wir uns danach, diese Momente auszudehnen und unser ganzes Leben in dieser Freiheit führen zu können. Doch schwups – kaum haben wir diese Freiheit geschmeckt –, schon ist sie wieder im Strudel von Gedanken und Alltagshandlungen untergegangen. Im Kontext von Familie und Beruf haben wir meist nicht das Gefühl, dass wir uns in einem Raum jenseits von Zeit und Tun bewegen, sondern empfinden deutlich Zeit- und Handlungsdruck. Wo ist diese Freiheit hin? Ist sie auch da, wenn wir sie nicht spüren? Was hilft es uns, zu wissen, dass sie da ist, wenn wir dazu keinen Zugang haben?
Manchmal reicht unsere Bewusstheit so weit, dass wir diese Vorgänge beobachten können. Verschiedenste Zustände in unserem Geist wechseln sich ab, und wir haben kaum eine Möglichkeit, diese zu beeinflussen, geschweige denn zu kontrollieren. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sogar zugeben, dass wir diese Vorgänge in unserem Geist nicht mal verstehen. Wieso gibt es morgens ein Gefühl der Ängstlichkeit in mir? Wie kann ich gleichzeitig in meinem Job ein kompetenter Profi sein, der sich seiner selbst sicher ist? Wieso kann ich nicht immer in der absoluten Freiheit des SEINS verweilen?
Vielleicht schleichen sich mit diesen Fragen auch Selbstzweifel ein: Ist meine Meditationspraxis tief genug? Ist mein Gefühl der Sicherheit im Job nur aufgesetzt? Sind die Gefühle der Ängstlichkeit nicht meine wahrhaftigen Gefühle und soll ich ihnen mehr Raum geben? Oder sind sie nur ein altes Gefühlsmuster, dem ich besser keine Aufmerksamkeit mehr schenke? Ist nicht das Freiheitsgefühl in der Meditation mein wahrhaftiges Sein? Oder verdränge ich hier nur meine Gefühle?
Selbstzweifel helfen uns beim Vorgang der Selbsterkenntnis meist nicht weiter, sondern verunsichern uns nur. Daher ist es hilfreicher, den Fragen und unserer Unwissenheit standzuhalten und unsere Bewusstheit dazu zu nutzen, tiefer und tiefer die Vorgänge in unserem Geist an einem ganz normalen Tag zu studieren. Dabei werden wir feststellen, wie häufig und fast unmerklich sich die Zustände ändern und regelrecht ineinandergreifen.
Jedes Mal, wenn ein bestimmter Zustand im Vordergrund unseres Erlebens unsere Aufmerksamkeit fesselt, verschwindet das, was uns kurz zuvor noch beschäftigt hat, aus dem Bewusstsein. Dabei ist dies kein rein gedanklicher Vorgang, auch wenn daran oft Gedanken beteiligt sind. Nein, der jeweilige Bewusstseinszustand, in den wir eintauchen, ist ein körperlich-seelisches Gesamterleben, das wie eine Wolkenstimmung am Himmel die gesamte Atmosphäre einer Szenerie einfärbt. Genauso verändert der aktuelle Zustand unser augenblickliches Dasein in einer Weise, dass er unser Lebensgefühl bestimmt.
An dieser Stelle ist es höchste Zeit, auf den Begriff »Bewusstseinszustand« näher einzugehen. Bewusstseinszustände sind der Schlüssel zum Verständnis der Vorgänge in unserem Geist. Nur wenn wir begreifen, was Bewusstseinszustände sind und welche Wirkung sie entfalten, werden sich manche paradoxe Verhaltensweisen von Menschen und manche Fragen, die sich daraus ergeben, von selbst beantworten.
Um uns dem Begriff »Bewusstseinszustand« anzunähern, ist es hilfreich, sich zunächst ungewöhnliche Geisteszustände vor Augen zu führen und diese mit »normalem Alltagserleben« zu vergleichen. Betrachten wir zum Beispiel einen Menschen, der sich durch einen Autounfall im Schock befindet, dann sehen wir, dass sich diese Person höchst ungewöhnlich fühlt und verhält.
Obwohl sie starke Verletzungen hat, spürt sie keine Schmerzen. Doch nicht nur Schmerzen fühlt sie nicht, sie hat überhaupt keine Empfindungen im Körper und keine Gefühle. Der ganze körperlich-seelische Bereich befindet sich in einer außergewöhnlichen Taubheit. Entsprechend verhält sich eine solche Person trotz starker Verletzungen so, als wäre sie unversehrt. Nicht selten kommt es vor, dass sie zu den Sanitätern sagt: »Mir geht es gut. Ich gehe jetzt nach Hause«, obwohl sie blutüberströmt daliegt und vollkommen desorientiert ist.
Offensichtlich fühlt und verhält sich eine Person im Schock vollkommen anders als normalerweise. Wichtige Parameter, um eine Situation korrekt einzuschätzen, wie Körperempfindungen, Gefühle, Erinnerungen und geistige Zuordnungen, fehlen ihr in diesem Zustand. Das natürliche geistige Potenzial von Spüren, Denken, Erinnern, Vergleichen und Abschätzen, das ihr selbstverständlich im Alltag zur Verfügung steht, ist hier nicht oder nur stark eingeschränkt zugänglich. Gleichzeitig gibt ihr dieses geistige »Notprogramm« die Möglichkeit, trotz starker Verletzungen nicht von den Schmerzen und der Situation überwältigt zu werden und entsprechend eine gewisse Zeit empfindungslos agieren zu können. Es ist ein Überlebensmechanismus, der bei starken Verletzungen hilft, diese Extremsituation zu überstehen. Doch unabhängig vom biologischen Sinn eines Schockzustandes für das Überleben eines Menschen können wir feststellen, dass sich eine Person im Schock komplett verändert und sich verhält, als wäre sie ein vollkommen anderer Mensch. Sie befindet sich urplötzlich in einer anderen inneren Welt, in der es keine Empfindungen gibt.
Besonders tragisch wird dieses Phänomen, wenn eine Person aufgrund eines körperlichen oder seelischen Traumas in einen Schockzustand von emotionaler Taubheit fällt und dieser Bewusstseinszustand chronisch wird. Die Gefühllosigkeit wird zum Dauerzustand und die Unerreichbarkeit – ein Gefühl von »weit weg sein« oder von »abgeschnitten sein« – führt dazu, dass die Person keine Nähe mehr zu nahen Menschen, zu sich selbst oder zum Leben überhaupt empfinden kann.
Diese innere Unerreichbarkeit ist für Angehörige oft unverständlich und kann bei ihnen eine große Irritation hervorrufen. Manchmal spüren sie sogar einen Verlust, als ob sie den geliebten Menschen verloren hätten. Sie fühlen deutlich, dass die Person nicht mehr die »gleiche« ist und versuchen meist verzweifelt, dem »alten«, vertrauten Menschen wieder nahezukommen. Doch solange sich die traumatisierte Person im Bewusstseinszustand einer seelischen Taubheit befindet, haben die Angehörigen keine Chance. Erst wenn sie, vielleicht durch eine Psychotherapie unterstützt, wieder einen natürlichen Zugang zu ihren Gefühlen bekommt, kann sie wieder in einen Bewusstseinszustand zurückfinden, der ihr die seelische Nähe mit ihren Angehörigen ermöglicht.
Bewusstseinszustände bestimmen und verändern uns völlig. Das geht so weit, dass wir uns in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen verhalten, als wären wir eine andere Person. In gewissem Sinne agieren wir nicht nur wie eine andere Person, wir sind es. Die Art, wie wir wahrnehmen, was wir denken, ob und welchen Zugang wir zu unseren Gefühlen haben, kann sich radikal verändern, wenn wir den Bewusstseinszustand wechseln.
Ein alltägliches Beispiel dafür ist der Alkoholkonsum. Wie stark verändern wir uns, wenn wir Alkohol zu uns genommen haben? Die anfängliche Gelöstheit und Entspannung weichen bei zunehmendem Alkoholspiegel einer Enthemmung, bei der wir impulsiv und ungefiltert unseren Gefühlen und Meinungen freien Lauf lassen. Mit der Kontrolle schwinden jedoch auch unsere geistige Klarheit und die Sensibilität für unsere Umwelt. Wir werden regelrecht zu Egomanen. Unsere Stimme wird lauter, vielleicht schreien und grölen wir sogar herum. Dabei haben wir selbst das Gefühl, dass es ein Ausdruck von Lebensfreude ist. Wir sind uns dabei aber nicht bewusst, dass wir Nachbarn damit stören könnten, und im Grunde ist uns das in diesem Zustand auch egal. Auf unser Umfeld wirkt unser enthemmtes Verhalten keinesfalls freudvoll, sondern erzeugt eine bedrohliche Wirkung. Und das zu Recht. Schließlich kann die Enthemmung jederzeit dazu führen, dass das Gefühl der Lebensfreude in Aggression umkippt.
Am Beispiel Alkohol sehen wir, dass aus einem Menschen, der normalerweise vielleicht ein großes Verantwortungsbewusstsein für sein Verhalten und sein Umfeld an den Tag legt, plötzlich ein Egomane werden kann. Er wird offensichtlich im Rausch zu einem anderen Menschen. Aus der Suchtforschung wissen wir, dass eine Person, die regelmäßig Alkohol zu sich nimmt, nicht nur im akuten Zustand des Rausches ihre Persönlichkeit verändert, sondern mit der Zeit eine sogenannte »Suchtpersönlichkeit« entwickelt. Das bedeutet, dass sich die innere Veränderung, die mit dem Alkoholkonsum einhergeht, nicht nur im betrunkenen Zustand zeigt, sondern zu einem dauerhaften Charakterzug wird.