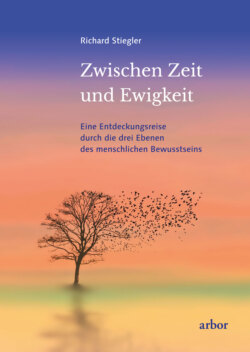Читать книгу Zwischen Zeit und Ewigkeit - Richard Stiegler - Страница 18
Eine Welt der Abstraktion
ОглавлениеDie vielleicht gewöhnlichste und uns am vertrautesten erscheinende Bewusstseinsebene ist die sogenannte Alltagsrealität. Sie prägt und bestimmt unser normales alltägliches Leben, in dem wir als klar definierte Person in einem sozialen Gefüge agieren. Dabei beziehen wir uns unbewusst auf unzählige Abstraktionen, Konzepte, Regeln, Vereinbarungen, Handlungsabläufe und Hilfsmuster, die uns genauso selbstverständlich erscheinen wie Atmen, Trinken und Schlafen.
Doch auch wenn es zu unserer zweiten Natur geworden ist, in abstrakten Dimensionen zu denken und zu handeln, ist diese Welt rein menschengemacht und damit sekundär. Sekundär bedeutet in diesem Zusammenhang, dass auf dieser Ebene kaum mehr unmittelbare Erfahrungen eine Rolle spielen. Im Gegenteil, unmittelbare Erfahrungen werden hier abstrahiert und organisiert.
Wenn wir zum Beispiel einen Geldschein dazu benutzen, um eine Ware einzukaufen, dann beinhaltet dieser Vorgang implizit ein Bündel an Abstraktionen. Ein Geldschein hat keinen unmittelbaren Wert. Er ist ein bedrucktes Stück Papier, nichts weiter. Erst durch die Überzeugung, dass er einen bestimmten Wert besitzt, erhält der Geldschein seinen Wert. Man könnte also sagen, dass wir selbst den Geldschein durch unsere Gedanken »aufladen«. Aber natürlich genügt unsere Überzeugung alleine nicht. Erst wenn ganz viele Menschen den Geldschein mit der gleichen Überzeugung von Wert »aufladen«, lässt sich mit diesem Stück Papier etwas einkaufen.
Dabei gibt es noch viele andere Abstraktionen und Überzeugungen, die den Geldschein erst möglich machen. Zum Beispiel müssen wir die Existenz eines Staates anerkennen, der den Geldschein druckt und an alle Bürgerinnen ausgibt. Ein Staat ist jedoch genauso eine gedankliche Konstruktion wie ein Geldschein. Erst wenn wir an bestimmte Grenzen glauben, entsteht ein Staatsgebiet. Erst durch bestimmte Definitionen entstehen Staatsbürgerinnen. Und schließlich hat eine Organisationseinheit wie eine Regierung oder ein Parlament erst dann die Macht, Regeln aufzustellen und das Leben zum Beispiel mithilfe von Geldscheinen zu organisieren, wenn Bürgerinnen diese Vorgänge anerkennen.
Je genauer wir das alltägliche Leben betrachten, werden wir entdecken, dass es durchsetzt ist von Abstraktionen und Gedankenkonstrukten, die uns helfen, das soziale Leben zu organisieren und zu meistern. Betrachten wir nur allein die Sprache, die es uns ermöglicht, äußerst differenziert den Kontakt zwischen Einzelwesen und Gemeinschaften zu regeln und Verständigung zu bewirken. Dabei beinhaltet die heutige Sprache des Menschen eine ungeheure Abstraktionsleistung. Ursprünglich war die Sprache für den Menschen, wie für viele Tiere, eine unmittelbare Gestaltform. Da wurden Stimmungen in Lauten ausgedrückt: Freude, Wut, Zärtlichkeit oder Angst lassen typische Laute entstehen. Noch heute finden sich in vielen Worten rudimentäre Hinweise auf die ursprüngliche Erfahrungsdimension, aus denen Worte entstanden sind.
Doch im Laufe der Menschheitsgeschichte haben sich Worte immer mehr verselbstständigt, abstrahiert und differenziert. Je mehr sich Sprache verselbstständigt und von der ursprünglichen Erfahrung entfernt, wird sie zu einer eigenen Wirklichkeit, die das Leben der Menschen nicht nur symbolisch beschreibt, sondern mindestens genauso auch prägt. Es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn ich sage, dass der moderne Mensch oft mehr in der Welt von Gedanken und der dazugehörigen Sprache lebt als in unmittelbaren Empfindungen.
Dabei ist eine Sprache weit mehr als eine symbolhafte Beschreibung von erfahrbarer Wirklichkeit, denn je mehr sich eine Sprache differenziert, desto mehr kreiert sie eine eigene, vorgestellte Welt mit abstrakten Begriffen. Gibt es wirklich den Euro, gibt es Deutschland oder die EU? Gibt es das Amt einer Bundeskanzlerin und was sind Steuern? An diesen Beispielen sieht man sehr deutlich, dass Gedanken und Sprache mehr sind als nur symbolhafte Beschreibungen von Wirklichkeit. Sie erschaffen Wirklichkeit. Je mehr wir Gedankenwirklichkeiten erzeugen und daran glauben, entstehen dadurch neue Realitäten, die auf die Entwicklung der ganzen Gesellschaft und des einzelnen Menschen zurückwirken.
Selbst wenn eine Person dann beschließen sollte, nicht mehr an die Realität von Euros oder bestimmten Gesetzen zu glauben, wird sie sich nicht so leicht entziehen können, da die kollektive Überzeugung gesellschaftlich genauso real auf uns einwirkt wie unmittelbare Erfahrungen von zum Beispiel Hitze oder Kälte. Tatsächlich werden wir sogar sanktioniert oder zumindest nicht mehr unterstützt, wenn wir kollektiven Gedankenrealitäten nicht entsprechen. Wenn wir zum Beispiel Euros und den Staat als Gedankenkonstrukt entlarven, um dann zu beschließen, keine Steuern mehr zu zahlen, würden wir sehr wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen.
Noch eines sollten wir uns vergegenwärtigen: Viele Gedanken und Konzepte sind keineswegs neutral oder objektiv, genauso wenig wie die Sprache als symbolhafte Beschreibung der Wirklichkeit. Bereits am Beispiel einer Landkarte, die bei einer Wanderung sehr hilfreich sein kann, sehen wir, dass ihre bildhafte Ausformung eine Bewertung beinhaltet, ja sogar beinhalten muss. Je nachdem, ob es eine Landkarte für Wanderer, Radfahrerinnen oder Autofahrer ist, werden bestimmte Wege und Merkmale herausgestellt und andere bewusst vernachlässigt oder im Hintergrund dargestellt.
Es gibt keine neutrale Landkarte, sonst müssten wir auf jede Form der Abstraktion verzichten und die Landschaft eins zu eins abfotografieren. Doch selbst eine solche Landkarte wäre das Produkt einer festgelegten Vogelperspektive und damit keineswegs objektiv. Genauso gibt es keine neutrale Beschreibung der Wirklichkeit. Jedes Wort, jede Abstraktion beinhaltet immer auch Meinungen und Bewertungen, die implizit auf uns einwirken.
Wenn wir zum Beispiel Worte benutzen wie »Frau« oder »Mann«, um einen Menschen zu charakterisieren, dann scheint das eine objektive Beschreibung zu sein. In Wirklichkeit beinhalten diese Begriffe bereits ein Bündel an kollektiven Zuschreibungen und Wertungen, die selbstwirksam sind und auf jede Frau und jeden Mann einwirken. Wenn man sich zum Beispiel als »Frau« in Deutschland auf eine Stelle bewirbt, hat man in Summe weniger Chancen und wird schlechter bezahlt. Auch an diesem Beispiel kann man sehen, wie stark Gedankenrealitäten unser konkretes alltägliches Leben steuern und prägen.