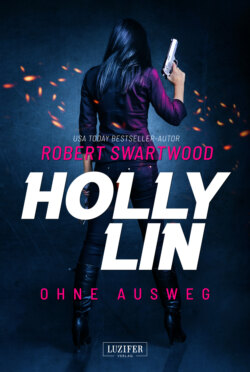Читать книгу OHNE AUSWEG (Holly Lin) - Robert Swartwood - Страница 17
Kapitel 11
ОглавлениеDie nächtliche Wüste hat einen grünlichen Teint angenommen. Das Ranchhaus hebt sich deutlich ab, sodass ich es gut erkennen kann – es ist ein flaches Backsteingebäude mit vergitterten Fenstern. Daneben steht ein weiteres Gebäude, ein kleiner Schuppen, von dem Rosalina sagte, dass die Wachen dort den Großteil ihrer Zeit verbringen.
Es gibt in keinem der Gebäude Strom oder fließend Wasser. Stattdessen brummt ein Generator leise vor sich hin und sorgt dafür, dass in dem Wachhäuschen Licht brennt. Ich liege auf dem Bauch auf einer felsigen Anhöhe und halte mir das Nachtsicht-Zielfernrohr ans Auge. Dann setze ich mich auf und drehe mich zurück zur anderen Seite des Hügels, wo ich das Auto geparkt habe. Rosalina sitzt noch drinnen, die Schlüssel stecken im Zündschloss. Ich habe ihr gesagt, wenn ich nicht in einer Stunde wieder da bin oder Gefahr droht, soll sie mit dem Auto abhauen und nicht mehr wiederkommen.
Jetzt durchbricht ein Geräusch die schwere Stille. Vonseiten der Ranch quietschen rostige Scharniere, denn eine Tür öffnet sich. Ein Mann tritt heraus und ich richte das Zielfernrohr auf ihn. Er ist groß, lateinamerikanischer Abstammung und trägt eine Waffe im Gürtelholster. Für einen Moment steht er da, starrt in die Stille und zieht dann ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche. Er steckt sich eine an und läuft in Richtung einiger verdorrter Büsche, wo er sich die Hose aufmacht.
Ich sehe ihm beim Rauchen und Pissen zu. Dann macht er sich die Hose wieder zu, dreht sich weg und nimmt einen letzten Zug, bevor er den Zigarettenstummel auf den Boden wirft und ihn mit seinem Stiefelabsatz austritt. Der Mann geht zurück zur Hütte, dreht sich noch einmal um und lässt seinen Blick über die dunkle Landschaft schweifen, dann geht er wieder hinein.
Nachdem ich das Zielfernrohr wieder verstaut habe, ziehe ich mir die FN-15 von der Schulter. Fest umklammere ich das Gewehr mit beiden Händen, als ich mich vorsichtig an den Abstieg mache. Es ist sehr dunkel, deswegen setze ich langsam einen Fuß vor den anderen und prüfe bei jedem Schritt erst einmal, ob der Untergrund mein Gewicht trägt. Das dauert eine Weile, aber irgendwann bin ich nur noch zwanzig Meter von der Ranch entfernt. Aus der Nähe kann ich nun Stimmen und Musik aus der Unterkunft der Wachen hören. Jemand lacht, jemand anderes hustet. Ich höre für eine Minute zu und komme zu dem Schluss, dass sich dort mindestens vier Männer aufhalten.
Ich setze meinen Weg zum Hauptgebäude fort, wobei ich das Gewehr auf das Wachhäuschen gerichtet halte. Rosalina hat mir gesagt, dass ihre Peiniger das Ranchgebäude manchmal unverschlossen lassen, um den Frauen ein falsches Gefühl von Freiheit zu vermitteln. Wenn dann eine von ihnen dumm genug ist und zu fliehen versucht, wird sie vergewaltigt und verprügelt.
Doch heute Nacht ist den Wächtern offenbar nicht nach solchen Spielchen zumute. Die Tür ist abgeschlossen.
Vielleicht hat das mit dem Ärger zu tun, der sich ereignet hat. Die Männer müssen wissen, was passiert ist, da mindestens eines der Mädchen darin verwickelt war.
Die rostigen Scharniere schreien erneut in die Nacht hinaus. Ein Mann tritt aus dem kleinen Gebäude, ein anderer als das Mal davor, der aber auch eine Waffe bei sich trägt. Ich erwarte schon, dass er auch eine Zigarette aus der Tasche zieht, aber das tut er nicht. Stattdessen läuft er auf dasselbe Gebüsch zu. Muss ihr Lieblingsbusch zum Anpissen sein.
Im Kopf gehe ich meine Möglichkeiten durch. Viele habe ich nicht.
Der Kerl bleibt vor dem Buschwerk stehen und macht sich die Hose auf. Für einen Moment steht er nur da und murmelt etwas auf Spanisch, dann höre ich den steten Strom von Urin auf den trockenen Boden pladdern. Ich habe keine Zeit zum Nachdenken. Er ist zwanzig bis dreißig Meter entfernt. Er hat mir seinen Rücken zugedreht. Er hat eine Schusswaffe, aber ich habe drei. Deswegen zögere ich nicht länger und schleiche in seine Richtung, wobei ich mein Bestes gebe, mit meinen Turnschuhen keine Geräusche auf dem harten, sandigen Untergrund zu machen. Als ich am Wachhaus vorbeikomme, höre ich wieder Stimmen, Gelächter und Musik. Einer der Männer fragt, ob noch jemand ein Bier möchte. Ich komme immer näher an seinen ausdauernd pissenden Kollegen heran, der irgendeine Melodie pfeift, die ich nicht erkenne.
Fünfzehn Meter … zehn Meter … fünf Meter …
Er hört mich, als ich fast hinter ihm bin. Er dreht sich um, seine Hand geht in Richtung seiner Waffe. Da bin ich auch schon an ihm dran, das Gewehr ist inzwischen wieder über meine Schulter geschnallt. Ich verpasse ihm einen harten Nierenschlag, dann greife ich seinen Kopf mit beiden Händen, um ihm das Genick zu brechen. Das ist allerdings nicht so leicht, wie es im Film aussieht. Ich habe den Kerl in einem schlechten Winkel erwischt und meine Bemühung hilft ihm bloß, sich schneller umzudrehen. Er versucht immer noch, seine Waffe zu ziehen. Mit dem Pissen war er noch nicht fertig, sein Schwanz hängt tropfend aus der Hose.
Ich schlage ihm in den Magen, wirble um ihn herum und ramme ihm den Ellbogen in den Nacken. Er geht zu Boden und ich eile hinterher, um es noch einmal zu versuchen. Ich lege einen Arm um sein Gesicht, den anderen um seinen Hinterkopf. Er versucht zu schreien, mich zu beißen, aber dann reiße ich seinen Kopf herum und höre das krachende Brechen seiner Wirbelsäule. Er ist allerdings nicht tot, sondern nur gelähmt. Auf dem Rücken liegend, rasen seine Pupillen hin und her. Sein Mund ist offen und er versucht zu schreien, aber er kann nur heiser atmen. Ich durchsuche seine Taschen. Finde zwar den Schlüssel nicht, den ich suche, aber dafür ein Springmesser. Ich lasse die Klinge herausschnellen und ramme sie ihm direkt in die Kehle.
Er stirbt immer noch nicht sofort. Erst einmal windet sich sein Körper in Krämpfen, wobei er Geräusche macht, als würde er ersticken. Nach einer Minute sackt er endlich in sich zusammen. Ich stehe auf und ziehe das Gewehr hervor. Ich entsichere es und gehe los, in Richtung des Wachhäuschens. Die Männer darin kann ich immer noch hören, offenbar haben sie nichts bemerkt. Niemand von ihnen wundert sich, wo ihr Kumpel bleibt. Die Eingangstür ist offen, nur ein Fliegengitter beschützt sie jetzt noch vor mir. Licht strahlt heraus auf die trockene Erde. Von der Seite kommend, lege ich eine Hand auf die Tür. Ich atme einmal tief durch, dann gehe ich rein.
Drinnen sitzen drei Männer und spielen Karten. Auf dem Tisch sind leere Bierflaschen verteilt, außerdem Tüten mit Chips und Brezeln. Erst sagt einer von ihnen: »Rico, das hat aber gedauert«, dann schaut einer der anderen auf, sieht mich, wirft seine Karten weg und stößt seinen Stuhl zurück. Die anderen folgen seinem Vorbild.
Ich schieße dreimal auf jeden von ihnen. Zwei bekommen die Kugeln direkt in die Brust und gehen zu Boden, ohne Probleme zu machen. Der Letzte bewegt sich zu schnell und wird nur in der Schulter getroffen. Er geht zwar auch zu Boden, doch er lebt noch und zieht seine Waffe, dann versucht er aufzustehen und in meine Richtung zu zielen. Ich hechte auf ihn zu – er ist schnell, aber ich bin schneller, und ich schieße ihm direkt zwischen die Augen.
Für einen Moment tue ich nichts, außer einfach nur dazustehen. Mein Herz rast. Ich rieche den Schweiß der Männer sowie das billige Bier, außerdem den Geruch von Galle, die von ihren sterbenden Körpern ausgeworfen wird.
Ich fange mit dem Mann an, den ich zuletzt getötet habe. Keine Schlüssel. Der Nächste hat welche. Einen ganzen Schlüsselbund, den ich an mich nehme und mit dem ich zur Ranch eile.
Nach einigen Fehlversuchen habe ich den richtigen Schlüssel erwischt, mache die Tür auf und trete ein. Ich ertaste den Lichtschalter und es wird hell.
Der ganze Raum ist mit Pritschen gefüllt, es sind mindestens dreißig Stück. Etwa die Hälfte davon sind belegt. Unter den Bettdecken lugen angsterfüllte Augen hervor. Die Frauen denken natürlich, dass einer der Wärter reingekommen ist, keine Killerin mit einem Gewehr auf der Schulter. Rosalina hat mir gesagt, dass die meisten der Mädchen Mexikanerinnen sind, also wende ich mich auf Spanisch an sie.
»Ihr müsst alle gehen. Beeilt euch und schnappt eure Sachen!«
Niemand bewegt sich. Sie müssen denken, dass sie träumen.
»Sofort!«, brülle ich und die Mädchen zucken zusammen. Dann springen sie auf und laufen durcheinander. Viele von ihnen lächeln. Ich stehe einfach nur da und beobachte sie, bis ein Mädchen mit einem angeschwollenen, blauen Auge auf mich zukommt.
»Wer bist du?«, fragt sie.
»Das ist egal. Ich bin hier, um euch zu befreien.«
»Was ist mit den anderen?«
»Rosalina ist in Sicherheit.«
Ich erwarte einen erleichterten Gesichtsausdruck, doch das Gegenteil ist der Fall.
Sie wiederholt: »Was ist mit den anderen?«
»Welche anderen?«
Die Augen des Mädchens weiten sich vor Angst. Auch die anderen jungen Frauen halten inne. In der abrupt eintretenden Stille höre ich dasselbe wie alle anderen – ein Geräusch, was sie wahrscheinlich jede Nacht hören: näherkommende Fahrzeuge. Mindestens zwei Stück.