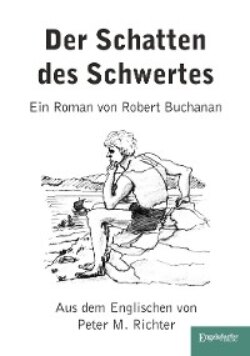Читать книгу Der Schatten des Schwertes - Robert Buchanan - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel IX
St. Napoleon
ОглавлениеDie Witwe Derval, die in dieser Nacht das Gesicht ihrer Tochter erblickt, als sie ausgezogen in der oberen Kammer steht, fühlt, dass ihre Gebete nahezu unnütz sind.
Die kleine Kammer hat zwei Betten an der Wand, jedes weiß wie Schnee aus den Linnen wie in den ärmsten bretonischen Landhäusern. In einem von ihnen schläft die Witwe, in dem anderen Marcelle, die sich gerade zur Ruhe fertig macht und sich mit ihrer Abendtoilette lange aufhält und mit einer Begeisterung, die sie vorher nicht kannte.
Die Dielen sind schwarz und kahl, die Wände sind ebenfalls schwarz und es befinden sich Haken daran, worauf verschiedene Sachen zum anziehen hängen. Das Hauptmöbel in dem Raum ist ein Tisch und eine Figur. Auf dem Tisch steht eine mit kleiner Flamme brennende uralte Öllampe. In einer Ecke steht eine große eichene Truhe, von der ein Duft von frischen sauberen Linnen kommt, daß mit kleinen Schächtelchen mit getrockneten Rosenblüten parfümiert ist. Nicht weit von der Truhe ist ein einfacher Spiegel, der in einem Rahmen an der Wand befestigt ist. Marcelle hat ihr Obergewand, ihre Holzschuhe und Strümpfe ausgezogen. Unschuldig wie Seide steht sie und löst ihr schönes, langes Haar und streicht es in ihren beiden zarten Händen. Als die dunklen Locken über ihre Schultern fallen, schaut sie auf ihr Antlitz im Spiegel und errötet bei ihrem Anblick mit den funkelnden Augen und den hellen Wangen.
Dann windet sie eine lange Locke um ihren Zeigefinger, betrachtet sich ruhig und in Gedanken sieht sie wieder die Szene mit Rohan. Sie fühlt die starken, sie umfassenden Arme und hört das weiche Murmeln der See und macht sich die Liebesküsse auf ihren Lippen wieder bewusst. Mit sich selbst zufrieden, lächelt sie und ihr Ebenbild antwortet ihr aus der Dunkelheit der Wand. Dann beugt sie sich näher, als sähe sie sich dann besser. Das Ebenbild beugt sich auch und wird heller, dann geht durch sie ein Impuls, dass sie nicht länger verweilen kann, drückt ihre roten Lippen auf die Lippen ihres Spiegelbildes für einen langen, weichen, schmeichelnden und liebevollen Kuß. Ein Kuß für sich selbst. Sie nimmt ihr gelöstes Haar und berührt es liebevoll, es ist solch ein Reichtum wie ihn nur wenige der bretonischen Mädchen besitzen. An nicht einer einzigen Locke konnte der fahrende Friseur etwas verdienen, sie bewahrt die Pracht unter ihrer Haube, als ein kostbares Gut und geheimen Besitz. Sie hat kein goldenes Haar, von dem unsere Poeten voll Leidenschaft so süß gesungen hatten und die helle Pracht so liebten. Marcelle liebte ihre Pracht ebenso und würde sie mit ins Grab nehmen.
Was ist göttlicher für dieses einfache Herz, als Schönheit, die es selbst entdeckt, nicht aus Selbstgefälligkeit, nicht aus Torheit oder Stolz, sondern in der stillen Freude an seinen eigenen Köstlichkeiten, welche eine süße Blume ermöglicht das zu fühlen, diese stille Begeisterung seines eigenen Lichts, welches im Dasein eines Sterns lebt. Von den zart liebkosenden Fingern, bis zu den kunstvoll und hübsch geformten Füßen ist Marcelle schön, so weich in fast perfekter Fraulichkeit geformt. Vollendet vom dunklen antiken Hals bis zu den mit weißen Grübchen besetzten Knie. Und sie weiß es, dieses bretonische Bauernmädchen, wie Helena und Aphrodite es wussten, nicht in ihrem Kopf und bewußt, sondern sie fühlt es in ihrer Brust, es regt sich in ihrem Herzen. Gleichsam wie ein Blume, die ihren Duft entfaltet, den sie in der Sommerluft aussendet. Zuletzt tadelt sie ihr Haar und steht für einen Moment unschlüssig, dann sinkt sie vor dem Sessel sanft wie ein Wasserfall auf ihre Knie, und verbirgt ihr Gesicht in ihren Händen und beginnt zu beten.
Rechts über ihren Kopf hängt an der Wand ein Karton, bemalt mit der Jungfrau Maria, die das gewickelte, in der Hand eine Lilie haltende und freundlich lächelnde Kind hält. Die Figuren sind mit Gold- und Silberflitter bedeckt und der Stengel der Lilie steckt in einem goldenen Blatt. Die Gesichter sind anmutig.
Marcelle betet:
„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“
Sie dankt dem HERRN für sein Wohlwollen. Sie bittet IHN ihre Sinne zu erleuchten, ihre zu Gott oder die ihrer Nachbarn. Danach wiederholt sie die allgemeinen Bekenntnisse. Dann erhebt sie ihren Blick zu dem Bild und betet zur Heiligen Jungfrau. Plötzlich mit einer leisen, klaren und tiefen Stimme betet sie für die, die sie liebt und den sie liebt, für die Seele ihres toten Vaters, für den alten Korporal und ihrer geliebten Mutter, für ihre Brüder, Hoel, Gildas, Alain und Jannick. Zuletzt haucht sie mit leiser Stimme noch den Namen Rohan Gwenferns und sie zittert beim Beten:
„Segne meine Liebe zu Rohan, oh, gesegnete Jungfrau und gewähre mir Deine Gunst, dass ich niemals mehr sündige gegen Dich.“
Dann hält sie inne. Ihr Gebet scheint beendet, für einen Moment ist sie verstummt. Dann nimmt sie die Hände vom Gesicht und ihre Augen schauen auf, nicht auf das Bild der Jungfrau und ihres Sohnes, sondern zu einem anderen Bild, bunt gemalt und nicht sehr groß, welches an der gleichen Wand hängt. Es ist das Bild eines Mannes in Uniform, auf einer Anhöhe stehend und mit dem Zeigefinger nach unten auf ein rotes Licht zeigend, welches von einer brennenden Stadt zu kommen scheint. Sein Gesicht ist weiß wie Marmor und zu seinen Füssen ducken sich Hunde, die darauf warten losgelassen zu werden, ihre Köpfe auf dem Boden gelegt. Desweiteren verschiedene grauhaarige Grenadiere, schnurrbärtige und vollbärtige mit blutunterlaufenen Augen und jeder mit seinem Seitengewehr ausgerüstet. Das Bild ist grob und furchtbar gewöhnlich, aber majestätisch. Es ist eine glühende Darstellung einer Sache, die einmal mehr die kunstvolle Verarbeitung der Verderblichkeit hat.
Nicht mit einer geringen frommen Liebe und nicht mit einer geringen Verehrung betrachtet Marcelle dieses Bild. Ihre Blicke verbleiben gütig auf ihm, ihre Lippen bewegen sich, als wolle sie es küssen, dann fällt ihr Gesicht wieder wie vorher in ihre Hände, aber in größerer Geistesgegenwart.
Sie betet erneut und währenddessen schaut sie auf über ihrem Bett, auf das sie sich nun gelegt hat, das aufgehängte Gewehr und das Bajonett und darüber, auf einem hohen Bord liegend, sauber und sorgsam gebürstet und zusammengelegt einen alten Tornister, Rucksack, Kartuschenkiste, Tschako und einen Mantel. Diese Dinge sind heilig und wurden vom Korporal in manchem Krieg getragen. Er mag es nicht wie viele andere Veteranen, sie malerisch über dem Kamin zu präsentieren, er mag es lieber in der Reinheit einer Jungfernkammer. Erneut kniet sie nieder: „Und zuletzt, oh barmherziger Gott und dem Willen Jesu, Deinem Sohn und unserer Heiligen Mutter und allen Heiligen, schütze den guten Kaiser und gib ihm den Sieg über seine Feinde und werfe die Gottlosen, die ihn und sein Volk vernichten wollen, nieder und segne seine Gefallenen, dass sie den Segen erhalten, den Du uns gegeben hast. Amen. Amen!“
Und so ist er der Letzte und vielleicht nicht der Schlechteste der Heiligen, St. Napoleon, der leidenschaftslos nach unten deutet, während das Mädchen sich erhebt. Die Leidenschaftlichkeit ihres Gebets treibt ihr Tränen in die Augen. Bald hat sie sich entkleidet, die Lampe ausgeblasen und kriecht ins Bett. Schon bald danach ist sie eingeschlafen. Während das alte Bajonett, welches das Blut so mancher menschlichen Kreatur getrunken hatte, seinen Platz über ihren Kopf beibehält, werden die Gestalten der Jungfrau und des St. Napoleon Seite an Seite sie in der Nacht bewachen.