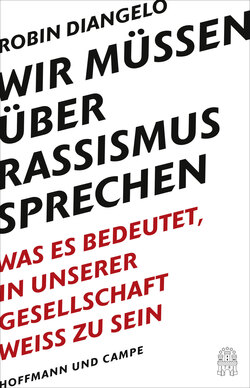Читать книгу Wir müssen über Rassismus sprechen - Robin J. DiAngelo - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wir verstehen die Sozialisation nicht
ОглавлениеWenn ich mit Weißen über Rassismus spreche, sind ihre Reaktionen so vorhersehbar, dass ich manchmal den Eindruck habe, wir alle zitieren Textzeilen aus einem gemeinsamen Drehbuch. In gewisser Weise ist das tatsächlich der Fall, weil wir Akteure in einer gemeinsamen Kultur sind. Einen wichtigen Anteil an der Entstehung des weißen Drehbuchs hat der Umstand, dass wir uns für höchst individuelle Einzelwesen halten und darüber hinaus glauben, objektiv zu sein. Wenn wir die Empfindlichkeit Weißer begreifen wollen, müssen wir zu verstehen beginnen, warum wir beides nicht, oder nur teilweise, sind. Wir müssen anfangen, die Kräfte der Sozialisation zu begreifen.
Unsere Wahrnehmungen und Erlebnisse ergeben durch unsere spezielle kulturelle Sichtweise für uns einen Sinn. Diese Sichtweise ist weder universell noch objektiv, aber ohne sie könnte keine menschliche Gesellschaft funktionieren. Diesen kulturellen Rahmen zu analysieren, kann in der westlichen Kultur eine besondere Herausforderung sein, eben weil sie von zwei Schlüsselideologien geprägt ist: Individualismus und Objektivität. Der Individualismus behauptet, jedes Individuum sei einzigartig und unterscheide sich von allen anderen auch innerhalb seiner sozialen Gruppen. Hinter dem Objektivitätsgedanken steckt die Behauptung, dass es möglich sei, sich frei zu machen von jeglicher Voreingenommenheit. Diese Ideologien machen es weißen Menschen überaus schwer, die kollektiven Aspekte ihrer Erfahrungen zu analysieren.
Individualismus ist eine Erzählung, die die Vorstellung erzeugt, verbreitet, reproduziert und stärkt, jeder von uns sei ein einzigartiges Einzelwesen und die Zugehörigkeit etwa zu einer »Rasse«, Schicht oder einem Geschlecht sei für unser gesellschaftliches Leben irrelevant. Der Individualismus behauptet, es gebe für den individuellen Erfolg keine Hindernisse, und ein Scheitern habe seinen Grund nicht etwa in den gesellschaftlichen Strukturen, sondern im Charakter des Einzelnen. Selbstverständlich nehmen wir nach »Rasse«, Gender, Schicht und anderen Kategorien unterschiedliche Positionen ein, die unsere Chancen im Leben auf eine keineswegs natürliche, freiwillige oder zufällige Weise beeinflussen. Chancen sind nicht gleichmäßig auf »Rassen«, Schichten und Geschlechter verteilt. Irgendwie wissen wir, dass Bill Gates’ Sohn mit Möglichkeiten geboren wurde, die ihm im Laufe seines Lebens nützen werden, ganz gleich, ob er nun mittelmäßig oder besonders talentiert ist. Doch obwohl Gates’ Sohn eindeutig unverdiente Vorteile genießt, klammern wir uns an die Ideologie des Individualismus, wenn wir über unsere eigenen unverdienten Vorteile nachdenken sollen.
Ungeachtet unserer Einwände, gesellschaftliche Gruppen spielten keine Rolle und für uns seien alle Menschen gleich, wissen wir nur zu gut, dass ein Mensch, der nach der herrschenden Kultur als Mann definiert ist, andere Erfahrungen macht als eine Frau. Wir wissen, dass es ein Unterschied ist, ob wir als alt oder jung, reich oder arm, körperlich fit oder beeinträchtigt, homosexuell oder heterosexuell und so fort gelten. Die Zugehörigkeit zu diesen Gruppen spielt eine Rolle, die jedoch keineswegs naturgegeben ist, wie man uns oft glauben machen will. Vielmehr lernen wir, dass sie wichtig sind, und die ihnen zugeschriebene gesellschaftliche Bedeutung sorgt für unterschiedliche Lebenserfahrungen. Diese gesellschaftlichen Bedeutungen werden uns auf vielfältige Weise durch ein breites Spektrum von Menschen und Medien vermittelt. Es ist ein Training, das sich nach unserer Kindheit lebenslang fortsetzt. Vieles läuft dabei nonverbal ab, indem wir beobachten und uns mit anderen vergleichen.
Wir werden kollektiv in unsere Gruppen hineinsozialisiert. In der Mainstream-Kultur erhalten wir alle die gleichen Botschaften, was diese Gruppen bedeuten und warum die Zugehörigkeit zu einer Gruppe eine andere Erfahrung vermittelt als die Zugehörigkeit zu einer anderen Gruppe. Wir wissen, dass es »besser« ist, zu dieser Gruppe, statt zu jener anderen zu gehören, also etwa jung, statt alt, körperlich fit, statt beeinträchtigt, reich, statt arm zu sein. Unser Verständnis, welche Bedeutung solche Gruppen haben, erwerben wir kollektiv durch gemeinsame und unvermeidbare Aspekte der Gesellschaft um uns herum: Fernsehen, Spielfilme, Nachrichten, Songtexte, Zeitschriften, Lehrbücher, Schulen, Religion, Literatur, Erzählungen, Witze, Traditionen, Sitten, Geschichte und so weiter. Diese Dimensionen unserer Kultur prägen unsere Gruppenidentität.
Unser Selbstverständnis basiert zwangsläufig auf unseren Vergleichen mit anderen. Der Schönheitsbegriff ist ohne Vorstellung vom Hässlichen ebenso bedeutungslos wie Klugheit ohne ihr Gegenteil, die Dummheit, und wenn ich glaube, meine Privilegien verdient zu haben, muss ich unterstellen, dass andere sie offenbar nicht verdient haben. Wir erfahren, wer wir sind, indem wir begreifen, wer wir nicht sind. Aber weil in unserer Gesellschaft ausschließlich die Individualität betont wird, sind viele von uns nicht darin geübt, über unsere Gruppenzugehörigkeiten nachzudenken. Wenn wir heute die Beziehungen zwischen den »Rassen« verstehen wollen, müssen wir gegen unsere Konditionierung handeln und uns damit auseinandersetzen, wie und warum die Gruppenzugehörigkeit zu einer »Rasse« eine Rolle spielt.
Die Auseinandersetzung mit Gruppenidentität stellt nicht nur unser Selbstverständnis als Individuen infrage, sondern auch unseren Glauben an die Objektivität. Wenn Gruppenzugehörigkeit relevant ist, sehen wir die Welt nicht aus einem universell menschlichen Blickwinkel, sondern nur aus der Sicht einer bestimmten Art von Mensch. So werden beide Ideologien entlarvt. Für viele Weiße ist es besonders problematisch, über unsere Deutungsrahmen in Bezug auf »Rassen« nachzudenken, weil wir gelernt haben, dass ein Rassenstandpunkt Voreingenommenheit bedeutet. Leider schützt diese Überzeugung unsere Voreingenommenheit, denn indem wir sie leugnen, gewährleisten wir, dass wir sie nicht analysieren oder verändern. Es ist wichtig, das im Kopf zu behalten, wenn wir über unsere Rassensozialisation nachdenken, denn es besteht ein großer Unterschied zwischen dem, was wir unseren Kindern erzählen, und den zahllosen nonverbalen Formen, mit denen wir ihnen die Rassennormen unserer Kultur beibringen.
Bei vielen weißen Menschen wird allein schon der Titel dieses Buches auf Widerstand stoßen, weil ich damit gegen eine Grundregel des Individualismus verstoße: Ich verallgemeinere. Ich tue so, als könnte ich etwas über eine Person wissen, nur weil sie weiß ist. Vielleicht überlegen Sie gerade, wie sehr Sie sich von anderen Weißen unterscheiden, und wenn ich nur mehr über Sie wüsste – in welchem Viertel Sie aufgewachsen sind, welche Kämpfe Sie ausgestanden und welche Erfahrungen Sie gemacht haben –, dann wüsste ich, dass Sie anders sind, dass Sie kein Rassist sind. Diesen verbreiteten Reflex habe ich in meiner Arbeit unzählige Male erlebt.
Kürzlich hielt ich einen Vortrag vor etwa zweihundert Beschäftigten einer Firma, in der lediglich fünf Menschen of Color arbeiteten, und davon waren nur zwei Afroamerikaner. Immer wieder betonte ich, wie wichtig es sei, dass Weiße in Rassenfragen Demut zeigen und sich nicht von der unausweichlichen Dynamik des Rassismus ausnehmen. Als ich meinen Vortrag beendet hatte, erhoben sich sofort weiße Zuhörer, vorgeblich, um mir Fragen zu stellen, oft jedoch nur, um mir ihre Ansichten zum Thema »Rasse« mitzuteilen, die sie natürlich auch schon vor meinem Vortrag gehabt hatten. Als Erstes erklärte ein weißer Mann, er sei Amerikaner italienischer Abstammung und früher hätten auch Italiener als Schwarze gegolten und seien diskriminiert worden, ob ich denn nicht glaube, dass weiße Menschen ebenfalls Rassismus erführen? Er stand dort in diesem Saal mit einem überwiegend weißen Publikum und war felsenfest davon überzeugt, dass er sich nicht mit seinem Weißsein auseinandersetzen müsse, weil Italiener früher einmal diskriminiert wurden. Auch dies ist ein typisches Beispiel für die lähmende Wirkung des Individualismus. Eine fruchtbarere Form der Auseinandersetzung (weil sie seine gegenwärtige Weltsicht verändert hätte, statt sie noch weiter zu verfestigen) hätte in der Überlegung bestanden, wie Amerikaner italienischer Abstammung es geschafft haben, als Weiße anerkannt zu werden, und wie diese Assimilation seine gegenwärtigen Erfahrungen als weißer Mann geprägt hat. Seine Äußerungen illustrierten keineswegs, dass er sich in Hinblick auf die »Rasse« von anderen weißen Menschen unterschied. Ich kann vorhersagen, dass viele meiner Leser und Leserinnen ähnliche Ausnahmegründe vorbringen würden, eben weil wir Produkte unserer Kultur sind und nicht von ihr losgelöste Individuen.
Als Soziologin kann ich mit Verallgemeinerungen gut umgehen. Das gesellschaftliche Leben weist Muster auf, es ist mess- und quantifizierbar und in gewisser Weise damit vorhersagbar. Allerdings kann ich gut nachvollziehen, dass meine Verallgemeinerungen über weiße Menschen Abwehrreaktionen auslösen, wenn man den hohen Stellenwert der Ideologie des Individualismus in unserer Kultur bedenkt. Selbstverständlich gibt es Ausnahmen, aber Muster werden eben als solche erkannt, weil sie immer wiederkehren und vorhersagbar sind. Moderne Formen des Rassismus lassen sich nicht verstehen, wenn wir Muster des Gruppenverhaltens und ihre Auswirkungen auf Einzelpersonen nicht erforschen können oder wollen. Meine Leser und Leserinnen möchte ich daher ermutigen, ihre persönliche Situation neu zu überdenken, statt die hier vorgelegten Belege in Bausch und Bogen zurückzuweisen. Vielleicht sind Sie in Armut aufgewachsen, sind ein aschkenasischer Jude europäischer Herkunft oder stammen aus einer Soldatenfamilie. Vielleicht sind Sie in Kanada, auf Hawaii oder in Deutschland aufgewachsen oder haben Menschen of Color in Ihrer Familie. Keine dieser Situationen nimmt Sie von den Kräften des Rassismus aus, weil kein Aspekt der Gesellschaft von ihnen verschont bleibt.
Statt das, was Sie an sich für einzigartig halten, als Grund zu sehen, sich von einer weiteren Untersuchung auszunehmen, wäre es ein fruchtbarer Ansatz, folgende Überlegung anzustellen: »Ich bin weiß und habe eine Erfahrung X gemacht. Wie hat diese Erfahrung X mich aufgrund der Tatsache, dass ich zudem weiß bin, geprägt?« Ihr Gefühl der Einzigartigkeit beiseite zu lassen, ist eine wichtige Fähigkeit, die es Ihnen ermöglicht, das große Bild der Gesellschaft zu sehen, in der wir leben. Individualismus lässt das nicht zu. Zunächst einmal sollten wir versuchen, von unserer individuellen Erzählung abzusehen und uns mit den kollektiven Botschaften auseinanderzusetzen, die wir als Mitglieder einer umfassenderen gemeinsamen Kultur vermittelt bekommen. Bemühen Sie sich, zu erkennen, wie diese Botschaften Ihr Leben geprägt haben, statt einige Aspekte Ihrer Geschichte als Vorwand zu nutzen, sich von ihrem Einfluss freizusprechen.