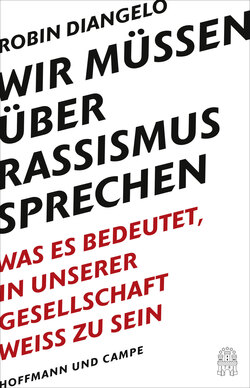Читать книгу Wir müssen über Rassismus sprechen - Robin J. DiAngelo - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Weißsein als Status
ОглавлениеAls weiß wahrgenommen zu werden, ist mehr als die Zuordnung zu einer »Rasse«, es ist ein gesellschaftlicher und institutioneller Status und eine Identität, ausgestattet mit rechtlichen, politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Rechten und Privilegien, die anderen verweigert werden. Cheryl Harris, Juristin und Expertin für Critial Race Studies, prägte in Bezug auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Vorteile, die eine Einstufung als weiß mit sich bringt, den Begriff »Weißsein als Rechtsgut« (whiteness as property). Sie zeichnete nach, wie sich das Konzept des Weißseins im Laufe der Rechtsgeschichte entwickelte:
Indem Weißsein einen tatsächlichen Rechtsstatus erhielt, wurde ein Aspekt der Identität in einen externen Besitz verwandelt und Weißsein von einer privilegierten Identität zu einem verbrieften Recht erhoben. Die rechtliche Konstruktion des Weißseins definierte und bestätigte wesentliche Aspekte der Identität (wer weiß ist); der Privilegien (welche Vorteile aus diesem Status erwachsen) und der Rechtsgüter (welche Rechtsansprüche aus diesem Status erwachsen). Weißsein bezeichnet und wird verschiedentlich eingesetzt als Identität, Status und Rechtsgut, manchmal einzeln, manchmal kombiniert.[21]
Harris’ Analyse macht auf anschauliche Weise deutlich, wie Identität und deren Wahrnehmung den Zugang zu »Ressourcen« gewähren oder verweigern kann. Zu diesen Ressourcen gehören etwa Selbstwert, Sichtbarkeit, positive Erwartungen, psychische Freiheit von den Fesseln der »Rasse«, Bewegungsfreiheit und Zugehörigkeitsgefühl – und vor allem das Gefühl, Anspruch auf all diese Elemente zu haben.
Unter Weißsein können wir uns alle möglichen Aspekte vorstellen – Aspekte, die über bloße körperliche Unterschiede hinausgehen und die damit zusammenhängen, was es bedeutet, in einer Gesellschaft als weiß definiert zu sein, und welche materiellen Vorteile daraus erwachsen. Statt wie üblich in den Blick zu nehmen, wie Rassismus Menschen of Color schadet, betrachten wir, wenn wir das Weißsein in den Mittelpunkt stellen, wie Rassismus die Stellung weißer Menschen hebt.
Weißsein beruht auf einer Grundprämisse: Es definiert Weiße als menschliche Norm oder Standard und Menschen of Color als die Abweichung von dieser Norm. Weiße Menschen nehmen Weißsein nicht als privilegierten Status zur Kenntnis, sondern betrachten es als universelle Größe, an der alles zu messen ist. Ihnen fällt es schwer, Weißsein als eine spezifische Eigenschaft zu sehen, die Einfluss auf ihr Leben und ihre Wahrnehmung haben könnte.
Seit Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten schreiben Menschen of Color wie W.E.B. Du Bois und James Baldwin über das Weißsein. Sie zwingen weiße Menschen dazu, ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken und sich damit zu befassen, was es heißt, in einer durch »Rasse« gespaltenen Gesellschaft weiß zu sein. So fragte ein französischer Reporter 1946 den in Frankreich lebenden Schriftsteller Richard Wright nach seiner Ansicht zum »Negerproblem« in den Vereinigten Staaten. Wright erwiderte: »Es gibt kein Negerproblem. Es gibt nur ein Weißenproblem.«[22]
Wie Wright aufzeigte, existiert Rassismus gegen Menschen of Color nicht in einem luftleeren Raum. Aber die Vorstellung, Rassismus könne in den Vereinigten Staaten jenseits der weißen Bevölkerung existieren, wird durch Feiern wie den Black History Month gestärkt, in dem wir den Amerikanischen Bürgerkrieg und die Bürgerrechtsbewegungen behandeln, als hätten sie losgelöst von der übrigen US-Geschichte stattgefunden. Diese speziell auf Menschen of Color ausgerichteten Feiern nehmen generell Weiße aus der Gleichung heraus. Darüber hinaus gibt es noch besondere Formen, die Leistungen von Menschen of Color aus dem gesellschaftlichen Gesamtkontext herauszulösen und zu entpolitisieren, etwa in Erzählungen über schwarze Kulturhelden.
Die Geschichte von Jackie Robinson ist ein klassisches Beispiel, wie Weißsein Rassismus kaschiert, indem es Weiße sowie ihre Privilegien und rassistischen Institutionen unsichtbar macht. Häufig wird Robinson als erster Afroamerikaner gefeiert, der die Rassentrennung durchbrach und in der Major League Baseball spielte. Er war zweifellos ein erstaunlicher Baseballspieler, aber diese Darstellung schildert ihn als ein besonderes Individuum seiner »Rasse«, als schwarzen Mann, der aus eigener Kraft die Rassenschranken überwand. Der Subtext unterstellt, Robinson habe schließlich die nötigen Fähigkeiten gehabt, um mit Weißen in einer Liga zu spielen, als ob vor ihm kein schwarzer Sportler gut genug gewesen wäre, auf dieser Ebene mitzuhalten. Man könnte seine Geschichte auch in dem Satz zusammenfassen: »Jackie Robinson war der erste schwarze Mann, dem Weiße erlaubten, in der Major League Baseball zu spielen.« Denn ganz gleich, wie phantastisch Robinson als Spieler auch war, er hätte schlicht nicht in der ersten Liga spielen können, wenn Weiße – die in dieser Institution das Sagen hatten – es ihm nicht erlaubt hätten. Wäre er aufs Spielfeld gegangen, bevor weiße Eigentümer und politische Entscheidungsträger es ihm erlaubt hätten, hätte die Polizei ihn entfernt.
Erzählungen über herausragende Vertreter bestimmter »Rassen« verschleiern die Realität fortwährender institutioneller Kontrolle durch Weiße und stärken die Ideologie des Individualismus und der Meritokratie. Zudem erweisen sie Weißen einen Bärendienst, indem sie die weißen Verbündeten verschweigen, die hinter den Kulissen lange und hart darum rangen, das Spielfeld für afroamerikanische Spieler zu öffnen. Diese Verbündeten könnten als dringend benötigte Rollenvorbilder für andere Weiße dienen (auch wenn wir zugeben müssen, dass die Aufhebung der Segregation im Baseball für diese Verbündeten wirtschaftliche Anreize hatte).
Ich bin nicht gegen den Black History Month. Aber er sollte auf eine Weise begangen werden, die das Weißsein nicht stärkt. Allen, die fragen, warum es keinen White History Month gibt, veranschaulicht die Antwort darauf die Wirkungsweise des Weißseins: Die Tatsache, dass es keine »Geschichte der Weißen« gibt, impliziert, dass sie gar nicht eigens geschildert werden muss, denn sie ist die Norm. Die Notwendigkeit, hervorzuheben, dass wir über die Geschichte der Schwarzen oder die der Frauen sprechen, deutet darauf hin, dass diese Beiträge außerhalb der Norm liegen.
Die Soziologin Ruth Frankenberg, die Pionierarbeit auf dem Gebiet der Weißseinsforschung leistete, bezeichnete Weißsein als vieldimensional. Zu diesen Dimensionen gehören eine Position struktureller Bevorzugung, ein Standpunkt, von dem aus Weiße sich, andere und die Gesellschaft sehen, und ein bestimmter Satz kultureller Praktiken, die nicht eigens benannt oder zugegeben werden.[23] Die Aussage, dass Weißsein eine Position struktureller Bevorzugung bedeutet, erkennt an, dass damit eine privilegierte Stellung in der Gesellschaft und ihren Institutionen verbunden ist, nämlich als Insider angesehen zu werden und die Vorteile der Zugehörigkeit zu genießen. Aus dieser Stellung erwachsen automatisch unverdiente Vorteile. Weiße kontrollieren alle wichtigen gesellschaftlichen Institutionen und bestimmen die Politik und die Praktiken, nach denen andere leben müssen. Auch wenn in seltenen Fällen einzelne Menschen of Color in den Kreis der Machthabenden aufsteigen – Colin Powell, Clarence Thomas, Marco Rubio, Barack Obama –, stellen sie den Rassismus nicht ausreichend infrage, um eine Bedrohung für den Status quo zu sein. Ihre Machtpositionen bedeuten keineswegs, dass diese Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens keinen Rassismus erfahren (Obama erlebte Beleidigungen und Widerstand in einem bis dahin ungeahnten Maße), aber der Status quo bleibt erhalten.
Die Aussage, dass Weißsein ein Standpunkt ist, bedeutet, dass es einen wesentlichen Aspekt der Identität Weißer ausmacht, sich als Individuum außerhalb oder unberührt von »Rasse« zu sehen – »einfach als Mensch«. Dieser Standpunkt versteht weiße Menschen und ihre Interessen als zentral und repräsentativ für die Menschheit. Zudem produzieren und stärken Weiße die herrschenden Narrative der Gesellschaft – wie Individualismus und Meritokratie – und nutzen sie, um die Stellung von Gruppen anderer »Rassen« zu erklären. Diese Erzählungen erlauben es uns, uns zu unserem Erfolg in den gesellschaftlichen Institutionen zu gratulieren und anderen die Schuld an ihrem mangelnden Erfolg zu geben.
Die Aussage, dass Weißsein einen bestimmten Satz nicht benannter kultureller Praktiken umfasst, heißt, Rassismus als Netz von Normen und Verhaltensweisen zu begreifen, das durchgängig Weiße bevorzugt und Menschen of Color benachteiligt. Zu diesen Normen und Verhaltensweisen gehören Grundrechte und ein Vertrauensvorschuss nach dem Grundsatz »im Zweifel für den Angeklagten« – Prinzipien, die angeblich für alle gelten, die aber tatsächlich nur Weißen durchgängig zugebilligt werden. Die Dimensionen des Rassismus, die Weißen nützen, sind für sie in der Regel unsichtbar. Wir sind uns der Bedeutung der »Rasse« und ihrer Auswirkungen auf unser Leben nicht bewusst oder geben sie nicht zu. Daher erkennen wir das Privileg des Weißseins und die Normen nicht, die diese Bevorzugung schaffen und erhalten, oder wir gestehen es uns nicht ein. Weißsein beim Namen zu nennen, womöglich sogar festzustellen, dass es von Bedeutung ist und unverdiente Vorteile mit sich bringt, ist daher zutiefst verstörend, destabilisierend und löst die Schutzreaktionen der weißen Fragilität aus.