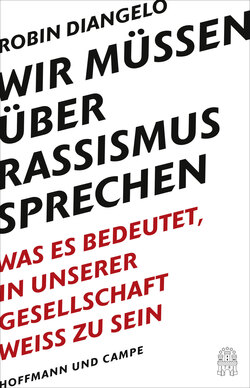Читать книгу Wir müssen über Rassismus sprechen - Robin J. DiAngelo - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Wahrnehmung von »Rasse«
Оглавление»Rasse« ist eine sich entwickelnde gesellschaftliche Idee, geschaffen, um Ungleichheit zu legitimieren und die Privilegien Weißer zu schützen. Der Begriff »weiß« tauchte im Kolonialrecht erstmals im ausgehenden 17. Jahrhundert auf. Bei der Volkszählung in den Vereinigten Staaten 1790 wurde die Bevölkerung aufgefordert, ihre »Rasse« anzugeben, und 1825 bestimmte der vermeintliche Blutsanteil, ob jemand als Indianer eingestuft wurde. Ab dem späten 19. Jahrhundert und im Laufe des 20. Jahrhunderts, als viele Einwanderer in die USA strömten, verfestigte sich das Konzept einer weißen »Rasse«.[10]
Als 1865 die Sklaverei in den Vereinigten Staaten abgeschafft wurde, blieb Weißsein weiterhin von grundlegender Bedeutung, da die legalisierte rassistische Ausgrenzung von und die Gewalt gegen Afroamerikaner sich in neuen Formen fortsetzte. Um die Staatsbürgerschaft und die damit verbundenen Bürgerrechte zu bekommen, musste man rechtsgültig als weiß klassifiziert worden sein. Menschen, die als nicht weiß eingestuft waren, begannen, gerichtlich eine Änderung ihres Status zu beantragen. Nun lag die Entscheidung, wer als weiß galt und wer nicht, bei den Gerichten. So gewannen Armenier ihre Klage auf Einstufung als Weiße mit Hilfe eines wissenschaftlichen Gutachters, der ihnen bescheinigte, wissenschaftlich seien sie »Kaukasier«. Der Oberste Gerichtshof der USA urteilte 1922, Japaner könnten rechtlich nicht als weiß eingestuft werden, weil sie wissenschaftlich als »Mongoliden« klassifiziert seien. Ein Jahr später entschied das Gericht, dass Inder rechtlich nicht weiß seien, obwohl sie wissenschaftlich zu den »Kaukasiern« zählten. Zur Rechtfertigung dieser widersprüchlichen Urteile stellte es fest, dass Weißsein auf dem gängigen Verständnis des weißen Mannes beruhe. Mit anderen Worten: Menschen, die bereits als weiß galten, entschieden darüber, wer weiß war.[11]
Das Bild der Vereinigten Staaten als großem Schmelztiegel, in dem Einwanderer aus der ganzen Welt zusammenkommen und durch Assimilation zu einer einheitlichen Gesellschaft verschmelzen, ist ein Mythos. Eine schöne Idee: Sobald neue Zuwanderer Englisch lernen und sich an amerikanische Kultur und Sitten anpassen, werden sie Amerikaner. Doch in Wirklichkeit war es im 19. und 20. Jahrhundert nur europäischen Immigranten möglich, sich in die herrschende Kultur zu integrieren oder zu assimilieren, weil sie, ungeachtet ihrer ethnischen Identität, als weiß galten und somit dazugehören konnten.
»Rasse« ist ein gesellschaftliches Konstrukt, daher ändert es sich im Laufe der Zeit, wer der Kategorie der Weißen zugerechnet wird. Wie der Amerikaner italienischer Abstammung in meinem Workshop anmerkte, waren europäische ethnische Gruppen wie Iren, Italiener und Polen früher davon ausgeschlossen. Aber auch wenn europäische Einwanderer ursprünglich nach ihrer Herkunft getrennt waren, wuchsen sie durch Assimilation zu einer »Rasse« zusammen.[12] Dieser Assimilationsprozess – Englisch sprechen, »amerikanische« Speisen essen, eigentümliche Sitten ablegen – machte die Wahrnehmung der Amerikaner als Weiße zu etwas Konkretem. Die Rassenidentifikation in der umfassenderen Gesellschaft spielt eine grundlegende Rolle in der Identitätsentwicklung und in unserem Selbstverständnis.
Wenn wir »weiß aussehen«, werden wir in der Gesellschaft als Weiße behandelt. So haben Menschen südeuropäischer Abstammung wie Spanier und Portugiesen oder Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion wahrscheinlich eine stärker ausgeprägte ethnische Identität, besonders wenn sie erst kürzlich eingewandert sind oder von Einwanderern aufgezogen wurden, als Angehörige der gleichen ethnischen Gruppe, deren Vorfahren schon seit Generationen im Land sind. Doch obwohl ihre innere Identität eine andere sein mag, ist ihre äußere Erfahrung die von Weißen, so sie denn als weiß »durchgehen«. Wenn sie weiß aussehen, wird man in der Regel annehmen, dass sie weiß sind und entsprechend auf sie reagieren. Stimmt bei Personen die innere ethnische Identität (portugiesisch, spanisch) nicht mit der äußeren Rassenerfahrung (weiß) überein, so dürften sie ein komplexeres oder nuancierteres Identitätsgefühl haben als Menschen, die keine ausgeprägte ethnische Identität besitzen. Dennoch gewährt man ihnen den Status von Weißen und die damit verbundenen Vorteile. Heutzutage sind diese Privilegien eher praktischer als rechtlicher Natur, haben aber dennoch starken Einfluss auf unser Alltagsleben. Alle, die als weiß gelten, müssen selbst herausfinden, wie diese Vorteile sie prägen, statt sie in Bausch und Bogen zu leugnen.
Da »Rasse« ein Produkt gesellschaftlicher Kräfte ist, hat sie sich auch nach Schichtzugehörigkeit manifestiert. Arme Bevölkerungsschichten und Arbeiter wurden nicht immer als vollgültige Weiße anerkannt.[13] In einer Gesellschaft, die als nicht weiß geltenden Menschen weniger Chancen bietet, sind wirtschaftliche und rassistische Kräfte untrennbar miteinander verknüpft. Allerdings erhielten arme Weiße und weiße Angehörige der Arbeiterklasse schließlich vollen Zugang zum Weißsein. Denn wenn sie ein Überlegenheitsgefühl gegenüber ausgebeuteten Nichtweißen entwickeln konnten, richtete sich ihr Unmut weniger auf die über ihnen Stehenden. Arme und Arbeiter, die sich über Rassenschranken hinweg zusammengeschlossen hätten, wären eine starke Macht gewesen. Aber die Rassentrennung trug dazu bei, sie davon abzuhalten, dass sie sich gegen die besitzende Klasse organisierten.[14] Was weiße Arbeiter erleben ist »Klassismus«, also eine Diskriminierung aufgrund ihrer sozialen Stellung, aber nicht zudem noch Rassismus. Ich bin in armen Verhältnissen aufgewachsen und empfand tiefe Scham über diese Armut. Dennoch wusste ich immer, dass ich weiß war und dass weiß zu sein besser war.