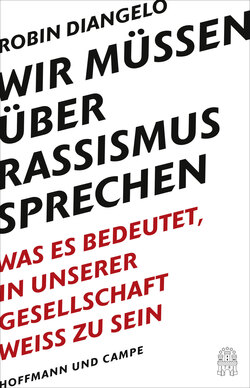Читать книгу Wir müssen über Rassismus sprechen - Robin J. DiAngelo - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort zur deutschen Ausgabe
ОглавлениеAls ich in den neunziger Jahren Diversity-Trainings in den Vereinigten Staaten leitete, fiel mir zum ersten Mal ein Verhaltensmuster auf, das ich seither »weiße Fragilität« (White Fragility) nenne. In einem 2011 veröffentlichten Fachartikel beschrieb ich dieses Muster und entwickelte eine Theorie zu seiner Entstehungs- und Funktionsweise. Der Artikel fand große Beachtung, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Von außerhalb der Vereinigten Staaten bekam ich E-Mails von Menschen of Color, die mir schrieben, ich habe genau die Erfahrungen geschildert, die sie bei ihren Versuchen gemacht hätten, mit weißen Menschen über Rassismus zu sprechen, und sie drängten mich, den Artikel in ihrer Landessprache zu veröffentlichen. »Bitte«, schrieben viele, »kommen Sie her und helfen Sie uns, diese weißen Menschen aufzuklären.«
White Supremacy (»weiße Suprematie«), also der Glaube an die vermeintlich naturgegebene Überlegenheit weißer Menschen, ist eine relativ neue Vorstellung, die sich in den Vereinigten Staaten als Rechtfertigung für die Versklavung verschleppter Afrikaner entwickelt hat (siehe Kapitel 2). Aber heutzutage zirkuliert diese Ideologie weltweit und hat globale Auswirkungen (allein schon der Konsum amerikanischer Spielfilme und Medien verbreitet tendenziöse Rassenvorstellungen). Die spezifische Geschichte mag von Land zu Land variieren, aber das Ergebnis ist immer das gleiche: institutionalisierte Vorherrschaft und Vorteile weißer Menschen, die mit typischer Empfindlichkeit reagieren, wenn beides benannt oder infrage gestellt wird.
Inzwischen habe ich meine Arbeit in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Südafrika vorgestellt. Ich stelle Recherchen an, bevor ich sie präsentiere, um kleine Anpassungen vorzunehmen, welche Gruppen diesem Problem am stärksten ausgesetzt sind (z.B. Aborigines in Australien, Angehörige indigener Völker in Kanada, schwarze Menschen in Südafrika) und welche Erzählungen am populärsten sind, um diese Stoßrichtung des weißen Suprematismus abzustreiten (»Apartheid ist seit fünfundzwanzig Jahren vorbei! Heute bestimmen Schwarze alles!«). Aber der Rahmen ist überall derselbe. Manche weißen Menschen räumen zwar ein, dass ihnen diese Dynamiken vertraut sind, aber viele leugnen sie. »Rassismus ist ein amerikanisches Problem. Hier haben wir keinen Rassismus«, heißt es immer wieder. Dagegen reagieren die meisten Menschen of Color in diesen unterschiedlichen Umfeldern erleichtert, wenn eine weiße Person die Empfindlichkeit der Weißen beim Namen nennt und die Rassismuserfahrungen der Betroffenen anerkennt. Dass Weiße die rassistisch geprägten Realitäten leugnen, die Menschen of Color schildern, ist ein Muster, das außerhalb der Vereinigten Staaten ebenso zu finden ist wie in den USA. In Wirklichkeit gilt, je weniger über Rassismus gesprochen wird, umso tiefer gründet das Verhalten, das Weiße empfindlich auf Rassismusdebatten reagieren lässt.
Dass Weiße ihren Rassismus und ihre Privilegien verleugnen, beruht auf diversen dünkelhaften Vorstellungen über das Weißsein (die in diesem Buch eingehend erörtert werden): Individualismus; Exzeptionalismus; Anspruch auf die Komfortzone, die mit der Zugehörigkeit zur weißen »Rasse« einhergeht; Rassismus als deren Problem zu sehen und jegliches Hinarbeiten auf Rassengerechtigkeit den Menschen of Color aufzubürden. Angesichts dieser selbstgefälligen Einstellungen fordere ich deutsche Leser und Leserinnen in zweierlei Hinsicht zum Handeln auf. Erstens: In Deutschland manifestiert sich tatsächlich Rassismus, und zwangsläufig sind die Menschen dort von dessen Kräften geprägt. Sich nicht bewusst zu sein, wie Rassismus im eigenen Umfeld am Werk ist, heißt keineswegs, dass es ihn dort nicht gibt. Nur wer von der Prämisse ausgeht, dass Rassismus in Deutschland eine Realität ist, kann daran arbeiten, ihn zu erkennen und zu begreifen. Zweitens: Brechen Sie aus der Gleichgültigkeit gegenüber den Privilegien Weißer und aus der damit verbundenen Komfortzone aus und engagieren Sie sich. Sie kennen Ihr eigenes Umfeld viel besser ich. Nehmen Sie die nötigen Anpassungen vor und ersetzen Sie beispielsweise »Afroamerikaner« durch »Migranten«, aber nehmen Sie den allgemeinen Rahmen, den ich hier darlege, und fragen Sie nicht: »Trifft er hier zu?«, sondern: »Wie trifft er hier zu?« Das verlagert die Verantwortung und eröffnet die Möglichkeit zu einem Handeln, das uns einer für alle Bevölkerungsgruppen gerechten Gesellschaft näher bringt. Wenn wir uns weigern, das Problem auch nur zu sehen, können wir es nicht angehen.