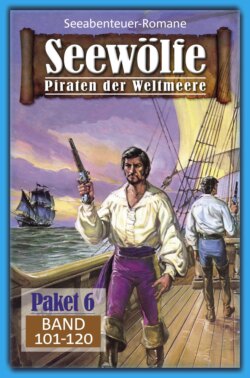Читать книгу Seewölfe Paket 6 - Roy Palmer - Страница 12
8.
ОглавлениеIm Morgengrauen erreichte Sabreras die Küste. Das Ufer war felsig und steil, wie drohend ragten die wuchtigen Steinmauern in den Himmel.
Er hatte ausreichend zu essen und zu trinken, eine Waffe und Munition, und allein die prunkvolle Krone der Chibcha-Indianer machte ihn zu einem beneidenswert reichen Mann. Nur eins fehlte ihm an Bord des einmastigen Bootes: die Navigationsinstrumente.
Er wußte nicht, wo er war. In der Nähe von Panama auf keinen Fall, dachte er, dort wäre ich frühestens am Abend des heutigen Tages gelandet.
Andererseits war er aber sicher, das Festland vor sich zu haben, keine Insel. Er konnte es sich nur so erklären: Er war weiter nach Norden abgetrieben worden, als er dachte. Jetzt befand er sich westlich von Punta Mariato oder gar im Golf von Chiriqui – oder möglicherweise noch weiter westlich versetzt.
„Wie auch immer“, sagte er leise. „Es hat keinen Zweck, Panama mit dem Boot erreichen zu wollen. Ich muß landen und mich dann nach Osten wenden. Killigrew und Siri-Tong – das alles werdet ihr mir büßen. De Vargas, Mangusto und alle anderen von der ‚Esperanza‘ – ich werde euch hetzen lassen wie tolle Hunde.“
Als er dicht unter Land war, mußte er aufpassen, nicht von den Brandungswellen erfaßt und gegen die Felsen geworfen zu werden. Das Boot wäre zertrümmert worden.
So lavierte er hart am Ufer entlang und forschte nach einem Landeplatz. Aber seine Bemühungen fruchteten nichts. Das Felsenland war schroff und abweisend, es wollte ihn nicht. Nirgends gab es den schmalsten Einlaß, es war wie verhext.
Die Sonne kletterte höher und gewann an Macht. Ihre Strahlen setzten ihm zu und trieben, ihm den Schweiß aufs Gesicht und auf den Leib. Er begann zu fluchen. War denn alles gegen ihn?
Er spielte schon mit dem Gedanken, nur das Notdürftigste an seinem Gurt festzuschnallen, ins Wasser zu springen und das Boot aufzugeben. Nur eine Überlegung hielt ihn davon ab. Wenn er am Ufer war, was sollte er dann tun? Klettern? Die Wände waren zu steil, und er hatte keine Übung als Bergsteiger. An den Klippfelsen entlangstolpern also? So war er jedem, der von See aus auftauchte, schutz- und deckungslos ausgeliefert.
Und es bestand ja immer noch die Möglichkeit, daß der Seewolf, dieser hartnäckigste aller englischen Korsaren, nach ihm suchte.
Endlich fand er einen Landeplatz.
Ein kegelförmiger Einlaß, den man leicht übersehen konnte, öffnete sich zu einer Grotte hin. Sabreras steuerte vorsichtig darauf zu, nahm die Segel und schließlich sogar den Mast weg, damit er hineinkonnte.
Dann schob er sich mit dem Boot in das Innerste der Wasserkaverne.
Ein bläulicher Lichtschimmer empfing ihn. Hier schwappte und schmatzte das Wasser hohl und widerhallend wie ein fremdartiges Element. Staunend blickte der Kommandant sich um. Je weiter er geriet, desto intensiver wurde das Blau. Hoch schob sich die Grotte empor, er konnte kaum ihre Decke erkennen. Er befand sich in einem regelrechten Felsentempel. Etwas Unheimliches, Beängstigendes haftete dem Platz an.
Einen Ausgang zum Land hin schien es nicht zu geben.
Enttäuscht wollte Sabreras wieder umkehren. Welchen Zweck hatte es, wenn er hier festmachte? Er griff zu den Riemen. Plötzlich hatte er es eilig, wieder das offene Wasser zu erreichen.
Aber da wandte er noch einmal den Kopf und schaute nach links. In dem blauen Schillern des Gesteins war doch eine Unterbrechung. Ein Gebilde, das zu untersuchen sich gewiß lohnte.
Und noch etwas veranlaßte ihn zum Bleiben. Als er sich umdrehte und durch die spitzkegelige Passage spähte, gewahrte er weit draußen auf See zwei Erscheinungen.
Erscheinungen? Er verharrte nur ein paar Minuten und erkannte dann, daß es sich um große Segler handelte. Er hatte ein Spektiv bei sich, das nahm er jetzt zur Hand und hob es ans Auge.
„Madre de Dios“, flüsterte er. „Das sind ja – die ‚Isabella‘ des Seewolfs und das schwarze Schiff der Roten Korsarin! Ihr verfluchtes Pack, die Pest und die Pocken sollen euch dahinraffen!“
Wie sie ihm hatten folgen können, war ihm nicht klar, aber unbewußt begriff er, daß auch dieser Umstand mit den Meuterern von der „Esperanza“ zu tun hatte. Doch er sann nicht weiter darüber nach.
„Wichtig ist nur eins“, sagte er sich. „Daß du so schnell wie möglich in den Felsen aufsteigst und dich zum Binnenland hin absetzt!“
Er pullte das Boot zu dem schmalen Streifen Kieselstrand, der sich in dem blauen Licht abzeichnete. Knirschend schob sich der Rumpf darauf. Noch ein Blick aufs Meer, und er stellte fest, daß die Umrisse der Schiffe an der westlichen Kimm schon wesentlich größer geworden waren. Sie fuhren unter voller Besegelung und hatten den Wind raumschots.
Er raffte seine Habseligkeiten zusammen – den Jutesack mit der Krone der Chibchas und dem anderen Smaragdschmuck, den er aus der Mine gerettet hatte, die Ledermappe mit den wichtigen Dokumenten für den Gouverneur von Panama, Proviant, den letzten Schlauch mit Trinkwasser sowie Munition für die Radschloßpistole.
So hastete er auf das zu, was er vorher als „Gebilde“ im Gestein identifiziert hatte. Und tatsächlich, es entpuppte sich als Einstieg. Eine richtige Treppe führte auf verschlungenem Weg aus der blauen Grotte nach oben.
Er stieg sie hoch. Wer hatte diese Stufen in den Felsen gehauen? Die Grotte mochte in Jahrtausenden oder Jahrmillionen vom Seewasser in die Klippen gewaschen worden sein, und vielleicht rührte auch das eigenartige blaue Licht von einem Naturphänomen her. Sabreras hatte davon gehört, daß solche Effekte entstanden, wenn Sonnenstrahlen sich in mineralischen Formationen brachen. Aber diese Treppe konnte nur Menschenhand geschaffen haben.
Indianer vielleicht.
Es gab Hunderte von alten Kulturen in diesem Kontinent. Die Mayas, Azteken, Cuna, Chibcha, Inkas waren nur einige von ihnen gewesen. Wenn aber wirklich Rothäute diesen Ausstieg in die oberen Felsenregionen gehauen hatten, dann war es eine Ironie, denn ausgerechnet ihm, Sabreras, dem India-nerhasser, retteten sie jetzt das Leben.
Er mußte darüber lachen.
Sein Lachen hallte von den Wänden wider, es klang unheimlich. Der Ort schien verwunschen zu sein. Selbst das Tappen seiner Stiefelsohlen auf den Stufen klang ungewöhnlich hell und fast absonderlich.
Beirren ließ er sich aber nicht. Als er das ungebrochene Sonnenlicht über sich sah, kicherte er vor Freude. Die seltsame Wendeltreppe war zu Ende. Er stürmte die letzten Stufen hoch und taumelte ins Freie.
Er befand sich jetzt hoch über der See. Wind zerzauste seine Haare und zerrte an seiner Kleidung. Die „Isabella“ und den schwarzen Segler konnte er von hier aus nicht sehen, weil er schon zu viele Felsen im Blickfeld hatte, aber er kümmerte sich auch nicht mehr um die Gegner. Ohne noch einen Gedanken an sie zu verschwenden, wandte er sich landeinwärts.
Bis zur nächsten spanischen Siedlung wollte er sich durchschlagen. Dann würde er mit einer Kutsche bis nach Panama weiterreisen und dort dem Gouverneur seine ungeheuerliche, ja, haarsträubende Geschichte vortragen.
Sabreras, dir kann keiner mehr am Zeuge flicken, sagte er sich. Du bist von den wüstesten Feinden überfallen worden, die Spanien hat. Du hast gekämpft und verloren. Das kann dir keiner ankreiden. Schon ganz andere Verbände sind vom Seewolf und dessen Verbündeten geschlagen worden.
Dann hat auch noch deine Schiffsbesatzung gemeutert, spann er den Faden weiter, und du hast somit das Recht auf deiner Seite. Wer will denn dem Gouverneur erzählen, du hättest heimlich in die eigene Tasche gewirtschaftet? Der Seewolf vielleicht? Dem glaubt kein Spanier. De Vargas, Mangusto, der Sargento? Wenn sie es versuchen, kommen sie damit nicht durch. Niemals. Aussage steht gegen Aussage, und mein Wort zählt mehr als das dieser räudigen Hunde.
Er war so in seine Überlegungen verstrickt, daß er nicht mehr bemerkte, was um ihn herum vorging.
De Vargas könnte ich in einem Prozeß auch leicht auf meine Seite reißen, sagte er sich. Er ist wankelmütig. Wenn es hart auf hart geht, fällt er um und bekennt sich zu mir.
Er schritt über eine Geröllhalde in eine dunkle, geduckte Schlucht hinunter. Die Marschrichtung lag fest, und es schien keine großen Hindernisse zu geben, zumal das Land allmählich nach Norden hin abfiel und das Wandern ihm von Meile zu Meile leichter fallen würde.
Endlich, dachte er, endlich habe ich das Glück wieder auf meiner Seite. Den Smaragdschmuck werde ich irgendwo verstecken. Nur ich kenne den Platz. Dann kehre ich zurück und hole mir, was mein ist …
Sabreras sah nicht, wie rechts oben am Schluchtrand die Umrisse eines menschlichen Kopfes erschienen. Erstens fühlte er sich bereits zu sicher, und das war ein klarer Fehler. Zweitens war die Bewegung hinter ihm, und auch bei größerer Aufmerksamkeit hätte er sie deshalb wohl nicht zur Kenntnis genommen.
Etwas huschte von schräg hinten auf ihn zu.
Diesmal konstatierte er, daß etwas nicht in Ordnung war. Er wandte sich um und fand gerade noch Zeit, den Mund zu öffnen. Der entsetzte Ruf, den er ausstoßen wollte, blieb ihm in der Kehle stecken.
Ein Stein traf seine Stirn.
Lautlos sank er zu Boden.
Alles ging in bodenloser, erstickender Finsternis unter.
In jener Sphäre war es erträglicher zugegangen als im Diesseits. Das Bewußtsein breitete sich mit hämmernden Schmerzen in ihm aus, ihm war speiübel, und er glaubte, sich übergeben zu müssen.
Und dann dieses Gelächter über ihm! Es schien geradewegs aus der Hölle zu ertönen.
„Paßt auf, daß er nicht einfach aufsteht und wegläuft, Männer“, sagte jemand auf spanisch. „Seiner Montur nach ist er ein hoher Offizier, wahrscheinlich ein Kommandant, und er wird vielleicht versuchen, durch einen Trick zu entwischen.“ Die Stimme klang rauh und im tiefsten Baß, aber Sabreras hörte doch an seinem Akzent, daß er ein reinblütiger Katalane war.
Ein zweiter Sprecher wollte sich über diese Worte vor Lachen ausschütten. Er prustete: „Das wäre die Spitze, jawohl, das Allergrößte, Almirante. Sag jetzt bloß noch, dieser Bastard sei nicht auf den Kopf gefallen.“
„So ein fauler Witz“, erwiderte Almirante. „So hart hat er sich den Schädel nicht gestoßen, Julian. Halt jetzt dein verdammtes Maul.“
„Ich finde das alles so herrlich komisch!“ Der Mann, der Julian hieß, kicherte.
„Julian hat zuviel Schnaps gesoffen“, bemerkte ein dritter.
„Dir renke ich den Arm aus“, drohte Julian zischend.
„Schweigt!“ fuhr Almirante sie an. „Seht euch lieber den Kerl an. Da, er hat sich bewegt!“
„Was ist, schlagen wir ihn nicht tot?“ fragte der mit Julian Angesprochene.
„Nein, wir warten noch.“
„Warum?“
„Narr“, sagte Almirante. „Ich vermute, daß er weiß, wo noch mehr von diesem phantastischen Zeug liegt. Vielleicht werden wir Esmeralderos, Smaragdsucher. Wir werden ihn ausquetschen wie eine Zitrone, Julian.“
„Jetzt kapiere ich.“
„Das ist ja ein Wunder“, meinte ein vierter Kerl, und auch er handelte sich eine gezischte Drohung von Julian ein. Sie warfen sich ein paar Verwünschungen zu, die so ziemlich das Unflätigste und Gemeinste waren, das Sabreras je vernommen hatte.
Sabreras schlug die Augen auf und sah sie. Wüste Kerle mit schmutzigen Gesichtern und wirren, verfilzten Haaren – er zählte mehr als ein Dutzend. Ja, es schienen zwanzig zu sein. Wegelagerer, Totschläger. Die niederste Sorte Menschen, so fand Sabreras insgeheim – und ausgerechnet ihnen hatte er in die Hände fallen müssen.
Ein Kerl mit dichtem schwarzem Vollbart verbeugte sich hohnvoll vor ihm. Das Bartgestrüpp reichte ihm bis auf die Brust. An seiner Stimme erkannte Sabreras, daß er Almirante war.
„Hochwohlgeboren“, sagte er. „Wollen Sie uns nicht Ihren werten Namen anvertrauen?“
Die Männer in seinem Rücken kicherten und stießen sich mit den Ellenbogen an.
Almirante hielt Sabreras Messer, die Radschloßpistole – und die Smaragdkrone der Chibchas. Demonstrativ ließ er sie dicht vor seinem Gesicht pendeln. „Du hüllst dich in Schweigen?“ fragte er drohend. „Das fängt ja gut an. Ich habe Angst, du könntest ernsthaft erkranken, mein Freund.“
Ein kleiner, drahtiger Mann mit buschigen Augenbrauen und breitem, schmallippigem Mund begann wieder loszuprusten.
„Julian, muß ich dir das Maul stopfen?“ stieß Almirante grollend hervor.
Julian verstummte, und der Bandenführer richtete seinen Blick wieder auf den Gefangenen. „Soll ich dir einen Tritt in deinen edlen Hintern verpassen, du Himmelhund?“
„Nein.“ Der Kommandant schaute ihm fest in die Augen. „Mein Name ist Sabreras. Ich will alles sagen, was ich weiß, ich habe wohl keine andere Wahl.“
„Sehr vernünftig“, erwiderte Almirante. Er rieb sich den Bauch. Er war ein großer, beleibter Mensch, aber das täuschte nicht über seine Gefährlichkeit hinweg.
Sabreras setzte sich auf, obwohl es ganz gemein in seinem Kopf schmerzte. Er kämpfte mit aller Macht gegen die Qual an. Mit zwei Fingern befühlte er die Beule auf seiner Stirn, zog die Hand aber sofort wieder zurück. Bei der geringsten Berührung durchzuckte es ihn an dieser Stelle wie Nadelstiche.
Er überlegte sich genau, was er zu sagen hatte. Unvermittelt war ihm eine großartige Idee eingefallen. Sie stand in direktem Zusammenhang mit der Tatsache, daß er nicht nur eine, sondern noch zwei andere, größere Horden von Männern auf den Fersen hatte.
„Almirante“, sagte er eindringlich. „Ich bin ein spanischer Kommandant, wie du ja schon festgestellt hast. Aber auch du scheinst mehr zu sein als ein primitiver Strandräuber. Wie kann ein stolzer Katalane sich selbst so herabwürdigen?“
„Gib acht“, warnte Almirante. „Ich kann sehr leicht aus der Haut fahren.“
„Ich spreche ja nur in deinem, Interesse.“
„In meinem Interesse?“ Der Bandit lachte. „Das mußt du mir noch genauer erklären. Also gut, ich war Bootsmann auf einem Schiff Seiner Allerkatholischsten Majestät, Philipp II. Aber ich und die meisten meiner Männer haben gemeutert und sind abgehauen, verstehst du? Das war vor fast zwei Jahren. Bislang haben uns die lieben Landsleute noch nicht wieder eingefangen, und wenn du glaubst, du könntest uns durch eine List an den Gouverneur ausliefern, dann hast du dich gründlich getäuscht – ist es so, Julian?“
„Ja“, sagte Julian gedehnt und mit hämischem Grinsen. Er schien so etwas wie die rechte Hand von Almirante zu sein.
Vom Regen in die Traufe, dachte Sabreras, aber ich muß das Beste daraus machen. Laut erwiderte er: „Du bist auf dem Holzweg, Almirante. Ich bin selbst ein Verfolgter, ein Desperado, ein Verzweifelter, wenn du so willst. Die Smaragdkrone, die du mir abgenommen hast, ist eine Million spanischer Piaster wert, vielleicht auch noch mehr. Aber sie ist nur ein Teil der Ausbeute einer Mine in Neu-Granada.“
„Von dort unten her kommst du?“ Almirante warf einen Blick auf die Geheimdokumente aus der Ledermappe. Julian hatte sie ihm gereicht. Nach kurzem, hastigen Studieren erklärte Almirante: „Wie gut, daß ich lesen kann, Amigo. Ja, hier wird bestätigt, was du eben gesagt hast. Du wirst uns also zu deiner Mine führen.“
Sabreras schüttelte den Kopf. „Sie ist von Piraten ausgeplündert worden.“ Er berichtete in knappen Zügen, was sich zugetragen hatte. Zum Abschluß sagte er: „Auf den beiden Schiffen, die sich gerade der Küste nähern, lagern haufenweise Smaragde und Smaragdschmuck. Für euch lohnt es sich wirklich nicht, wenn ihr mich totschlagt. Ich schlage euch etwas anderes vor. Verbünden wir uns. Ich habe auch schon einen Plan, wie wir den Seewolf, das schwarzhaarige Weib und deren Gesindel erledigen können.“
Almirante starrte sein Gegenüber mit offenem Mund an. Seine Augen waren verklärt, sein Blick entrückt. Dann nickte er.