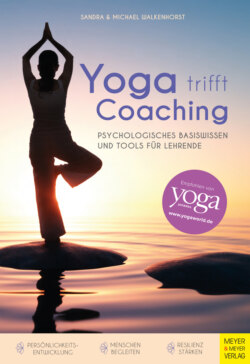Читать книгу Yoga trifft Coaching - Sandra Walkenhorst - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.3Bewusst oder unbewusst – das ist hier die Frage
ОглавлениеWenn wir uns auf den Weg machen, unser Selbst zu ergründen und uns näher kennenzulernen, dann macht es durchaus Sinn, ein wenig über unsere Physiologie zu wissen, genau genommen über unser Gehirn. Gerald Hüther (2010), einer der bekanntesten Hirnforscher in unserem Land, beschreibt es relativ simpel: Unser Gehirn möchte sich in einem kohärenten Zustand befinden. Das bedeutet, dass es möglichst wenig Energie aufwenden muss. Das ist mit ein Grund dafür, dass ein Großteil unsere Handlungen unbewusst abläuft. In einem Gespräch mit dem Magazin Focus nennt Hüther zwei einfache Fragen, wie wir unser Selbst entdecken und sozusagen Herr über unser Gehirn werden:
•Was will ich für ein Mensch sein?
•Wozu will ich dieses Leben nutzen?
(https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/gerald-huether-im-gespraechhirnforscher-entwickelt-gluecksformel-dafuer-muss-sich-jeder-zwei-fragen-stellen_id_10201786.html)
Zwei Fragen, die uns auch in der Yogaphilosophie beschäftigen und sich ebenfalls wunderbar in die Arbeit mit Menschen integrieren lassen. Doch wie werden wir zu dem Menschen, der wir sind und was hat das mit unserem Gehirn zu tun?
Der Neurowissenschaftler und Psychotherapeut Joachim Bauer (2019) schreibt in seinem Buch Wie wir werden, wer wir sind: „Der Mensch ist aus neurowissenschaftlicher Sicht dafür gemacht, am Du zum Ich zu werden“ (S. 36). Bauer geht davon aus, dass sich unser Selbst entwickelt, indem wir in Resonanz mit unseren Bezugspersonen treten. Kinder brauchen verlässliche, liebevolle Bindungspartner, die sie nicht einengen und sie somit fördern, ihr Selbst zu entwickeln.
Autonomie kann nur aus einer sicheren Bindung hervorgehen, das haben bereits etliche Wissenschaftler zu Bindungstheorien gezeigt. Wir Menschen sind kreative Wesen, die in der Lage sind, sich einerseits anzupassen, aber auch ihr Umfeld zu gestalten und zu verändern. Für diese Kreativität benötigen wir Menschen, die uns ermutigen, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. So wie wir im Yoga Umkehrhaltungen üben, die uns anregen können, auch jenseits der Matte einmal die Perspektive zu ändern.
Ein Grund, warum Yoga auch schon für die Kleinsten eine gute Methode sein kann, um sich auf allen Ebenen zu entfalten. Bauer schreibt: „Kinder sind körperbetonte Wesen und bedürfen vieler guter körperlicher Erfahrungen, sie bedürfen unserer realen Präsenz“ (S. 46). Hier kommt auch das Thema Berührung ins Spiel, dem ich in meiner Arbeit mit Thai-Kinderyoga bereits ein Buch gewidmet habe.
Doch zurück zu unserem Gehirn. Wir erfuhren bereits, dass unser Gehirn danach strebt, in einem möglichst kohärenten Zustand zu sein. Es möchte also möglichst viel Nutzen mit einem möglichst geringen Energieaufwand erreichen. Wenn wir uns nun in einem Konflikt befinden, in welchen z. B. eines unserer Bedürfnisse nicht gesehen oder gar erfüllt wird, geht im Gehirn tatsächlich ganz schön viel ab, es braucht viel Energie, um mit dieser Situation irgendwie umzugehen. Möglicherweise passiert dann im Kindesalter Folgendes: Um wieder Kohärenz herzustellen, adaptiert das Kind das Verhalten seiner Bezugspersonen und macht sein eigenes Bedürfnis weg, will heißen, wir suchen nach einer Lösung, um diese Herausforderung meistern zu können.
Im „blödesten“ Fall haben wir unser Bedürfnis als nicht richtig wahrgenommen, weil es möglicherweise eine Belohnung dafür gibt, dass wir, gemäß den Erwartungen anderer, reagiert haben. Denn wir alle wollen das Gleiche: Wir wollen geliebt sein und dazugehören. Wir wollen aber auch Autonomie und das kann bisweilen zu einem Konflikt führen, vor allem, wenn unsere Bindungspartner dies nicht sehen und unterstützen. Also gar nicht so leicht, die Entwicklung eines gesunden Selbst.
Hat sich dann eine Gewohnheit erst einmal ausgebildet, so hat dadurch unser Gehirn mehr Kapazität für andere Aktivitäten frei. Dies entspricht wieder Hüthers Aussage, dass unser Gehirn immer bestrebt ist, Kohärenz herzustellen. Das kann man sich so vorstellen, dass sich bei Gewohnheiten oder alltäglichen Tätigkeiten weite Bereiche unseres Gehirns ausruhen können. Es läuft quasi eine Art Automatismus ab.
Ein gutes Beispiel ist das Autofahren. Waren wir in den ersten Fahrstunden noch heillos mit dem ganzen Tun (Kupplung-Gas, Schalten, Schulterblick beim Abbiegen etc.) überfordert, so werden die Tätigkeiten zur „Gewohnheit“ und wir haben den Kopf frei für den Straßenverkehr. Ebenfalls waren und sind manche Gewohnheiten für uns schlichtweg wichtig für unser Überleben.
Da Gewohnheiten in der Tiefe unseres Gehirns (in den sogenannten Basalganglien) gesteuert werden, verschwinden sie auch niemals einfach von selbst. Das ist, vor allem im Sinne der Kohärenz prima, stellt uns aber auch vor die Herausforderung, dass es nicht so leicht ist, alte Gewohnheiten zu verändern.
Eine weitere Schwierigkeit ist, dass unser Gehirn leider nicht zwischen günstigen und ungünstigen Gewohnheiten unterscheidet. Ebenso überprüft und modifiziert es diese nicht mehr. Gewohnheiten entstehen zwar ohne Beteiligung des Bewusstseins, doch die gute Nachricht ist: sie lassen sich durch eine bewusste Entscheidung verändern.
Zu verstehen, wie Gewohnheiten entstehen und funktionieren, bietet für den Weg, wie auch Patanjali ihn beschreibt, eine gute Grundlage und macht deutlich, wie nah sich doch die östliche Philosophie und die westliche Wissenschaft sind!
Die Einsicht, dass viele Dinge unbewusst ablaufen, wir sie uns aber bewusst machen können und somit auch Veränderung stattfinden kann, ist und war für mich eine wichtige Erkenntnis!