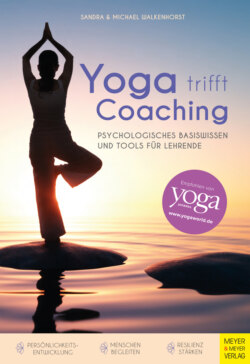Читать книгу Yoga trifft Coaching - Sandra Walkenhorst - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSvadhyaya ist das Selbststudium oder auch die Selbstreflexion, so wie das Studium von Weisheitstexten. Es ist eine der fünf Niyamas (im Groben die Verhaltensempfehlungen uns selbst gegenüber). Doch was bedeutet Selbststudium und/oder Selbstreflexion?
Vielleicht ist es hilfreich, mit folgender Frage zu beginnen:
•Welcher Yogalehrer möchtest du sein?
Hast du dir diese Frage schon einmal gestellt? Wenn ja, war es einfach, darauf zu antworten? Es macht Sinn, sich einmal genau mit solch einer Frage (warum man etwas tun oder sein möchte) auseinanderzusetzen. Das geht zum Beispiel auch während einer Meditation. Oder du nimmst dir Papier und Stift und schreibst deine Antwort auf.
Möglicherweise fallen dir Dinge ein, wie: „Ich möchte anderen Menschen helfen“ oder: „Mir hat Yoga geholfen und nun möchte ich das weitergeben“ oder Ähnliches. Das sind natürlich schöne Beweggründe und es ist wahrhaft großmütig, für andere etwas zu tun. Aber das ist höchstwahrscheinlich (um nicht zu sagen ziemlich sicher) nicht der einzige Beweggrund.
•Warum tust du, was du tust?
•Was hast du für einen Gewinn davon?
Das sind die Fragen, die wir uns nicht immer so gerne stellen, möchten wir in der Regel doch nicht egoistisch sein. Natürlich klingt es immer besser, Dinge uneigennützig zu tun. Doch wenn wir wirklich ehrlich sind (und im Übrigen bestätigt das auch die Hirnforschung), tun wir so gut wie nie etwas ohne Eigennutz. Und, zu deiner (und auch meiner) Erleichterung sei gesagt: Das ist auch okay so. Das ist absolut menschlich!
Wenn wir also unser Selbst reflektieren wollen und uns studieren wollen, dann gehören schon mal zwei Dinge dazu: Ehrlichkeit und Mut! Ehrlich auch seine Schatten oder die vermeintlich negativen Verhaltensweisen anzuschauen und den Mut, überhaupt erst damit zu beginnen bzw. diese sich einzugestehen! Ja, keiner hat gesagt, dass es leicht ist, aber es lohnt sich! Je besser du selbst weißt, wer du bist und auch deine nicht so bequemen Anteile kennst, desto leichter ist es, mit Menschen zu arbeiten, ohne die eigenen Anteile zu projizieren. Denn auch das tun wir, meist unwissentlich, sehr oft.
Wir projizieren unsere eigenen Ängste oder Verhaltensweisen, die wir an uns nicht mögen oder wie wir nicht sein dürfen, auf andere. Hinzu kommt, dass es dann auch schwierig wird, Abstand zu wahren. Bisweilen vermischen sich dann die eigenen Emotionen, Bedürfnisse, Verhaltensweisen mit denen des Klienten/Schülers, und das macht die Arbeit nicht leichter.
Es gibt ein schönes Bild von Puh, dem Bären mit seinem Freund Ferkel, auf dem sie nebeneinander laufen. Zu dem Bild heißt es, dass der Freund nicht vor oder hinter dir, sondern neben dir gehen möchte. So sollte das auch beim Unterrichten sein, wir sollten die Menschen begleiten, mit ihnen ihren Weg finden und gehen, – schön, wenn wir sie dabei unterstützen können.
Wichtig ist jedoch, jeder muss seinen eigenen Weg finden und gehen, was für mich richtig ist, muss für den anderen noch lange nicht passen! Das ist auch eine Schwierigkeit, die in der Arbeit mit Menschen (nicht nur im Yoga, auch in anderen Bereichen) vorhanden ist. Schnell sind Lehrer in der Situation, zu denken, sie wüssten, wie es geht und das muss dem Schüler doch nur beigebracht werden. Ist das wirklich so? Ich denke nicht.
Ich bin der Überzeugung, dass ich ausschließlich für mich wissen kann, wie es geht, niemals lässt sich das genauso auf einen anderen Menschen übertragen, denn jeder Mensch hat seine eigene, individuelle Wahrheit, Geschichte, Sicht auf die Dinge. Es gibt hierzu ein schönes Gleichnis von den blinden Männern und dem Elefanten. Das Gleichnis stammt aus Südasien und wird in unterschiedlichen Variationen (Anzahl der Männer, die Männer sind blind oder in der Dunkelheit …) erzählt.
In diesem Gleichnis untersucht eine Gruppe von Blinden (oder von Männern in völliger Dunkelheit) einen Elefanten, um zu begreifen, worum es sich bei diesem Tier handelt. Jeder untersucht einen anderen Körperteil (aber jeder nur einen Teil), wie zum Beispiel den Rüssel, ein Bein oder einen Stoßzahn. Dann vergleichen sie ihre Erfahrungen untereinander und stellen fest, dass jede individuelle Erfahrung zu ihrer eigenen, vollständig unterschiedlichen Schlussfolgerung führt. Und keiner erkennt den ganzen Elefanten!
Genau das trifft es ganz wunderbar! Jeder hat seine eigene Realität und deswegen ist, für mich persönlich, die Aufgabe des Lehrers, vorrangig den Schüler als einzigartiges, perfektes Individuum wahrzunehmen und dann mit ihm gemeinsam auf die Reise zu gehen und den persönlichen Weg zu finden. Wir als Lehrer/Coaches sind Unterstützer, Berater, Mutmacher und Fragensteller.
Ein guter Lehrer erkennt den Menschen als Ganzes und unterstützt seine Kompetenzen, hilft aber auch, die Schattenseiten zu erkennen, wahrzunehmen und zu akzeptieren.
5.1Lehrer-Schüler, eine mächtige Beziehung?
Noch ein Wort zur Schüler-Lehrer-Beziehung. Früher wurde nur im direkten Einzelunterricht Wissen vermittelt, dies zeigt sich noch sehr deutlich in den Upanishaden, was auch übersetzt so viel wie „nahe bei … sitzen“ heißt. Oftmals kamen die Schüler bereits als Kinder oder Jugendliche zu ihrem Lehrer und lebten dann viele Jahre mit ihm. So stellt sich nun die Frage, ob man heutzutage noch einen Lehrer/Guru braucht. Oder ist dieses Konzept vielleicht schon längst überholt?
Nicht zuletzt durch einige Gurus, deren Eskapaden (Geldgier, sexuelle Kontakte zu Schülerinnen etc.) durch die Medien gingen, wurde diese Frage wieder aufgeworfen. Da der Begriff Guru bei uns im Westen oftmals einen etwas negativen Beigeschmack hat, möchte ich erst einmal den Begriff erläutern: Das Wort Guru stammt aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie „derjenige, der Licht ins Dunkel bringt und damit geistige Unwissenheit (Avidya) vertreibt“. Praktisch gesehen, bedeutet das, ein Guru ist jemand, der dem Menschen bestimmte Fähig- oder Fertigkeiten vermitteln kann, die er selbst (noch) nicht hat.
Um Yoga zu erlernen und/oder um die eigene Psyche zu ergründen, bedarf es also einer Person, die sich damit auskennt. Genau wie in jedem anderen Bereich, den es zu erlernen gilt (Lesen, Autos reparieren etc.). Somit macht es durchaus Sinn, sich einen Lehrer/Guru zu suchen, um diese Fähigkeiten zu erlernen, denn er ist in der Lage, dem Schüler das Wissen/die Fähigkeiten zu vermitteln, neue Blickwinkel zu öffnen bzw. den Schüler auf Dinge aufmerksam zu machen, die ihm vorher nicht aufgefallen sind und durch sein eigenes Beispiel die Schüler zu inspirieren. Sinnvoll ist es sicherlich auch, verschiedene Lehrer zu treffen, denn auch hier hat jeder seine eigene Wahrheit und so kann sich der Schüler unterschiedliche Methoden, Herangehensweisen etc. abholen.
Im Umkehrschluss heißt das ebenfalls, es muss nicht gleich der erste Lehrer der passende sein. Vielleicht stellt man nach einer Weile fest, dass man nun einen anderen Lehrer braucht, der neue Inspiration bringt. Es ist also meines Erachtens wichtig, sich einen guten, erfahrenen Lehrer zu suchen, der zu mir passt und mit dem ich gut arbeiten kann! Denn nicht jeder Lehrer kann mit jedem Schüler arbeiten und umgekehrt!
Doch zurück zu uns.
Zum Selbststudium gehört es auch, sich Wissen anzueignen, denn wenn ich z. B. weiß, dass es kaum möglich ist, einfach so den Geist leer zu machen, weil das nicht in der Natur unseres Gehirns liegt, dann erleichtert das doch einiges.
Kleines Beispiel: Meine erste Meditationserfahrung in einer meiner ersten Yogastunden lief folgendermaßen: Meine damalige Yogalehrerin leitete die Meditation mit den Worten ein, sich bequem hinzusetzen, sich aufzurichten und dann die Gedanken loszulassen und den Kopf leer zu machen. Ja, alles gut und schön, doch was dann bei mir geschah, war alles andere als das.
Bei mir passierte Folgendes: Meine Affenfamilie, die schon sowieso eine Großfamilie war, lud all ihre Freunde und Verwandten zu der, gefühlt, größten Party ever ein. Will heißen, ich hatte dermaßen viele Gedanken im Kopf, dass ich schier überschwemmt wurde und war dann natürlich erst einmal äußerst frustriert. Hinzu kam, dass ich anschließend von mir selbst ziemlich lange dachte, dass Meditation wohl nicht mein Ding ist. Zack – so entsteht ein Glaubenssatz.
Diese pauschale Aussage über mich nennt man Generalisierung. Das bedeutet, mir ist einmal etwas passiert und ich gehe davon aus, dass das nun immer so ist: Meditation hat nicht geklappt, also kann ich das nicht! Es dauerte dann fast 10 Jahre (und einige Ausbildungen und Lehrer), bis ich verstand, dass das so nicht funktionieren kann.
Als Erstes ist unser Gehirn nicht dafür gemacht, nichts zu denken. Im Gegenteil: Das Gemeine an der Sache ist, dass unser Hirn geradezu freudig die Ruhe erwartet, denn endlich hat es deine volle Aufmerksamkeit und kann mal so richtig aus dem Vollen schöpfen. Aber, keine Sorge, das bedeutet nicht, dass es prinzipiell nicht möglich ist, nichts zu denken, aber eben nicht sofort und beim ersten Mal. Vor allem war eine Erkenntnis für mich sehr hilfreich: Meditation kann man nicht machen!
Wir sind so darauf gedrillt, Dinge zu tun, aktiv zu sein, die Macher. In der Meditation ist das nicht möglich. Meditation ist ein Zustand, der passiert oder eben auch nicht. Es ist wie mit allem, was wir neu lernen: es braucht Geduld, Übung und noch mal Geduld. Und dann ist es auch noch ein bisschen tagesformabhängig.
Ich sage meinen Schülern immer, es gibt gute und weniger gute Meditationstage, das ist wie bei Gleichgewichtshaltungen.
Doch wie kann es also klappen mit dem leeren Geist?
Ist es doch das, was uns das Yoga Sutra 1.2 sagt: yogash-citta-vritti-nirodah (Yogash = Yoga ist, chitta = Geist, Verstand, vritti = Gedankenwellen, Bewegung des Geistes; auch Prägungen, Vorurteile, nirodhah = Zur-Ruhe-Bringen, Beherrschen, Kontrollieren).
Frei übersetzt bedeutet es also: „Yoga ist der Zustand, in dem der Geist zur Ruhe kommt.“ Ja, und das ist wohl mithin die größte Herausforderung und auch gleichzeitig das größte Geschenk, das uns eine fundierte Yoga- bzw. Meditationspraxis geben kann. Doch zurück zur Frage:
Wie gelingt das dann?
Hier gibt es dann natürlich auch wieder kein Geheimrezept.
Für mich war es unglaublich hilfreich, zu wissen, dass es normal ist, dass mein Gehirn mir sämtliche Gedanken, To-do-Listen und Ähnliches um die Ohren haut, wenn ich eigentlich meditieren will. Und dann habe ich es erst einmal mit Annahme versucht. Ich habe angenommen, dass es eben einfach so ist, ganz menschlich, okay so, wie es ist. Und dann habe ich mich, als nächsten Schritt, wie ein kleines Kind darüber gefreut, wenn ich mal eine Millisekunde Stille im Kopf hatte.
Das gilt es dann auch ganz diffizil wahrzunehmen, denn mitunter ist dieser Moment anfangs so kurz, dass er uns schier durch die Lappen geht. Auch hier wieder ganz wichtig: Eine regelmäßige Praxis (also dranbleiben!), denn wenn etwas in unserem tiefen Gedächtnis als Lernerfolg abgespeichert werden soll, dann braucht es hierzu Zeit und regelmäßige Wiederholungen.
Es herrschte eine Weile die Idee vor, dass es 21 Tage (bei täglichem Tun) dauern würde, bis man etwas Neues im Leben etabliert hat. Dies ist zurückzuführen auf den plastischen Chirurgen Maxwell Maltz (2016), der beobachtete, dass es in der Regel 21 Tage dauerte, bis sich eine neue Gewohnheit etabliert hatte (z. B. seine Patienten ihr neues Gesicht angenommen hatten oder Ähnliches).
Daraufhin geisterte diese Zahl längere Zeit durch sämtliche Fakultäten, bis sich Forscher an unterschiedlichen Universitäten auch dieser Frage annahmen. Heraus kam kein wirklich genauer Zeitraum, denn jeder Mensch ist ganz unterschiedlich.
Und so geht man heute davon aus, dass es, je nach Persönlichkeit und Entwicklung, etwa 2-8 Monate dauert, bis der Mensch eine Gewohnheit etabliert hat. Also heißt es dranbleiben! Und sich auch nicht frusten lassen, denn häufig gibt es einen Zeitpunkt, den wir überwinden müssen, weil da so eine Art Loch entsteht, währenddessen wir denken, wir schaffen es sowieso nicht.
(https://online-gesundheitstraining.de/2016/11/wie-lange-dauert-es-tatsaechlich-um-eine-neue-gewohnheit-zu-etablieren-1701/)