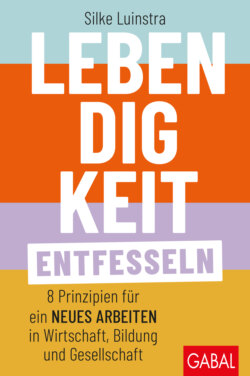Читать книгу Lebendigkeit entfesseln - Silke Luinstra - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Noch mehr schaffen
ОглавлениеEiner von denen, bei denen sich der Körper sehr vernehmbar gemeldet hatte, ist Jochen, Führungskraft in einem DAX-Unternehmen. Ihm bin ich an einem meiner Abende bei sysTelios begegnet, wo er sich von den Folgen eines Herzinfarktes erholte. sysTelios ist eine psychosomatische Klinik oder, wie sie selber lieber sagen, ein Gesundheitszentrum.
Da wir sehr eng mit der mit der Klinik verbundenen sysTelios-Akademie zusammenarbeiten, bin ich häufiger mal dort in dem kleinen Ort Siedelsbrunn mitten im Odenwald. Aus der kurzen Begegnung mit Jochen an der Kaffeemaschine wurde ein abendfüllendes Gespräch. Angefangen hatte alles mit Jochens Bemerkung, er würde den Espresso am Abend jetzt nicht mehr trinken, um wach zu bleiben, sondern um ihn zu genießen. Als ich ihn fragte, wie es zu diesem Wandel gekommen war, begann er zu erzählen: Er war schon seit über 15 Jahren in der Position im Unternehmen, er war anerkannt, musste sich keinerlei Sorgen um seine Position machen und beherrschte sein Aufgabenfeld. Keine 70-Stunden-Wochen, kein Mobbing, kein »unfähiger« Chef. Wo war dann das Problem? »Die Fixierung auf Leistung«, sagte Jochen. »Leistung war letztlich das Einzige, was zählte. Du musstest Leistung bringen, eine Alternative dazu gab es nicht wirklich.«
Das war keineswegs offensichtlich, sondern sehr subtil. Oberflächlich betrachtet, so sagte Jochen, hatte er sehr viele Freiheiten in der Erledigung seiner Arbeit gehabt. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice waren selbstverständlich geworden, niemand schrieb ihm vor, was er an einem Tag zu tun oder zu lassen hatte. Es gab sogar Meditationsangebote im Unternehmen, um Zeit zum Ausatmen zu haben.
Aber am Ende zählte eben doch nur, ob er die Deadline gehalten hatte, das Projekt gestemmt und seine Aufgaben abgearbeitet hatte. Feedbackinstrumente sorgten dafür, dass er sich ständig auf seine Defizite, Schwächen und Verbesserungsmöglichkeiten fokussierte und sich permanent weiter optimierte. Auch die Meditation diente letztlich diesem Zweck: durch die Pause wieder fit werden, um auch nach dem Mittag produktiv weiter arbeiten zu können. »Noch mehr schaffen«, das war die Devise. »Und weißt du, was verrückt ist?«, fragte er mich. »Ich habe diese Optimierungsidee mit in andere Lebensbereiche genommen!« Nach und nach wurden auch Dinge, die ihm eigentlich Spaß machten, wie der Spaziergang mit dem Hund oder die Zubereitung des Abendessens, zu Positionen auf der To-do-Liste, die es abzuhaken galt. »Viele Tage habe ich in einem roboterähnlichen Zustand verbracht«, fuhr er fort. »Ich konnte am Abend kaum sagen, was ich erlebt, gegessen, gesehen, getan hatte.« Das alles war ihm aber erst in der Rückschau bewusst geworden. »Mein Leben war ganz normal, wie das meiner Kolleginnen, Mitarbeiter, Geschwister und Freunde eben auch.«
Dieses »Mach was aus dir!«, »Streng dich an!«, »Optimiere dich!«, das Jochen aus Zeitungen, den sozialen Medien, Podcasts und Ratgeberliteratur entgegenschallte, hatte sogar dazu geführt, dass er sich zunächst selbst die Schuld an seiner Krankheit gegeben hatte. Er schien etwas falsch gemacht, sich nicht gesund genug ernährt, nicht genug geschlafen oder sich zu wenig bewegt zu haben. Als er das so sagte, musste ich erst einmal schlucken. Das war heftig.
Doch es ist wohl so in unserer Gesellschaft: Allzu schnell sollen die Menschen an ihrem Schicksal selbst schuld sein, der Arbeitslose an seiner Arbeitslosigkeit, der Obdachlose an seiner Wohnungslosigkeit und folgerichtig der Kranke an seiner Krankheit. Nichts gegen Verantwortung, im Gegenteil! Aber: Nur Verantwortung ohne Solidarität taugt eben auch nichts.
Jochen erzählte, dass ihm erst während der durch seine Krankheit erzwungenen Pause klar geworden war, wie sehr er unter Druck gestanden hatte. Das war nie offensichtlich und doch – oder gerade deswegen – sehr wirkungsvoll. »Es war bei uns im Bereich nie so, wie ich es von im Vertrieb tätigen Kollegen kannte«, sagte er. »Die standen sehr offensichtlich in Konkurrenz zueinander, und die Ziele waren so gesetzt, dass sie kaum erreichbar waren.« So etwas gab es bei ihm nicht, und doch war der Drang, sich als besser als andere zu präsentieren und zu glänzen, immer da – bei der Arbeit und darüber hinaus.
Mir wurde in dem Moment bewusst, dass sich dieser Drang auf Facebook, LinkedIn, Instagram, bei Parship und Tinder bestens studieren lässt. Jeder glänzt, Schwächen hat niemand – bis auf die üblichen wie Ungeduld oder sehr hohe Ansprüche. Was daran, so fragten Jochen und ich uns, gehört einfach zu uns Menschen? Sind wir von Natur aus egoistische Wesen, die auf den eigenen Vorteil bedacht sind und ständig nach »Mehr« streben? Sind Konkurrenzdenken, Eitelkeit und Selbstsucht der Menschen möglicherweise nicht auch Antrieb für Innovation und Fortschritt? Oder sind wir in unserer Grundprogrammierung eher altruistisch und sozial und entwickeln Neuerungen eher aus dem Gedanken des Nutzens für andere heraus?
Wir haben, so unser Schluss, vermutlich beide Seiten in uns und können diese je nach Kontext einsetzen. Die Frage ist eher, wo wir zu Hause sind und was wir bei Bedarf nutzen. Gunther Schmidt, einer der Gründer der sysTelios-Klinik, nennt das den »persönlichen Squashpoint«. Wie er auf dieses Bild kommt? Wenn Sie wie ich und viele der in den 1980er-Jahren Aufgewachsenen ab und zu Squash gespielt haben, dann erinnern Sie sich vielleicht: Man steht in einem ziemlich engen Raum, die Wände sind auch Spielfläche, der kleine Ball flitzt schnell hin und her. Sie haben eigentlich nur dann eine Chance, wenn Sie immer schnell auf den Punkt zurückkehren, an dem sich die Linien kreuzen – den Squashpoint – und von dort aus agieren, was so manches Mal weite Ausfallschritte bedeutet. Mir gefällt dieses Bild gut, es illustriert für mich, dass ich einen Punkt habe, von dem aus ich handle, von dem aus ich aber mit Ausfallschritten auch andere Verhaltensweisen zur Verfügung habe. Die Frage ist nur: Wo ist unser Squashpoint? Für jeden von uns liegt dieser Punkt woanders: Was für Sie mit einem kleinen Schritt erreichbar ist, könnte für mich einen großen Ausfallsschritt bedeuten, also am Rande dessen liegen, was zu meinem Verhaltensrepertoire gehört.
Jochen und ich diskutierten immer weiter bis in die abendliche Dunkelheit hinein, denn der Aspekt, den wir mit dem Squashpoint aufgeworfen hatten, erschien uns ausgesprochen relevant. Studien, Forschungsergebnisse und Analysen, so war uns schnell klar, würden uns darauf keine Antwort geben, denn deren Ergebnisse sind so vielfältig wie die Werte und Motivationen derer, die sie erstellen. Wirtschaftsliberale in der Tradition eines Milton Friedman sehen eher Egoismus als Triebfeder des Menschen, Sozialunternehmer wie der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus legen ihren Analysen die Annahme zugrunde, dass wir Menschen von Natur aus altruistisch sind. Aber dann, so wurde uns immer klarer, geht es nicht um die Frage, ob eher Friedman oder Yunus recht hat, sondern darum, wo wir unseren Squashpoint sehen und was wir tun und lassen, um immer wieder zu diesem zurückzukehren. Doch das ist noch nicht alles. Es geht auch um die Frage, für was für eine Welt wir unterwegs sein wollen.
Inzwischen war es ein Uhr und längst still geworden um uns herum. Wir einigten uns darauf, die zuletzt entdeckten Fragen mitzunehmen. Wider Erwarten konnte ich gut einschlafen, vielleicht weil die Fragen, die Jochen und ich uns zum Schluss unseres Gesprächs gestellt hatten, ermutigende Fragen waren.
»Silke«, begrüßte mich Jochen am folgenden Morgen beim Frühstück, »das mit dem Squashpoint ist Mist. Mir tun schon bei dem Gedanken daran die Beine weh, weil ich permanent weite Ausfallschritte am Rande der Zerrung mache.« Um die – vermuteten und ausgesprochenen – Erwartungen seines Umfeldes zu erfüllen, musste Jochen sich permanent strecken. Anstrengend. Sehr anstrengend. Nun war Jochen kein Typ, der grundsätzlich etwas gegen Anstrengung hatte, doch als permanenter Zustand ist das schwer zu ertragen. »Und eines will ich bestimmt nicht«, ergänzte er. »Das, was ich hier in den Therapien lerne und erfahre, nur dafür einsetzen, bessere Ausfallschritte machen zu können.« Ich konnte ihn gut verstehen. Und doch, dachte ich, während ich in meinem Kaffee rührte, das Bild vom Squashpoint ist bei aller Anstrengung auch sehr treffend. Es illustriert einerseits, dass es hilfreich ist zu wissen, wo wir uns zu Hause fühlen, und andererseits, dass wir uns von dort aus in ungewohnte Gefilde strecken können und dass diese Schritte nicht beliebig groß werden können, ohne dass wir uns verletzen.
Wie sehr Jochen das Ideal von Schaffen, Konkurrenz und Erfolg verinnerlicht hatte, wurde ihm in diesen Wochen nach seinem Infarkt erst so richtig deutlich. Der eindrücklichste Satz, den er über diese Zeit sagte, war: »Die Tage haben endlich wieder die richtige Geschwindigkeit«. Was für eine schöne Formulierung! »Ich bin ein echtes Klischee«, fügte er nur im halb im Scherz an. »Ich musste erst umkippen, um es zu kapieren.« Weshalb machen Menschen sowas eigentlich mit – und empfinden es sogar noch als Freiheit? Diese Frage begleitet mich nicht erst seit dem Gespräch mit Jochen, und sie wird auch in diesem Buch immer wieder mitschwingen.