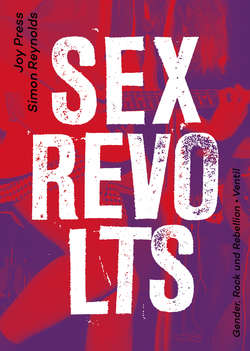Читать книгу Sex Revolts - Simon Reynolds - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ANGRY YOUNG MEN: VORLÄUFER UND PROTOTYPEN DER ROCKREBELLION
Оглавление»Man ist immer noch an die Mutter gebunden. Jegliche Rebellion war Illusion, der krampfhafte Versuch, diese Bindung zu verschleiern […]. Für immer draußen! Auf der Türschwelle des Mutterleibes.«
Henry Miller (über Arthur Rimbaud)
Rebellen gibt es in den verschiedensten Formen und Größen. Manche werden von den Fesseln ihres sozialen Umfeldes zur Revolte getrieben. Es gibt ausdauernde Rebellen ohne eigentlichen Grund (wie Marlon Brandos Biker in Der Wilde, der, als er gefragt wird, wogegen er denn rebelliere, entgegnet: »Was hast du denn zu bieten?«). Und es gibt Rebellen, die nach Gründen suchen, um ihr aufständisches Verhalten zu rechtfertigen. Was ist es, das diese Jungs verbindet? Genau: ihre Maskulinität.
Sie ist schließlich das, was man mit »dem Rebellen« als Erstes verbindet. Unsere These lautet, dass – was auch immer der vordergründige Prä- oder Kontext ist – ein großer Teil des psychologischen Antriebs jeder Rebellion in dem Drang liegt, sich von seiner Mutter zu distanzieren. In der männlichen Rebellion wird jener Ur-Bruch nachgestellt, der das männliche Ego begründet: die Trennung des Kindes vom mütterlichen Reich, die Vertreibung aus dem Paradies. Der Rebell wiederholt den Prozess der Selbstwerdung in endlosen Trennungsriten, flieht kontinuierlich vor der Häuslichkeit. Dass diese Flucht mit Reue verbunden ist, ist unausweichlich und führt oft – wie in der Musik der Rolling Stones und von Jimi Hendrix – zu einer Suche nach einer neuen Heimat; die Rastlosigkeit lässt nach und kommt schließlich in einer mystischen oder idealisierten Idylle zur Ruhe. Wie Nietzsche es ausdrückte: »Damit ein Heiligtum aufgerichtet werden kann, muss ein Heiligtum zerbrochen werden.«
So kann der Rebell eine abstrakte Feminität bewundern (eine Heimat fern der Heimat) und gleichzeitig echte Frauen fürchten und verabscheuen. Er kann sich nach dem Mutterleib und einer idealisierten Partnerin als Mutterersatz sehnen und gleichzeitig Frauen aus Fleisch und Blut in seiner Nähe meiden oder schlecht behandeln. In der Vorstellung des Rebellen sind Frauen gleichzeitig Opfer und Täterinnen im Namen der Konformität, die eine Bedrohung für seine Männlichkeit darstellt. Frauen repräsentieren alles, was der Rebell nicht hat (Passivität, Zurückhaltung), und alles, was ihn zu binden droht (Häuslichkeit, soziale Normen). Für alle klassischen Beispiele der Rockrebellion ist diese Ambivalenz zentral, von den Stones über The Doors, Led Zeppelin, Iggy Pop und The Stooges zu den Sex Pistols, Guns N’ Roses und Nirvana.
An dieser Stelle ist Jean-Paul Sartres Unterscheidung zwischen dem Rebellen und dem Revolutionär von Nutzen. Laut Sartre steckt der Rebell heimlich mit der Ordnung, gegen die er rebelliert, unter einer Decke. Sein Ziel ist es nicht, ein neues, besseres System zu schaffen; er will einfach nur die Regeln brechen. Im Gegensatz dazu ist der Revolutionär konstruktiv. Sein Ziel ist es, ein ungerechtes System durch ein neues, besseres zu ersetzen; er ist diszipliniert und bereit, Opfer zu bringen. Aufgrund seiner Verantwortungslosigkeit hat der Rebell Zugang zu ausschweifender Ekstase und kann im Jetzt leben. Dem Revolutionär ist es Befriedigung genug, seine Identität mit dem kollektiven Projekt eines gesellschaftlichen Fortschritts zu verschmelzen, dessen Erfüllung in der Zukunft liegt. Wir gehen davon aus, dass Rock keine revolutionäre Kunstform ist, dass sein Ungehorsam und die Trotzanfälle seines Egos Hand in Hand mit den Konditionen von Kapitalismus und Patriarchat gehen.
Die zentrale Kränkung des Rebellen liegt darin, dass ein patriarchales System seinem wilden Wesen Einhalt gebietet und ihm stattdessen ein Leben voller Mittelmäßigkeit vorsetzt. Er verkommt zu einem Zahnrad in der Maschine, während er vom Leben eines Helden träumt. Währenddessen wird den Frauen nur die Alternative gelassen zwischen dem Status quo des Patriarchats und dem Filiarchat der Rebellen, der Rock-’n’-Roll-Bruderschaft der verlorenen Söhne. Zu oft bleibt Frauen hier als Raum der Selbstentfaltung nur die Rolle der Muse, der Gangsterbraut oder des Groupies übrig: Sie stehen am Rand und beobachten die Heldentaten der Männer voller Bewunderung.
»Wir sind hier die Opfer einer Matriarchie, mein Freund.«
Harding, Insasse der Psychiatrie in Ken Keseys Einer flog über das Kuckucksnest (1962)
Die Rock-’n’-Roll-Rebellion kam in etwa zur gleichen Zeit auf wie der Nachkriegs-»Momism«, eine seinerzeit angesagte Kulturkritik, die Mütter als den Ursprung des Großteils der verschiedenen Übel Amerikas ausmachte. Der Begriff »Momism« stammt aus Philip Wylies Generation of Vipers von 1942, einer ungehalten frauenfeindlichen Tirade gegen den Verfall amerikanischer Kultur durch »die zerstörerische Mutter«. Wylie argumentierte, Amerika sei von Materialismus und oberflächlicher Populärkultur verschlungen worden – und beides bringt er mit Frauen in Verbindung. Seifenopern, Mode, Fernsehen, Radio, sentimentale Popsongs, Hollywood, Kaufhäuser – all das seien »verkommene« Auswüchse der Massenkultur mit dem Zweck, weibliche Sensibilitäten anzusprechen und die zügellose Freiheit amerikanischer Kultur zu unterjochen. »Das Radio ist die schwerste Waffe der Mutter, denn es zwingt jedem, der zuhört, die Marke des Matriarchats auf«, wütete Wylie, als stünde der Weltuntergang unmittelbar bevor (ein paar Jahre später hätte er den Schuldigen sicher im Fernsehen gefunden). Wylie machte Stimmung gegen die Tyrannei der Massenmedien, die sich in matriarchaler Sentimentalität, Verlogenheit, Schmalz und verborgener Grausamkeit äußere und einen Vorboten des Todes der Nation darstelle.
In ihrer Analyse von Wylies Werk merkt Jacqueline Rose an, dass die Gefahren von Weiblichkeit und Massenkultur in einer intimen Beziehung zueinander stünden. Unter Kritikern der 1940er und 1950er war diese Verbindung von Popkultur und Frauen weit verbreitet. So behauptete Dwight MacDonald 1953 in seinem Essay »A Theory of Mass Culture«, dass Durchhaltevermögen die wichtigste Tugend derjenigen sei, die der Verbreitung des Drecks der Massenkultur trotzten. Ironischerweise kam dieser auf Geschlechterfragen basierende Elitismus später in Form der Unterscheidung von Rock und Pop innerhalb der Popkultur selbst wieder auf. Hier wird die korrekte Rezeption (männliches Kennertum, anspruchsvolles Unterscheidungsvermögen) der verkommenen weiblichen Fanverehrung (oberflächlich, hysterisch, gleichzeitig wahllos und loyal) entgegengestellt.
Die negative Konnotation von Popkultur und Weiblichkeit hat eine lange Geschichte. Andreas Huyssen führt sie auf Gustave Flauberts Madame Bovary zurück – ein Buch, in dem einer der Väter der Moderne das wenig schmeichelhafte Porträt einer von romantischer Literatur verdorbenen Frau zeichnete. Dieser Reflex hat weiterhin Bestand. In »She Watch Channel Zero?!« (vom Album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, 1988) werfen Public Enemy schwarzen Müttern ihre Vorliebe für Soaps und Talkshows wie der von Oprah Winfrey vor, wegen der sie ihre eigentliche Pflicht – die Erziehung starker schwarzer Krieger – vernachlässigen würden. Auf dem Titeltrack seines 1993er-Albums Home Invasion richtet sich die Feindseligkeit des Gangsterrappers Ice T gegenüber dem weißen Amerika spezifisch gegen »yo moms« (vielleicht wegen des matronenhaften öffentlichen Images des Parents Music Resource Centers, das sich für die Zensur von Rockmusik einsetzte1). Die Bedrohung, die Ice T so lustvoll zelebriert, liegt in seinem Einfluss auf weiße Kids begründet, die damit aufwachsen, schwarz und gerissen sein und die Ketten der spießigen Werte ihrer Mütter sprengen zu wollen.
Im Nachkriegsamerika verknüpfte sich die Furcht vor Momism mit anderen Ängsten, etwa vor dem Kommunismus oder der Demokratisierung der Kultur. Wie der Pseudo-Freudianismus, von dem er letzten Endes abstammt, drang auch der Anti-Momism in die Popkultur selbst vor: als Möglichkeit, jemandem für den ausdruckslosen Konformismus im Amerika der 1950er die Schuld zu geben. Frauen und Mütter galten als die Verwalterinnen der Häuslichkeit (statt als das, was deutlich näher liegen würde, nämlich als ihre größten Opfer), die ihre Ehemänner dem 9 to 5-Regime des Broterwerbs als Sklaven überlassen. Mütter waren demnach auch schuld an der Kriminalität, weil sie ihre Söhne schlecht erzogen, indem sie diese mit ihrer Liebe überschütteten. In dieser seltsamen Doppelmoral wurden Frauen gleichzeitig als Architektinnen des konventionellen Lebens – mit all seinen Einschränkungen und Fesseln für die männliche Ungezähmtheit – und als die sichtbarsten Opfer desselben betrachtet: zugleich Kastrierende und Kastrierte.
Diese pseudo-freudianische Analyse zog sich durch die Massenkultur der 1950er/60er, durch Filme wie Wie bringt man seine Frau um? oder Psycho – Norman Bates ermordet seine Mutter, weil er die nahezu inzestuöse Intimität zwischen den beiden durch ihre geplante Wiederverheiratung gefährdet sieht und verinnerlicht dann ihre Persönlichkeit aus Schuldgefühlen. Wann immer Norman eine Frau attraktiv findet, ist diese Phantom-Mutter genauso eifersüchtig und zwingt ihn, ihre Rivalin aus dem Weg zu räumen. Mehr Bezug zu Rock ’n’ Roll hat der ungezügelte Anti-Momism von … denn sie wissen nicht, was sie tun. Gleich zu Beginn macht der Film in einer Szene, in der der betrunkene, undisziplinierte James Dean einem verständnisvollen Polizisten sein Herz ausschüttet, klar, dass die Verfehlungen des Teenagers seine dominante Mutter und seinen schwachen Vater zur Ursache haben. Sein Zuhause beherbergt sogar zwei kastrierende Mütter, denn seine Großmutter mütterlicherseits lebt ebenfalls mit im Haushalt. Und so jammert Dean: »They eat [Dad] alive … they make mush out of him, just mush«, und er fügt hinzu: »If he had the guts to knock Mum cold once, then she’d be happy and stop picking on him.« Das Leiden seines Charakters liegt in der Abwesenheit eines starken väterlichen/männlichen Prinzips begründet, mit dem er sich identifizieren könnte. Ohne dieses ist er der monströsen Herrschaft der Frauen schutzlos ausgeliefert.
John Osbornes Blick zurück im Zorn spielte für eine Generation unzufriedener Jugendlicher in Großbritannien eine ähnliche Rolle wie … denn sie wissen nicht, was sie tun in den USA. Oberflächlich betrachtet liest sich das Theaterstück als beißende Antwort auf den Niedergang Großbritanniens nach dem Ende des Empires, auf die Schwerfälligkeit der 1950er, als sich die Hoffnungen auf einen Wiederaufbau, die während des Zweiten Weltkriegs geweckt wurden, als leer entpuppten und die konservative Regierung versuchte, eine glanzlose Version der gesellschaftlichen Ordnung vor dem Krieg zusammenzuflicken. So zumindest wurde das Stück sowohl von der Fan- als auch der Gegenseite aufgefasst. Doch der psychosexuelle Subtext von Blick zurück im Zorn ist dem von … denn sie wissen nicht, was sie tun sehr ähnlich: die Absenz eines starken patriarchalen Prinzips zur Identifikation, das Leid junger Männer in einer herrenlosen Welt voller impotenter Väter, und über allem thront eine bösartige Furcht und Abscheu vor Frauen, den Repräsentantinnen einer alles durchziehenden Mittelmäßigkeit.
Jimmy Porter, der Antiheld des Stückes, verlor als Kind seinen Vater.2 Seine aggressiven Monologe richten sich an Alison, seine teilnahmslose Ehefrau aus der Oberschicht, die stoisch hinter ihrem Bügelbrett kauert. Jimmy mag jedoch Alisons Vater, ein Relikt aus der glanzvollen Zeit des britischen Empires, für den es, wie für den Sozialisten Jimmy, keinen Platz in der Nachkriegsgesellschaft gibt. Alisons Mutter hingegen ist eine furchterregende Matrone, eine bedrohliche Inkarnation von sozialem Elitismus, kleinkariertem Materialismus und prüder Anständigkeit. Alison und ihre Mutter verschmelzen zu einer geisterhaften Bedrohung für Jimmys Männlichkeit. In einer der bemerkenswertesten Passagen des Stückes stellt sich Jimmy vor, in Alisons Schoß gesogen zu werden: »Ich, lebendig da drin begraben, […] erstickt […]. Sie wird weiter schlafen und schlingen, bis nichts mehr von mir übrig ist.«
Porter leidet unter seiner Demobilisierung. Er träumt von einer »glühenden Energie in Geist und Gemüt«, wird aber von der Klaustrophobie Englands im Kalten Krieg erdrückt. Jimmy Porters Dilemma liegt darin, dass seine Männlichkeit keinen Ausdruck findet und sein Heldentum keinen Geltungsbereich: Er ist ein wortwörtlicher Rebell ohne (politischen) Grund.3 Jegliche Energie, die durch den Krieg mobilisiert worden war, ist abgeklungen, der Idealismus der Nachkriegszeit (inklusive seines massiven Linksrucks) ins Stocken geraten. Porters Wut hat kein Ziel. Seine Heirat mit Alison – gegen den ausdrücklichen Widerstand ihrer Familie – war ein letztes Aufbegehren, eine Art Guerilla-Attacke gegen den Versuch der Oberschicht, an der Macht zu bleiben. Doch sein Sieg ist bedeutungslos: Er steckt fest in einem ärmlichen, häuslichen Leben und alles, was er tun kann, ist, in seinem eigenen Zorn zu versauern. Indem er seine Frau schlecht behandelt, bewahrt er sich ein letztes Terrain für seinen Klassenkrieg und kann sich fühlen wie ein Mann.
Der Rebellen-Diskurs der 1950er wird von der Figur der Matriarchin als Cheforganisatorin von Konformismus und Mittelmäßigkeit heimgesucht. Der Dichter Ted Hughes beschrieb die literarische Tradition des englischen Mainstreams als »erstickenden mütterlichen Oktopus«. Alice Jardine hat eine Tradition des literarischen Muttermordes in den Werken amerikanischer Autoren des 20. Jahrhunderts ausgemacht: Bei Autoren wie Norman Mailer, Henry Miller und William S. Burroughs stellt die Mutter »nahezu immer eine bösartige, grausame, chaotische, unkontrollierbare, essenziell monströse phallische Macht« dar. Ganz besonders in Burroughs’ fiktiven Werken, fügt Robin Lydenberg hinzu, sei die Mutter, gemessen an konventionellen Vorstellungen von Geschlechtsunterschieden und Familienstruktur, ein notwendiges Werkzeug innerhalb eines größeren Systems patriarchaler Macht, das versucht, das Individuum von Anbeginn seines Lebens zu dominieren.
Die Rockmusik der 1960er gründete auf genau dieser Gegenüberstellung von rebellischer Männlichkeit und der Frau als Inkarnation des Konformismus. Rebellische Frauen fanden sich in einer Zwickmühle wieder. So schreibt Ellen Willis in einem Essay über Bob Dylan: »Damals habe ich die Vorstellung, dass Frauen die Hüterinnen unterdrückerischer konventioneller Werte seien, nicht hinterfragt: Ich hielt mich einfach für eine Ausnahme. Ich war nicht besitzergreifend. Ich konnte das Verlangen der Männer nachvollziehen, unterwegs zu sein, denn spirituell gesprochen war ich selbst unterwegs. Das war zumindest meine Fantasie. Meine Lebenswirklichkeit war nicht so eindeutig.«
Jack Kerouacs Unterwegs (1957), wohl der grundlegende Text der Rockrebellion, dreht sich um eine sehr genderspezifische Reise mit dem Ziel der Selbstfindung. Es geht um zwei junge, auf Neal Cassady und Kerouac selbst basierende Männer, Dean Moriarty und Sal Paradise, die zu einer spirituellen Odyssee aufbrechen, und obwohl sie auf weibliche Unterstützung und Finanzierung angewiesen sind, werden Frauen textlich marginalisiert. Es sind Frauen (allen voran Sals Tante), die ihre Reisen kontinuierlich subventionieren. Auf einer ihrer Spritztouren nehmen sie einen Anhalter mit, der verspricht, sich Geld von seiner Tante zu leihen, um sich finanziell bei ihnen zu revanchieren. »Ja!«, ruft Moriarty freudig. »Wir alle haben Tanten.« Dann wäre da noch die lange Reihe leidgeprüfter Freundinnen wie Galatea, deren Erspartes für eines der Abenteuer draufgeht. Als ihr das Geld jedoch ausgeht, wird sie von der Gruppe ausgeschlossen. Frauen kommen in Unterwegs kaum zu Wort, sie bleiben im Hintergrund: bereiten Mahlzeiten vor, nähen Socken, hören aufmerksam zu und werden für gewöhnlich nur dann indirekt zitiert (anstelle einer direkten Wiedergabe ihrer Worte), wenn sie protestieren oder rummeckern.
Die Beatniks kombinierten diese arrogante Attitüde gegenüber der Frauenwelt mit einer mystischen Sehnsucht, sich mit irgendeiner Form von kosmischer natürlicher Essenz zu vereinigen. (Kerouac soll einmal ein Loch in den Boden gebohrt und es gefickt haben – ein Versuch, mit Mutter Natur in Kontakt zu treten.) Sie verließen jegliches häusliche Umfeld, sobald es dort zu bequem wurde, weil sie auf der Suche nach einer höheren Art von Zuhause waren, nach einer glückseligen Vereinigung mit einer unsterblichen Weiblichkeit. Ihr Heiliger Gral war Satori4, von Norman O. Brown als »die Erfahrung des Ungeborenen« definiert. Wie Kerouac selbst schon schrieb: »Das eine, wonach wir strebten Zeit unseres Lebens, das uns seufzen und stöhnen macht und uns süße Beklemmungen bringt, ist die Erinnerung an irgendwelche verloreren Wonnen, die wir wahrscheinlich im Mutterleib erfahren haben und die sich (wenn wir es auch nicht wahrhaben wollen) nur im Tode wiederholen können.«
Dean Moriarty bedient sich eines üblichen frauenfeindlichen (später für Hippie-Rock typischen) Gesinnungs-Kunststücks, das es ihm ermöglicht zu beteuern, dass er das weibliche Geschlecht bewundert, während er die realen Frauen in seinem Leben wie Dreck behandelt. Er steht auf all die »gone chicks« – »Oh, ich liebe, liebe, liebe Frauen! Ich finde sie wundervoll!« – und verlässt seine Liebhaberinnen gleichzeitig, sobald ihn wieder die Rastlosigkeit überkommt. Als er Camille, mit der er ein Kind hat und die ein weiteres erwartet, verlässt, um mit Sal Paradise ins nächsten Abenteuer aufzubrechen, können beide Männer nicht nachvollziehen, warum sie das so sehr aufregt.
Doch so ganz entkommt Kerouacs Alter Ego (und zweifellos Kerouac selbst) seinem schlechten Gewissen nicht. An einer späteren Stelle im Roman ist Sal so hungrig und heruntergekommen, dass er halluziniert. Er hält eine Frau auf der Straße für seine Mutter und sich selbst für den verlorenen Sohn, der aus dem Gefängnis zurückgekehrt ist, um an ihre harte ehrliche Arbeit in einer Garküche anzusehen. »›Nein‹, schien diese Frau mit dem erschreckten Blick zu sagen, ›komm nicht zurück und quäle deine ehrliche, schwerarbeitende Mutter. Du bist nicht länger mein Sohn.‹« Kurz darauf hat Paradise eine Erfahrung im Nirwana: »Hell leuchtet das Wesen der Dinge auf, in gewaltigen und unfaßbaren Strahlungen, unzählige Lotosländer öffnen sich fallend im zauberhaften Mottenschwarm des Himmels.« Am Morgen nach dieser Begegnung mit der unsterblichen Weiblichkeit macht Paradise dennoch weiter, als wäre nichts gewesen, und schnorrt hundert Dollar von einem reichen Mädchen, mit dem er geschlafen hat, um den nächsten Trip zu finanzieren.
Laut dem Kerouac-Biografen Dennis McNally war ein zentraler Mythos in Kerouacs Leben die Geschichte von Dostojewskis Ehefrau und ihrem unermüdlichen Einsatz für ihren Mann, also die der Pflicht der Untalentierten, den kreativen Künstler zu unterstützen. Und so war die einzige weibliche Konstante in seinem Leben seine Mutter, »Mütterchen«, eine Quelle bedingungsloser Liebe. Nachdem er dem Beatnik-Dasein entsagt hatte, kehrte er zu ihr zurück und verbrachte den Rest seines Lebens in ihrer Nähe.
Die Beats versuchten, die American frontier wieder zu öffnen, deren Schließung die amerikanische Identität in den 1890ern tief erschüttert hatte. Diese new frontier der 1950er spielte sich zwar auf dem Terrain der Psyche ab, doch wie ihre geografische Vorläuferin bot sie dem rauen, männlichen Individualismus eine Spielwiese. Frauen gab es dort keine, denn sie galten als Symbol eines Zuhauses, das verlassen werden musste. Norman Mailers Definition des hippen Nonkonformismus in seinem Essay »The White Negro« von 1957 bedient sich einer traditionell amerikanischen Ausdrucksweise: »Man ist ein Grenzer im Wilden Westen des amerikanischen Nachtlebens oder ein spießiger Organismus, gefangen im totalitären Gewebe der amerikanischen Gesellschaft, dazu verdammt, sich anzupassen, wenn man erfolgreich sein will.« Um zu entkommen und ein wahrlich mannhaftes Leben zu finden, muss man »sich von der Gesellschaft scheiden lassen«; Mailers Sprache stellt eine Verbindung zwischen Ehe und Entmannung her. Etwa zur gleichen Zeit bot der Playboy mit seiner Fantasie vom Lebemann eine Art spießiges Gegenstück zum Beat-Lifestyle: weltmännisch und kultiviert, aber, wie der Beatnik, ein eingefleischter Junggeselle, mit dem festen Ziel, niemals sesshaft zu werden.
Das Streben nach veränderten Bewusstseinszuständen in den 1960ern erweiterte die new frontier der Beats auf die eigene innere Wahrnehmung. Hier lässt sich die Wiederholung eines Musters beobachten: Timothy Leary, der LSD-Prophet, himmelte einen abwesenden Vater an. Captain Tote Leary hatte die Familie verlassen. Er war rastlos, leidenschaftlich, Alkoholiker, hatte ständig Schulden und befand sich stets auf der Flucht vor der Häuslichkeit. »In den 13 Jahren, die wir zusammen verbracht haben, hat mein Vater mir nie Erwartungen aufgezwungen«, erinnerte sich Leary jr. liebevoll. »Dad blieb für mich ein Vorbild des Einzelgängers. Er verachtete Konventionalität.«
Seine Mutter Abigail blieb zurück. In ihren Armen: ein Kind, das einmal die volle Wucht seiner Verachtung gegen sie richten würde. Abigail war eine fromme Katholikin, die sich nach einem Leben in der Mittelklasse sehnte und der eine Skepsis vor »allem Freudvollen, Frivolen oder Neumodischen« anerzogen worden war. Ihr fiel die Verantwortung zu, Leary großzuziehen, während der Vater den Glamour der totalen Verweigerung jeglicher Verantwortung einheimste. Was sie dafür bekam, war ein Sohn, der sein Bestes tat, um sich die unausstehlichsten Charakterzüge seiner Familie väterlicherseits einzuverleiben. Diese altbekannte Dialektik zwischen männlicher Abenteuerlust und weiblichem Konformismus, männlicher Rastlosigkeit und weiblicher Sesshaftigkeit, nimmt Learys Diskurs einer heroischen Odyssee in den Sog des Acid bereits vorweg. LSD befürwortete Leary als eine Möglichkeit, die Welt zu verfremden. Unter diesem Projekt versteckte sich die Sehnsucht, der Familie zu entkommen – ganz nach Papas Vorbild. Der Sinn eines Acid-Trips war es, das Zugehörigkeitsgefühl zu dieser Welt zu zertrümmern, die Landkarte zu zerreißen und jene Orientierungen, durch die das Leben bequem, routiniert und gewöhnlich wurde, zu desorientieren. Nur wer diese turbulenten Stromschnellen des Bewusstseins hinter sich brachte, konnte es zu jener Lagune der Klarheit schaffen, wo sich das zerschlagene Ego mit dem Kosmos verband. Wieder grüßt Nietzsche: »Damit ein Heiligtum aufgerichtet werden kann, muss ein Heiligtum zerbrochen werden.«
Ken Kesey ist das Bindeglied zwischen Norman Mailers Sicht der amerikanischen Vorstadt als Konzentrationslager der Mittelmäßigkeit und Learys Flucht in die psychedelische Wildnis. Einer flog über das Kuckucksnest (1962) basiert auf Keseys eigener Erfahrung als Hilfskraft in einem psychiatrischen Krankenhaus und stellt die Anstalt als einen Mikrokosmos des Amerikas der 1950er-Jahre dar. Der Held des Romans, R. P. McMurphy, täuscht psychopathische Tendenzen vor, um der Unerbittlichkeit der Gefängnisfarm zu entkommen. Zu seinen Verbrechen gehört Sex mit einem minderjährigen Mädchen, Reue zeigt er keine. Der ausgelassene McMurphy stiftet die anderen Patienten – geschlagene, kastrierte Männer, die mit den An- und Widersprüchen des vorstädtischen Matriarchats nicht klarkommen – dazu an, sich dem System zu widersetzen.
Es gibt zwei Arten von Frauen in Einer flog über das Kuckucksnest: Huren und Matronen (wobei Letztere zugleich unterdrückt werden und unterdrücken). Die mit McMurphy befreundeten Huren sind dumm, hübsch und hörig. Zu den frigiden Matriarchinnen zählen die kontrollsüchtigen Ehefrauen und Mütter, die zwar nicht als Charaktere auftreten, aber – darauf wird im Roman angespielt – die Insassen einst gebrochen haben, und verklemmte Dominas wie Oberschwester Ratched, die die Station mit ihrem strengen Arbeitsplan, beruhigender Muzak und regelmäßig verabreichten Beruhigungsmitteln regiert.
Ratcheds Name klingt phallisch, gewaltsam und abgehackt, wie das englische »ratchet«, ein Schneidewerkzeug. An einer Stelle versucht McMurphy einen Mitinsassen davon zu überzeugen, dass sie eine abscheuliche Tyrannin sei, die den Männern die Eier abschneide, damit diese schwach seien und mit dem Strom schwämmen – und von ihnen gäbe es viele. Amerika würde von Müttern regiert, die sich gegen die Männlichkeit verschworen hätten. Oberschwester Ratched ist sogar mit der Mutter eines Patienten namens Billy befreundet. Billy ist ein 31-jähriger Mann, der von der besitzergreifenden Prüderie seiner Mutter in einen mentalen Zusammenbruch getrieben wurde. Als McMurphy eine seiner leichten Freundinnen heranschafft, um Billy dabei zu helfen, seine Jungfräulichkeit zu verlieren, werden sie von Ratched in flagranti erwischt, die daraufhin damit droht, Billy bei seiner Mutter zu verpfeifen. Erneut wurde Billy entmannt – und begeht daraufhin Selbstmord. Aus Rache versucht McMurphy, Ratched zu erwürgen. Doch er scheitert und endet nach einer Lobotomie als gebrochener Zombie.
Später gründete Kesey die Merry Pranksters, zu denen auch der alte Gauner Neal Cassady gehörte. In einem bunt angemalten Bus fuhren sie durch die USA und gaben den Leuten eine Einführung in die wüste Welt des Acid-Trips. In seinem Buch über die Geschichte von LSD, Stormy Heavens: LSD and the American Dream, vergleicht Jay Stevens den Machismo von Keseys Acid-Evangelisation (bist du Mann genug, um den Acid-Test zu bestehen?) mit Learys sanftem Mystizismus. Offenbar stachelte einer von Keseys Kumpels, der LSD-Massenfabrikant Augustus Owsley III, seine Freunde an, gleich zwei Dosen zu nehmen und sich »richtig vom Kosmos« zu lösen. Im Zuge dieser Wiederbeschwörung ungezähmter Männlichkeit, die bereit ist, bis an die Grenzen zu gehen, bewunderten die Pranksters die Hells Angels für ihren zügellosen Nonkonformismus. Tatsächlich waren die Angels jedoch ein verzerrtes Spiegelbild der Geschlechterrollen des heterosexuellen Amerikas: Sie waren frauenfeindlich, chauvinistisch und antikommunistisch. Im Oktober 1965 verprügelte eine Angels-Gang in Berkeley Demonstranten, die gegen den Vietnamkrieg protestierten. Kurz darauf schickte ihr Anführer Sonny Barger dem damaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson eine offizielle Nachricht, in der er ihm die Dienste der Angels in Vietnam anbot: »Wir sind der Ansicht, dass eine erstklassige Gruppe trainierter Guerillakämpfer den Vietcong zermürben und den Kampf für die Freiheit vorantreiben würde. Für eine Ausbildung und die Ausübung unserer Pflicht stehen wir sofort zur Verfügung.« Trotz alledem wurden die Biker für viele Akteure der Gegenkultur wie die Rolling Stones, Grateful Dead und Steppenwolf zu Ikonen der ungezügelten Freiheit.
Obwohl die Gewalttätigkeit der Angels mit der passiven peace and love-Attitüde der Hippies im Konflikt stand, traf sie einen Nerv innerhalb des konfrontativeren Flügels der 1960er-Gegenkultur. So schrieb Yippie-Krieger und Neomarxist Jerry Rubin in der New York Times: »Junge Kids wollen Helden sein. Sie haben unglaubliche Energie und wollen kreative, aufregende Leben führen. Das ist es auch, was Amerika vermittelt […]. Wir lernen eine Geschichte, die sich an Helden orientiert: Columbus, George Washington, Paul Revere, die Pioniere, die Cowboys. Amerikas Versprechen ist ›ein heroisches Leben‹ gewesen. Aber es konnte sein Versprechen nicht einlösen. Es dreht sich um und sagt: ›Oh, du kannst gute Noten kriegen und einen Abschluss machen, einen Job in einer Firma annehmen, ein Haus kaufen und ein guter Konsument sein.‹ Doch den Kids reicht das nicht. Sie wollen Helden sein. Und wenn Amerika ihnen die Möglichkeit verwehrt, werden sie einen eigenen Weg dafür schaffen.«
Tom Wolfe betrachtete die Merry Pranksters als »wahre mystische Bruderschaft – das Ganze freilich im armen alten Amerika der 60er-Jahre, inmitten von Resopal und Polyäthylen«. Die Beatniks, die Merry Pranksters, Learys Politik der Ekstase, das Psychodrama von Einer flog über das Kuckucksnest – all das passt perfekt in jene Mythologie, die Robert Bly 1990 in seinem Bestseller Eisenhans kreierte. Bly ist Poet, Mitbegründer der Männerbewegung, Verehrer der Wildnis und glaubt, dass die Probleme der westlichen Gesellschaft ihren Ursprung in der Absenz von (männlichen) Vorbildern und Initiationsriten für männliche Jugendliche sowie deren Überbemutterung haben. Das Ergebnis seien entmannte »soft males« – Weicheier. Um dem entgegenzuwirken, fordert Bly eine Wiedererweckung des inneren wilden Mannes. Seine Ideen sind im Prinzip nicht mehr als eine mythologisch aufgeladene Neuauflage von Wylies Momism. Er gibt Müttern sogar die Schuld für Jugendkriminalität, Ungehorsam und Misogynie; schließlich seien dies Symptome der Versuche männlicher Jugendlicher, aus dem Kokon der mütterlichen Liebe auszubrechen. Rockmusik (insbesondere aufmüpfige, tribalistische Machogenres wie Rap und Metal) bietet einen Ersatz für jene Initiationsriten adoleszenter Männlichkeit, der charismatische Sänger wird dabei zur modernen Entsprechung des Mentors oder Schamanen.
Blys Eisenhans-Legende ist zu komplex, um an dieser Stelle näher darauf einzugehen, aber in ihrem Kern handelt es sich dabei um ein psychologisches Grundgerüst, das dem Ödipus-Mythos ähnelt. In beiden Fällen wird ein Jugendlicher von seinem Zuhause und seiner Mutter getrennt (oder trennt sich selbst davon), verschwindet in der Wildnis und kommt schließlich zurück, um den Platz des Königs/Vaters einzunehmen und mit der Mutterfigur, der Königin, vereinigt zu werden. (In der Ödipus-Geschichte sind König und Königin buchstäblich Ödipus’ Vater und seine Mutter.) Diese Mythen, Blaupausen männlicher Rebellion, sind Inzest-Psychodramen: ein Inzest, der zuerst (durch die Flucht vor dem erstickenden Busen) vermieden wird und dann, symbolisch, in der Eroberung der Königin zurückkehrt. Inzest steht dabei für mehr als bloßes Verlangen nach der Mutter. Er ist eine unerfüllbare Sehnsucht nach totaler Genugtuung und ultimatives phallisches Prestige; eine Sehnsucht, die in den extremsten Forderungen der Rockmusik wieder auftaucht, von Jim Morrisons unersättlichem Aufschrei »We want the world and we want it NOW« zur unerbittlichen Wut in Johnny Rottens »I wanna be anarchy«. Mit »The End« hatten die Doors sogar eine explizit ödipale Hymne und im Werk der Sex Pistols gibt es ein latentes Motiv des Inzests/Muttermords. Bevor er die Pistols traf, schrieb deren Strippenzieher Malcolm McLaren Songs für eine fiktive Rockband, die seiner Vorstellung nach eine Teenie-Revolution anführen sollte. Für einen Song mit dem Titel »Too Fast to Live, Too Young to Die« stellte sich McLaren einen Sänger vor, der »aussieht wie Hitler, diese Gesten, Armbinden etc., und der auf inzestuöse Weise über seine Mutti spricht.«