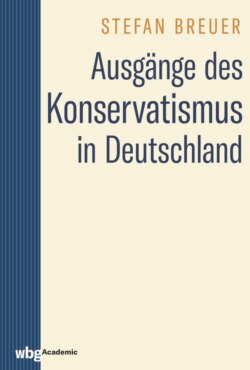Читать книгу Ausgänge des Konservatismus - Stefan Breuer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеSein Hauptwerk, Die Philosophie des Rechts43, hatte Stahl bereits abgeschlossen, als er 1840 auf ausdrücklichen Wunsch des neuen preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. (1840–1861) auf den Lehrstuhl für Rechtsphilosophie, Staatsrecht und Kirchenrecht an der Berliner Universität berufen wurde. Die akademische Karriere des gebürtigen Bayern war bis dahin nicht sonderlich glücklich verlaufen. Schon während seines Studiums war er in Erlangen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer Burschenschaft 1824 für zwei Jahre relegiert worden.44 Nach seiner Wiederzulassung hatte er 1826/27 zwar rasch Promotion und Habilitation absolviert und nach einigen Zwischenstationen den Sprung auf eine ordentliche Professur für Kirchenrecht, Staatsrecht und Rechtsphilosophie in Erlangen geschafft, doch geriet er als Vertreter der Universität in der bayerischen Ständeversammlung mit dem Ministerium über Fragen der Finanzverwaltung in Konflikt und mußte deshalb die Umwandlung seiner Professur in eine solche für Zivilrecht hinnehmen.45 Der Berliner Ruf befreite ihn aus dieser Lage und eröffnete ihm über die Universität hinaus zahlreiche neue Wirkungsmöglichkeiten: in der Preußischen Generalsynode, dem Evangelischen Oberkirchenrat, dem Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages, der von Ernst Wilhelm Hengstenberg gegründeten und geleiteten Evangelischen Kirchenzeitung und, ab 1848, der vom Gerlach-Kreis initiierten und getragenen Neuen Preußischen Zeitung, der ›Kreuzzeitung‹, zu deren Aktionären er zählte.46
Zu den Aktivitäten auf kirchlichem und publizistischem Gebiet kam im Gefolge der Revolution bald auch ein politisches Engagement. Nach den Märzereignissen trat er dem neu gegründeten Verein für König und Vaterland bei und ließ sich zusammen mit Savigny, Bismarck, Hermann Wagener u. a. in den Vorstand wählen.47 Im Februar / März 1849 skizzierte er einen »Entwurf für eine conservative Partei«, der heute als »das erste Parteiprogramm des preußischen Konservatismus« gilt.48 Im gleichen Jahr wurde er in die Erste Kammer gewählt, in der er einen im Vergleich zu Ernst Ludwig von Gerlach gemäßigteren Kurs einschlug.49 Vier Jahre später begegnet er als preußischer Kronsyndikus, Mitglied des Staatsrates und vom König auf Lebenszeit ernanntes Mitglied des Herrenhauses. Dessen Gestaltung ging ebenso auf seine Vorschläge und Initiativen zurück wie »die Beseitigung der Gemeinde-, Kreis- und Provinzialordnungen von 1850; der Entwurf eines Ehescheidungsgesetzes von 1855; die Aufhebung des Art. 40 der Verfassung, welcher die Errichtung von Fideicommissen untersagte« sowie die »Einführung der Städteordnung für die sechs östlichen Provinzen der Monarchie vom 30. Mai 1853«.50 Die Nachwelt hat deshalb nicht gezögert, Stahl zu den »maßgebenden konservativen Theoretiker[n]« zu zählen, ja seine Lehre zu der »bedeutendste[n] des deutschen Konservatismus überhaupt« zu erklären.51
Dafür spricht zunächst auch einiges. Mit Jarcke oder den Gerlachs wußte sich Stahl einig in der Überzeugung, daß die Revolution von 1848 eine »Katastrophe« war52, ein schweres, wiewohl vorhersehbares Unglück, das dennoch, dem griechischen Wortsinn entsprechend, die Möglichkeit einer Umkehr, einer Wendung zum Besseren in sich barg. Vorhersehbar war dieses Unglück, weil die neuere Menschheit sich von der durch Christus geoffenbarten göttlichen Ordnung abgewandt und einer Weltanschauung verschrieben hatte, die die Macht des »reinen Denkens« und dessen Freiheit von allen vorgegebenen, »naturwüchsigen« Ordnungen behauptete.53 Ihr Wesensmerkmal war der doppelte Anspruch, sich von allem Vorgegebenen distanzieren und zugleich radikal neu ansetzen zu können. Sie begann im 17. Jahrhundert mit Grotius als »subjektiver Rationalismus«, der in »freie[r] Thätigkeit des Gedankens« die »Uebereinstimmung des Menschen mit der Welt« aufhob und sich »selbst eine eigene Welt« schuf54, formte sich aus in den Systemen des »abstrakten Naturrechts« von Pufendorf über Thomasius und Wolff bis zu Kant und Fichte55 und entfaltete ihr destruktives Potential in der ersten französischen Revolution, die sich von allen früheren Erhebungen unterschied; war sie doch nicht bloß Empörung, sondern Umkehrung des überlieferten Herrschaftsverhältnisses selbst, insofern »Obrigkeit und Gesetz grundsätzlich und permanent unter den Menschen stehen [sollten], statt über ihnen«.56
Seinen politischen Ausdruck fand der subjektive Rationalismus in den »Parteien der Revolution«, die seit 1789 das Geschehen bestimmten: der liberalen, der demokratischen und der sozialistischen Partei.57 Der Liberalismus als Klassenpartei des Mittelstands legte alles Gewicht auf das Prinzip der individuellen Freiheit und wurde damit zum »Zugführer der ganzen Revolution«, in mancher Hinsicht verwerflicher als alles, was folgte.58 Er propagierte die »Ablösung der Menschlichkeit von der Gottesfurcht«59, die Trennung von Staat und Kirche, die »Entgliederung der Gesellschaft« und die Freiheit der Konkurrenz, und grub sich doch sein eigenes Grab, indem er sich in den Widerspruch verstrickte, einerseits »menschlich willkürlich den ganzen öffentlichen Rechtszustand neu zu machen«, andererseits aber »überall das Vermögen zur Bedingung des politischen Vollrechts« zu erklären«, womit er unvermeidlich die Kritik aller davon Ausgeschlossenen heraufbeschwor.60 »Denn, wenn der Wille des Menschen die einzige berechtigte Macht in der gesellschaftlichen Ordnung ist, warum blos der Wille der Begüterten und Gebildeten?«61
Mit dieser »Halbdurchführung der Principien der Revolution«62 wollten sich die Demokraten und Sozialisten nicht abfinden. Die ersteren, gestützt auf die »Volksmasse (peuple)«, setzten anstelle der liberalen Apotheose des Individuums die Apotheose der Gattung, die Vergötterung des Volkes, den Fanatismus der Brüderlichkeit63, brachten aber lediglich in Nordamerika eine halbwegs lebensfähige Ordnung zustande, die jedoch aufgrund der Sonderbedingungen ihrer Existenz nicht auf andere Länder übertragbar war und im übrigen auch erst noch die Probe auf ihre Dauerhaftigkeit zu bestehen hatte.64 Wahrscheinlicher (und durch die Entwicklung in Frankreich bestätigt) sei, daß der einmal in Fahrt gekommene Radikalismus der Gleichheit von der politischen auf die soziale und wirtschaftliche Ebene übergreife und zur Forderung nach Vermögensgleichheit, dem Schibboleth der sozialistischen Partei, führe.65 Deren Novum sei, daß sie nicht den Staat, sondern die Gesellschaft umgestalten wolle. Der Staat überhaupt sollte ihr zufolge aufhören, es sollte nur noch Gesellschaft geben, die statt auf Konkurrenz auf »Association« zu gründen sei, auf »Gemeinsorge und Wechselbürgschaft der Ernährung«, auf Beseitigung der »Naturwüchsigkeit der Volkswirtschaft«.66 Das Ergebnis sei indessen wie schon im Fall der Demokratie eine nicht enden wollende Nivellierung aller Unterschiede, eine Dynamik der Zerstörung, die Stahl nicht anders zu deuten wußte als den »Ausbruch einer dämonischen Macht der Vernichtung, die unter den gottgegründeten Fundamenten der gesellschaftlichen Ordnung vulkanisch lauert«.67
Angesichts der Katastrophe des subjektiven Rationalismus war es in gewissem Sinne ein Fortschritt, wenn die zeitgenössische spekulative Philosophie sich um einen neuen, ›objektiven Rationalismus‹ bemühte. Namentlich in der Philosophie Hegels erkannte Stahl »ein sicheres Bewußtseyn, daß die Losreißung des Menschen von der Welt nicht zum Wahren führe«68, sondern geradewegs zu Chaos und Anarchie. Hegel habe sich »ungemeine Verdienste« in der Bekämpfung aller Irrlehren des subjektiven Rationalismus erworben, die entweder, wie Kant, die Freiheit der Individuen und die bloße Rücksicht auf deren Koexistenz zum ausschließlichen Prinzip gemacht oder gar wie Rousseau die »Souveränetät der Masse« propagiert hätten.69 Er habe den vom Naturrecht untergrabenen Institutionen von der Familie bis zum Staat ihr Ansehen zurückgegeben und sie aus bloßen Mitteln für das Individuum wieder in Einrichtungen verwandelt, welche »ihre Nothwendigkeit, den Grund ihrer Geltung«, in sich selbst tragen, anstatt sich auf Willen und Vertrag der Individuen zu gründen.70 Schließlich habe er »die Einsicht in die Grundgestalt der sittlichen und bürgerlichen Ordnung dadurch in hohem Grade gereinigt und gefördert, daß er eine höhere (substantielle) ethische Ordnung und die Freiheit und Berechtigung des Menschen in untheilbarer Einheit als ihr Wesen erkannte.«71
Der schon bald nach seinem Tod einsetzende Rückfall seiner jüngeren Schüler auf den subjektiven Rationalismus habe indessen gezeigt, daß die von Hegel gewonnene Objektivität »eine bloß scheinbare« war.72 Wirkliche Objektivität, so Stahl, hätte darin bestanden, eine »reale Macht außer und über dem Menschen« und insonderheit außerhalb seiner Denkbestimmungen anzuerkennen.73 Tatsächlich aber habe Hegel alle Realität in diese Denkbestimmungen aufgelöst und sich einer »pantheistischen Weltanschauung« verschrieben, die nach allen Seiten bestreitbare Ergebnisse zeitige.74 Indem Gott nicht mehr wie in der christlichen Tradition als ein überweltlicher persönlicher Schöpfer gefaßt werde, sondern als unpersönliches, in sich inhaltsloses Absolutes, welches sich zu dem Gegensatz von bürgerlicher Gesellschaft und Staat dirimiere, würden beide zu sakrosankten Größen, die je unterschiedliche Objektivationen des Absoluten begründeten. Mit der ersteren habe Hegel der modernen, von Adam Smith begründeten Wissenschaft der Nationalökonomie Rechnung getragen, der wohl das Verdienst zukomme, »die große, der früheren Zeit ganz fremde Einsicht in die Naturgesetze der Gütererzeugung zu Tage gefördert« zu haben, die jedoch zugleich die Produktion »isolirt als absoluten Zweck und in abstracto als das von der Gesellschaft für die Gesellschaft erzeugte Vermögen« betrachtet und auf diese Weise vom »sittlichen und darum auch vom ächt politischen Princip« abgelöst habe.75
Andererseits habe Hegel mit seiner Bestimmung des Staates als des sich in der Geschichte verwirklichenden Gottes den von Hobbes und Rousseau auf den Weg gebrachten »Staatsabsolutismus« erneuert und zu einer »ultragouvernemental[en]« »Apotheose des Staates« gesteigert, die ebenso inakzeptabel sei wie die der Gesellschaft. Gewiß bildeten beide je für sich ein System, hier den wirtschaftlichen, dort den herrschaftlichen Verband der Nation, die durchaus einem je eigenen »Bildungsprincip« folgten. Falsch sei jedoch, sie auseinander zu reißen: »Gesellschaft und Staat, das sociale und das politische Gebiet, sind nun aber nur unterscheidbar, nicht trennbar. Sie sind nur die verschiedenen Seiten einer und derselben nationalen Existenz und Aufgabe. Sie durchdringen sich deßhalb überall ohne scharfe Gränzlinie und stehen überall in Wechselwirkung. […] Trennung des Socialen und des Politischen ist also überall ein Irrthum.«76
War dies eine Absage an die Bauprinzipien der Moderne und eine Rückkehr zum Modell der societas civilis mit ihrer Einheit von Staat und Gesellschaft, Öffentlichem und Privatem, mithin eine Bekräftigung der Positionen des klassischen Konservatismus?