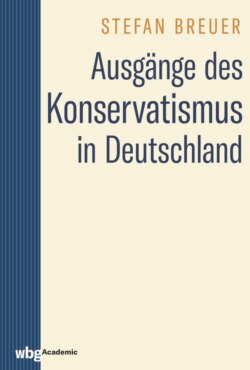Читать книгу Ausgänge des Konservatismus - Stefan Breuer - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.
ОглавлениеRudolf Meyers letztes Lebensjahrzehnt war von einer Diabeteserkrankung überschattet, die häufige Kuraufenthalte, meist in Karlsbad, nötig machte. Obwohl durch den Erlös aus dem Verkauf seiner Farm finanziell einigermaßen gesichert, war seine Einkommenslage doch nicht gut genug, um nicht hin und wieder der Aufbesserung zu bedürfen. So nahm er nach seiner Rückkehr für längere Zeit die Gastfreundschaft des Grafen Silva-Tarouca in Anspruch und beriet anschließend den Fürsten zu Salm-Reifferscheidt-Raitz in landwirtschaftlichen Fragen.112 Der Tod seines alten Widersachers Vogelsang am 8. 11. 1890 öffnete ihm auch wieder das Vaterland, dessen Oberleitung seit dem Rückzug Graf Thuns bei Egbert Graf Belcredi lag, zu dem Meyer seit den Tagen ihrer Zusammenarbeit an der Gewerbereform ein gutes Verhältnis besaß.113 Ab wann sein erneutes Engagement beim Vaterland begann und wie lange es dauerte, ist allerdings nicht zweifelsfrei festzustellen, da Meyer seine alte Sigle nicht wieder aufnahm und sich nur unklar über seine neue äußerte. Gegenüber Kautsky gab er sich als Verfasser der mit einem Vollmond gezeichneten Artikel zu erkennen und ordnete sich außerdem die Sigle »-y« zu, unter der er im Volkswirtschaftlichen Teil publiziert habe. In diesem Teil finden sich jedoch meist nur kurze, überwiegend unmarkierte Meldungen und nur selten Texte mit der erwähnten Sigle.114 Dagegen enthält der Hauptteil seit Januar 1891 zahlreiche Artikel, die mit »-y-« gezeichnet sind und sich hauptsächlich auf Frankreich und Belgien beziehen – ein Gegenstand, den Meyer zwar in den späten 70er Jahren bearbeitet hat, der nun aber außerhalb seines Itinerars lag. Mit einem Vollmond markierte Texte finden sich erst zwei Jahre später.115
Angesichts dieser Unsicherheiten hält man sich am besten an solche Texte, die Meyer mit vollem Namen andernorts publiziert hat. Das betrifft neben den Historisch-politischen Blättern, der Gegenwart und Maximilian Hardens Zukunft vor allem ein Medium, wie es mit Blick auf Meyers politische Biographie überraschender nicht sein könnte: Die Neue Zeit, das Theorieorgan der deutschen Sozialdemokratie. Zwischen Dezember 1892 und Juni 1895, also zwischen den Parteitagen von Berlin (November 1892) und Breslau (Oktober 1895), veröffentlichte Meyer dort sechzehn (!) Aufsätze, darunter zwei, die aufgrund ihrer Länge in zwei bzw. vier Folgen erschienen, ein Volumen, das sonst nur wenigen Autoren zugebilligt wurde.116 Wie ist es zu dieser ungewöhnlichen Verbindung gekommen?
Was Rudolf Meyer angeht, so hatte er dafür bereits Mitte der 70er Jahre eine wesentliche Voraussetzung geschaffen, nicht nur durch die Aufmerksamkeit, die er dem Emanzipationsstreben des vierten Standes widmete, sondern auch durch den Respekt, den er der wissenschaftlichen Leistung wie den politischen Analysen von Marx zollte.117 Persönliche Treffen mit Marx und Engels in London, ein jahrelanger brieflicher Austausch mit dem Letzteren sowie insbesondere Meyers Kritik am Sozialistengesetz bei gleichzeitiger Einforderung umfassender sozialpolitischer Reformen dürften ein Übriges dazu beigetragen haben, den Hiatus zu überwinden, der normalerweise zwischen Konservativen und Sozialisten bestand. Für den Herausgeber der Neuen Zeit, Karl Kautsky, mag ein fachliches Interesse an Meyers agrarpolitischer Expertise hinzugekommen sein, bezog er sich doch in seinem Buch über Die Agrarfrage mehrfach auf sie, selbst wenn er, wie zu zeigen sein wird, zu anderen Einschätzungen kam.118
Für Meyer war die Neue Zeit das gegebene Forum, um auf die der europäischen Landwirtschaft drohenden Gefahren durch die wachsende überseeische Konkurrenz aufmerksam zu machen und für eine Agrarreform großen Stils zu werben. Die Verschärfung der Konkurrenz, so der cantus firmus aller seiner Beiträge, treibe auch im Agrarsektor die Konzentration und Zentralisation voran, wie dies nach Marx und Engels in der geschichtlichen Tendenz der kapitalistischen Akkumulation lag.119 Sei dies zur Zeit der preußischen Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch vor allem auf Kosten der Bauern gegangen, so habe sich daran eine »Latifundienbildung« durch Aufkauf der Rittergüter durch Großgrundbesitzer angeschlossen.120 Jetzt zeichne sich ein weiteres Stadium ab: die »Entindividualisierung der Unternehmungen« durch den Übergang der Eigentumstitel auf Hypothekenbanken oder durch Umwandlung in Aktiengesellschaften.121 Die Folgen seien verheerend. Der ländliche Mittelstand werde vernichtet122, Kleineigentümer und Landarbeiter würden zur Auswanderung getrieben und die noch Verbliebenen infolge der niedrigen Löhne und der miserablen Ernährung außerstande gesetzt, die von der technischen Entwicklung bereitgestellten komplizierten Feldmaschinen zu bedienen.123 Mit einer derart heruntergebrachten ländlichen Bevölkerung, so Meyer, sei Preußen und damit Deutschland international gesehen nicht mehr wettbewerbsfähig, darüber hinaus auch nicht einmal mehr kriegsfähig, was angesichts der zunehmenden Gefahr eines militärischen Konfliktes mit Rußland, wenn nicht gar eines Weltkriegs, in höchstem Grade bedrohlich sei.124 Da die Großagrarier aufgrund kurzfristiger Profitinteressen künstlich das Getreide verknappten, entweder durch Zwischenlagerung oder durch die Umstellung der Produktion auf »Zucker, Spiritus und Stärke für das Ausland«, sei schon im Frieden mit einer Verteuerung der Lebenshaltungskosten in der Stadt wie auf dem Land zu rechnen, im Kriegsfall mit einem totalen Kollaps der Nahrungsmittelversorgung125 – eine Prognose, die sich einige zwanzig Jahre später auf drastische Weise erfüllte. Einige Tausend Großgrundbesitzer im deutschen Osten, so Meyers Fazit, belasteten das ganze deutsche Volk mit einer indirekten Steuer, weil sie nicht mehr genügend Grundrente erzielten. Hohe Grundrente aber sei
»kein Staatsinteresse, noch weniger eine Anhäufung von Latifundienbesitz, der das Land entvölkert. Und zudem ist der Staat ohnmächtig, die meisten der jetzigen Großgrundbesitzer zu schützen, er schützt hauptsächlich die Hypotheken-Aktien-Banken und hilft ihnen, die subhastirten Großgrundbesitzer auszukaufen, ohne daß sie selbst dabei zu Grunde gehen. Das hat Rodbertus mit Trauer geahnt und zu vermeiden gesucht. Aber die Regierung hat seine Rathschläge nicht befolgt. Und so wird es bald kommen, daß die Söhne und Enkel der Expropriateurs der Bauern und Büdner ihrerseits exproprirt werden durch die Hypotheken-Aktien-Banken, durch das anonyme, souveräne Kapital!«126
Hoffnung schöpfte Meyer immerhin aus der Beobachtung, daß in neuen Ländern wie den Vereinigten Staaten oder Kanada zwar nicht der Latifundienbesitz, wohl aber der Latifundienbetrieb bereits im Absterben begriffen sei und in zunehmendem Maße großbäuerlichen Betrieben weiche.127 Der preußische Staat sei deshalb gut beraten, sich auf diese Tendenz einzustellen. Anstatt Rentengüter unter Bedingungen einzurichten, die à la longue zu einer »moderne[n] ländliche[n] Leibeigenschaft« führen würden128, solle er lieber all jene Großgrundbesitzer aufkaufen, welche ohne Kornzölle nicht bestehen könnten, und alsdann sukzessive alle Schutzzölle, auch die industriellen, aufheben.129 Wenn nötig, könne man zum Mittel der Expropriation greifen, wie dies in Irland geschehe, wo die Regierung einen großen Teil der Grundbesitzer enteigne und sie zwinge, »ihre Gründe an die bisherigen Pächter zu veräußern.« 130 Denkbar sei auch, sie in Domänen zu verwandeln, auf denen der Staat Lebensmittel für das eigene Volk produzieren könne.131 In jedem Fall aber sei es geboten, alle landwirtschaftlichen Großbetriebe mit mehr als 100 ha, unter Umständen auch Kleingüter von 20 bis 100 ha, unter Staatsaufsicht zu stellen; auf diese Weise werde es möglich, Anbaupläne zu entwerfen, die eine ausreichende Ernährung der Bevölkerung mit Getreide sicherstellten.132 Ergänzend sollten alle Zölle auf notwendige Lebensmittel aufgehoben werden, desgleichen die Exportprämien auf Zucker und Spiritus; sollte dies nicht genügen, könnten auch Ausfuhrzölle auf diese Produkte sowie auf Stärke festgelegt werden.133 Weitere Empfehlungen betrafen die Bildung von Zwangsgenossenschaften bezüglich Drainage, Bewässerung und den Einsatz von Dampfpflügen, außerdem die Einführung eines obligatorischen Heimstättenrechts.134
Zur Lösung der ländlichen Arbeiterfrage empfahl Meyer eine höhere Entlohnung nach englischem Vorbild, bessere Ausbildung und Schutz vor der Konkurrenz durch ausländische Saisonarbeiter, die zumal in Ostelbien die Löhne drückten und à la longue ganz Norddeutschland zu ›polonisieren‹ drohten.135 Wichtig seien außerdem Chancen zum sozialen Aufstieg, insbesondere, indem man Wege eröffne, »den Landlohnarbeiter in einen selbständigen Bauer zu verwandeln, der Herr seiner Productionsmittel und Besitzer seiner Producte ist.«136 Zielten die Anfang der 70er Jahre gemachten Vorschläge noch in erster Linie darauf ab, den Großgrundbesitz zu stärken, indem man ihm seßhaft gemachte, aber nach wie vor auf Lohneinnahmen angewiesene Landarbeiter zur Verfügung stellte, so rückten sie jetzt in eine Perspektive, die vom Gedanken beherrscht war, daß der kapitalistische Großbetrieb seine transitorische Aufgabe erfüllt habe. Wie Max Sering, der zwei Jahre nach ihm Nordamerika bereist und darüber ein umfangreiches Buch publiziert hatte137, sprach auch Meyer von der sinkenden Rentabilität der Riesenfarmen und einer Schwerpunktverlagerung der landwirtschaftlichen Produktion auf die kleinen und mittleren Güter.138 Seine früher geäußerten Bedenken hinsichtlich der Konkurrenzfähigkeit des Kleinbetriebs nahm er explizit zurück. Als er dies geschrieben habe, ließ er Kautsky wissen, habe niemand ahnen können, »dass die ›verflixten‹ Amerikaner solche Feldmaschinen erfinden würden, welche plötzlich den ›intelligenten Kleinmaschinenbauer‹ alle seine Concurrenten schlagen lassen!«139 »Die ›handwerksmäßige‹ Bauernlandwirthschaft«, hieß es an anderer Stelle, erschlage »vor unseren Augen die landwirthschaftliche Fabrik, den landwirthschaftlichen Großbetrieb« und eröffne so die Hoffnung auf eine Wiederkehr der traditionalen Ordnung, mit »schmucken Häuschen für je eine Familie« nebst einigen Knechten, »mit Garten und Feld dabei«. Das klingt wie eine Vorwegnahme des Auenlands der Hobbits bei Tolkien. Auf »große Kraftmaschinen und gewaltige Arbeitsobjekte, wie Schiffskörper und Lokomotiven« wollte Meyer indes nicht verzichten.140
Im Briefwechsel mit Meyer ließen weder Engels noch Kautsky im Zweifel, daß sie solche Szenarien nicht teilten. Für beide war ausgemacht, was gleich zu Beginn des Erfurter Programms von 1891 als Dogma formuliert wurde: daß die ökonomische Entwicklung sowohl im Handwerk als auch in der Landwirtschaft vom unvermeidlichen Untergang des Kleinbetriebes bestimmt sei.141 Der forcierte Ton, in dem diese Überzeugung vorgetragen wurde, vermochte jedoch kaum die Unsicherheit zu überdecken, die sich in den näheren Ausführungen immer wieder zeigte. Sah sich schon Engels gegenüber Meyer zu dem Zugeständnis genötigt, die Entwicklung des Kapitalismus vollziehe sich im agrarischen wie im industriellen Sektor nicht in klar voneinander getrennten Stadien, weil »der Latifundienbetrieb auf die Dauer den Kleinbetrieb und dieser wieder ebenso sehr und ebenso notwendig jenen erzeugt«142, so kam auch Kautsky, obschon erst einige Zeit nach Schluß der Debatte, zu dem Ergebnis, »daß der Kleinbetrieb in der Landwirthschaft keineswegs in raschem Verschwinden ist, daß die großen landwirthschaftlichen Betriebe nur langsam an Boden gewinnen, stellenweise sogar an Boden verlieren«.143 Der an die Adresse Meyers gerichtete Vorwurf, von der früheren Einsicht in die Unhaltbarkeit des Kleinbetriebes abgerückt zu sein, wurde an anderer Stelle durch das Eingeständnis relativiert, es sei nicht daran zu denken, daß der kleine Grundbesitz in der heutigen Gesellschaft verschwinden und völlig von dem Großbesitz verdrängt werde.144
Eine Zeitlang sah es so aus, als sei in dieser Frage mit dem Erfurter Programm das letzte Wort in der SPD noch nicht gesprochen, war die Partei doch ein heterogenes Gebilde, in dem sich nicht nur die Anhänger einer an rein proletarischen Klasseninteressen ausgerichteten, der bestehenden Staats- und Rechtsordnung opponierenden Politik sammelten. Vertreten wurde die Gegenposition auf pragmatisch-praktische Weise durch den Führer der bayerischen Sozialdemokratie, Georg von Vollmar, der 1893 in einer Rede über »Die Bauern und die Sozialdemokratie« die Bauern aufforderte, sich zu organisieren und zusammen mit der Arbeiterschaft »den Staat zu zwingen, daß er die Ausbeutungsfähigkeit des Kapitalismus in wachsendem Maße einschränke«, anders ausgedrückt: die bestehenden Kleinbetriebe vor der Konkurrenz schütze.145 Sukkurs kam aus Hessen von Eduard David, der seinen Parteigenossen vor Augen hielt, daß in der Landwirtschaft andere Gesetze gälten als in der Industrie, sei doch »ein Auffressen der kleinen Betriebe durch die mittleren, der mittleren durch die großen und der großen durch die Riesenbetriebe […] als Massenerscheinung in der Landwirthschaft nirgends zu konstatiren.«146 Im Gegenteil sei zu erwarten, »daß die Kleinbauern, da sie in hohem Maße keine Waarenproduktion, sondern Produktion zum Selbstgebrauch treiben, […] wenn nicht konkurrenzfähig, so doch in viel höherem Maße existenzfähig bleiben, als der inländische Großbetrieb, der mit der vollen Breitseite dem Angriff der überseeischen Konkurrenz ausgesetzt ist«. Nehme man die Zwergbesitzer hinzu, so sei deutlich, daß die Zukunft der Landwirtschaft statt durch die Konzentration des Eigentums durch dessen »Pulverisirung« bestimmt sein werde, worauf sich die sozialdemokratische Programmatik einzustellen habe.147 Auch wenn der Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung, Bruno Schoenlank, so weit nicht gehen wollte, mahnte er doch seine Partei: »Wir müssen verhüten, daß die nägelbeschlagenen Schuhe der Bauern und der Bauernsöhne sich gegen uns wenden, wir müssen sie neutralisieren, pazifizifieren.«148 Zwei Jahre später gehörte er zu den ersten, die Werner Sombarts Sozialismus und soziale Bewegung einen hymnischen Empfang bereiteten, einem Werk, das die Unanwendbarkeit des Marxschen Systems auf die agrarische Produktion behauptete und für eine »Aufnahme jener kleinwirthschaftlichen Elemente in den Rahmen der Bewegung« eintrat.149
Aus parteitaktischen Gründen hüteten sich die Genannten, sich direkt auf die Arbeiten eines erklärten Konservativen wie Rudolf Meyer zu berufen. Daß diese gleichwohl bekannt waren und z. T. geschätzt wurden, zeigen indes die Interventionen von Paul Ernst, der Ende der 80er Jahre über die Friedrichshagener Bohème zu den »Jungen« in der SPD gestoßen (und darüber mit Engels in Streit geraten) war, an verschiedenen sozialdemokratischen Blättern als Redakteur gearbeitet hatte und trotz wachsender Distanz zur Partei bis 1898 in der Neuen Zeit publizierte.150 Seit 1891 in brieflichem und persönlichem Kontakt mit Meyer, bekräftigte er dessen These, »daß heute der Kleinbesitz konkurrenzfähiger ist, wie der große«, womit er allerdings allein den kleinbäuerlichen Besitz meinte, nicht den bäuerlichen. Während die Bauern im allgemeinen »Arbeiterschinder« seien und daher als »unsere erbittertsten Feinde« zu gelten hätten, stünden die Kleinbauern in keinem Interessengegensatz zu den Arbeitern. Aufgrund ihrer großen Zahl müsse es unbedingt vermieden werden, sie – etwa durch die Drohung mit Expropriation – zu Gegnern zu machen. »Ihnen müssen wir vielmehr ihren Besitz garantiren, sie durch gewisse Reformen uns geneigt machen – Schuldentlastung etc. – und im Uebrigen hoffen, daß sie im Laufe der Zeit, wenn sie erst der große Produktionsaufschwung auf den rationell betriebenen, im Eigenthum des Staates befindlichen Gütern überzeugt, daß sie bei ihrer überkommenen Weise schlechter fahren, von selbst dem Staat ihren Besitz übergeben werden, um eine bessere Nährstelle einzutauschen.«151 Das liest sich wie eine Paraphrase zu Meyers Texten, und tatsächlich berichtet dieser im Anhang zu seinem Buch über den Capitalismus fin de siècle, daß Ernst ihm während einer längeren Krankheit bei der Abfassung des Werkes assistiert habe.152
Die reformistischen Dissidenten erarbeiteten 1895 eine Reihe von Vorschlägen, die das Erfurter Programm ergänzen sollten. Diese Vorschläge – neben steuerlichen Erleichterungen und einer Verstaatlichung der Hypotheken- und Grundschulden eine Erweiterung des öffentlichen Grundeigentums und dessen Verpachtung entweder an Genossenschaften von Landarbeitern und von Kleinbauern oder an sog. Selbstbewirtschafter153 – riefen indes an der Parteibasis einen Sturm der Entrüstung hervor, schienen sie doch den besitzlosen Proletariern zuzumuten, besitzende Bauern zu unterstützen und eine Zusammenarbeit mit eben dem Staat anzustreben, der von 1878 bis 1890 die Sozialdemokratie aufgrund ihrer angeblich »gemeingefährlichen Bestrebungen« kriminalisiert hatte.154 Kautsky und seine Gefolgschaft hatten auf dem Breslauer Parteitag von 1895 daher wenig Mühe, eine vollständige Verwerfung der Reformvorschläge durchzusetzen.155 Die Reinheit der Lehre konnte auf diese Weise gesichert werden, jedoch um den Preis einer Politik, die de facto nicht nur den Großbetrieb, sondern auch den Großgrundbesitz stabilisierte, da sie ihn den politisch nicht zu beeinflussenden ökonomischen Gesetzmäßigkeiten überließ.156 Erst lange nach dem Krieg gestand Kautsky, er sei zu der Einsicht gekommen, daß David (und damit auch: Rudolf Meyer) »in einem Punkte recht hatte: Die Entwicklung geht in der Landwirtschaft nicht in der Richtung des Zurückdrängens des Kleinbetriebs durch den Großbetrieb vor sich.«157
Ob diese Einschätzung zutreffender war als die Prognose des Erfurter Programms, kann hier nicht diskutiert werden.158 Für Rudolf Meyer jedenfalls, der der SPD noch 1894 attestierte, die letzte Partei zu sein, »welche noch bedingungsweise einer nationalen Politik fähig ist«159, war mit dem Breslauer Parteitag der Augenblick gekommen, auch dieser Hoffnung Valet zu sagen. Seine Mitarbeit an der Neuen Zeit hörte Anfang 1896 auf, und obschon er mit Kautsky weiterhin im Briefwechsel blieb, war sein Elan doch gebrochen. Am 16. Januar 1899 ist er in Dessau im Haus eines Sohnes von Hermann Wagener gestorben.160 Die Neue Zeit widmete ihm einen Nachruf, der ihm einen »ehrenvollen Platz in der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie« zuerkannte.161