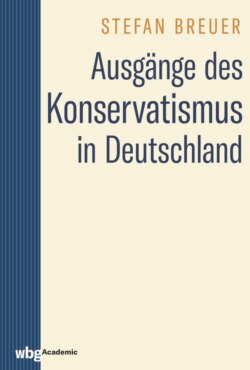Читать книгу Ausgänge des Konservatismus - Stefan Breuer - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.
ОглавлениеRudolf Meyer wurde 1839 in der Neumark als Sohn eines Rittergutspächters geboren.9 Er besuchte verschiedene Schulen in Pommern, zuletzt eine Art Handelsschule in Stettin, deren Abschlußzeugnis die Aufnahme eines Universitätsstudiums ermöglichte.10 An der Berliner Universität belegte er zunächst naturwissenschaftliche Fächer, wandte sich dann aber der Geschichte, der Philosophie und schließlich auch der Nationalökonomie zu, der Disziplin, in der er nach einigen Unterbrechungen 1874 in Jena bei Bruno Hildebrand promovierte, mit einer Doktorarbeit über den Sozialismus in Dänemark, die ein Jahr später als Buch erschien.11
Für die Unterbrechung seiner Studien war vor allem der Umstand verantwortlich, daß Meyer seit 1867 an der Berliner Revue mitarbeitete, des seit 1855 neben der ›Kreuzzeitung‹ wichtigsten konservativen Organs in Preußen.12 Die in ihn gesetzten Erwartungen enttäuschte er nicht. Er erwies sich nicht nur als ein ungemein produktiver Journalist – die von ihm redigierten letzten vier Jahrgänge der Revue, immerhin sechzehn voluminöse Quartalsbände, stammten zu einem erheblichen Teil von ihm selbst – , er nahm vor allem den Ende der 60er Jahre aufkommenden Ruf nach einer energischeren Interessenvertretung des Grundbesitzes auf, der sich durch die Steuerreform von 1861 benachteiligt sah, außerdem unter wachsender Verschuldung und Abwanderung der ländlichen Arbeitskräfte litt.13 Als sich Anfang 1870 die verschiedenen Anläufe zur Organisierung verdichteten und zur Verabschiedung des »Breslauer Programms« durch eine Versammlung von Land- und Forstwirten führten14, begrüßte Meyer dies, kritisierte aber zugleich die liberalen Einschläge, die sich dort fanden, insbesondere die Ablehnung staatlicher Bevormundung im Kredit- und Versicherungswesen, die sich zum Nachteil der ländlichen Bevölkerung auswirke.15 Alternativ dazu empfahl Meyer, das landwirtschaftliche Kreditwesen zu verbessern, die Einkommen aus Kapital stärker zu besteuern und den Staat auf verkehrspolitischem Gebiet zu aktivieren – Punkte, die wörtlich aus einer Vorlage von Rodbertus übernommen waren, mit dem Meyer seit 1870 im brieflichen und persönlichen Austausch stand.16 Das alles zielte auf die Bildung einer »Grundbesitzerpartei«, die den bereits bestehenden Vertretungen der »Capitalisten« und der »Proletarier« Paroli bieten sollte, und zwar expressis verbis »in den Parlamenten«.17 »Ein leistungsfähiger, selbstbewußter Grundbesitzerstand«, hieß es im Sommer 1871 in der Berliner Revue, »ist der feste Wall, welchen die nach Privilegien ringenden Bestrebungen der Capitalisten und der Ansturm der Proletarierbataillone nicht stürzen dürfen, soll nicht Reich und Staat zu Grunde gehen – wie in Frankreich im grauenhaften Würgerkrieg [sic] der rothen und der blauen Republikaner.«18
In einer Epoche, die durch die Tendenz zur Demokratisierung des Wahlrechts und zur Herrschaft des Majoritätsprinzips gekennzeichnet war, mußte eine Grundbesitzerpartei allerdings in der Lage sein, die Zustimmung größerer Wählergruppen zu gewinnen, als sie allein der Besitz gewähren konnte. Die Chancen dafür erschienen Meyer auf dem Land gegeben zu sein, wo in Preußen 1870 noch zwei Drittel der Bevölkerung lebten. Um zu verhindern, daß diese den sozialistischen oder klerikalen Agitatoren in die Hände fielen, riet Meyer den Grundbesitzern, »sich ihrer und der ländlichen Arbeiter gemeinschaftlichen Interessen bewußt zu werden« und insbesondere Sorge zu tragen, »daß sich der Klassengegensatz zwischen Grundbesitzern und ländlichen Arbeitern, wo er schon besteht, verwischt, wo er nicht besteht, auch nicht zur Geltung gelangt«.19
Auch hierfür griff Meyer auf Anregungen von Rodbertus zurück. So empfahl er den Grundbesitzern »die Einführung der Rodbertus’schen Rentenidee in die Gesetzgebung«20, wonach »eine Hypothek nur auf den bodenbedingten landwirtschaftlichen Ertrag aufgenommen werden können sollte, jedoch nicht auf den Boden als nach Kapitalmarktvorgaben und veränderlichem Zins bewertetes Gut«.21 Einige Monate später folgte, nach eingehenden Beratungen mit Rodbertus und Hermann Wagener, eine weitere Intervention zu der Frage, wie sich auf dem Land eine »Solidarität der Interessen zwischen Grundbesitzer und Arbeiter« herstellen lasse, welche »beide zu gemeinschaftlicher Arbeit in Bezug auf Betheiligung am staatlichen Leben« ermuntern würde.22 Hatte Rodbertus das »Haupthinderniss des landwirthschaftlichen Fortschritts« in der massenhaften Abwanderung der ländlichen Arbeiterklassen gesehen und diese wiederum auf deren »Eigenthumslosigkeit« zurückgeführt, der allein durch die Schaffung »freieigenthümlicher Hofstellen« zu begegnen sei23, so griff Meyer diesen Vorschlag auf und präzisierte ihn mit Blick auf die sogenannten »herrschaftlichen Tagelöhner«. Diese sollten durch die Einrichtung kleiner Büdnerstellen zu »Grundbesitzern zweiter Klasse« werden, die als Gegenleistung für das ihnen überlassene Land zu bestimmten, zeitlich begrenzten Dienstleistungen für den Grundbesitzer verpflichtet sein sollten. Damit sei den Interessen beider Klassen gedient. Die Grundherren würden Land, das sie ohnehin nicht bestellen könnten, gegen die dringend benötigten Arbeitskräfte eintauschen, die Arbeiter umgekehrt ihre Arbeitskraft gegen die Möglichkeit des sozialen und wirtschaftlichen Aufstiegs. Der Arbeiter, so Meyer, höre »zwar nicht auf, Arbeiter zu sein, – ja nicht einmal ganz, für Lohn zu arbeiten, – aber er ist doch auch in die Reihe der Eigenthümer, Grundbesitzer getreten, und mit jedem Jahre wird er weniger (Lohn-)Arbeiter und mehr Grundbesitzer.« Hiermit sei nicht nur »die glücklichste Vermittelung zwischen diesen beiden Ständen geschaffen«, sondern mehr: ein Ausgleich zwischen Herren und Arbeitern in Richtung eines einzigen »Grundbesitzerstandes«, dessen politisches Gewicht erheblich sein werde.24
Das liest sich auf den ersten Blick so, wie es Adalbert Hahn in seiner bis heute unentbehrlichen Studie über die Berliner Revue aufgefaßt hat: als Absage an den Großgrundbesitz und als Votum für eine Förderung des Mittel- und Kleinbesitzes, bis das ganze Land von einem dichten Netz kleiner Eigentumsstellen überzogen sei.25 Diese Deutung ist jedoch von einem Bias geprägt, der sich dem Bemühen verdanken mag, es bestimmten Strömungen in der NSDAP recht zu machen, die entweder direkt feindlich gegen den Großgrundbesitz eingestellt waren oder doch wenigstens auf eine Nivellierung der ständischen Differenzen drängten.26 Meyer indessen hatte zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs die Absicht, das agrarische Milieu in eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft zu verwandeln. Zwar brachte er zusammen mit Schumacher-Zarchlin auf der Konferenz ländlicher Arbeitgeber im Mai 1872 einen Antrag durch, mit dem die Regierungen von Preußen und den beiden mecklenburgischen Großherzogtümern aufgefordert wurden, »die geeigneten Schritte [zu] thun, welche den ländlichen Arbeitern die Erwerbung eines kleinen Grundeigenthums ermöglichen und thunlichst erleichtern« sollten, und wiederholte diese Forderung auch in der Folgezeit mehrmals27, 1874 sogar bis zur Zuspitzung eines »Bauern-socialistischen Reform-Conservatismus«, der auf eine »Umwandlung der besitzlosen ländlichen Arbeiter in kleine Grundbesitzer« nach dem Beispiel Frankreichs ziele.28
Diese Aussagen dürfen jedoch nicht zum Nominalwert genommen werden. Schon ein Jahr nach der erwähnten Konferenz forderte er die ländlichen Arbeitgeber zu einer Adresse an die Regierung auf, sich nicht mit der ländlichen oder städtischen Arbeiterfrage allein zu befassen, sondern an die »ganze wirthschaftliche Gesetzgebung die bessernde Hand an[zu]legen«.29 Wie er sich dies vorstellte, führte er in einer kurz danach erschienenen Broschüre aus. Gewiß sei es kurz- und mittelfristig eine sinnvolle Strategie, nach Abhilfen für den Arbeitskräftemangel auf dem Land zu suchen; und gewiß auch gehörten dazu Mittel wie »eine neue staatliche Fixirung des Lohnes für das Normalwerk«, strenge Wuchergesetze und Schutzmaßregeln für die Arbeit sowie vor allem: die Eröffnung der Möglichkeit, »ein kleines Eigentum für Arbeiterfamilien« zu schaffen.30 Das alles aber seien Notbehelfe, die die schon jetzt zu registrierende Entwicklungstendenz in der Landwirtschaft nicht aufzuheben vermöchten. Diese sei bestimmt durch die rasch fortschreitende Mechanisierung in Gestalt von Mäh-, Dresch- und Säemaschinen und bald auch des Dampfpfluges, deren Einsatz nur auf großen Gütern sinnvoll sei, dort aber auch zu einer Steigerung der Produktivität führe, mit der kleine und mittlere Betriebe nicht mithalten könnten. Die »Tage des kleinen Betriebes der Landwirthschaft«, so Meyer, achtzehn Jahre vor dem Erfurter Programm der SPD, seien gezählt; »der kleine Grundbesitz wird verschwinden, wie das Handwerk es thut. Ein Fehler also wäre es, ihn künstlich schaffen zu wollen.«31 Dem Ansinnen mancher seiner Freunde im konservativen Lager, »im Osten wieder einen Mittelstand, einen Bauernstand [zu] schaffen«, widersprach Meyer deshalb entschieden. »Dies ist meiner Ansicht nach unmöglich. Der Großbetrieb ist auch in der Landwirthschaft das einzig Mögliche für die Zukunft.«32
Diese Ansicht vertrat Meyer auch noch neun Jahre später, in der zweiten Auflage des Emanzipationskampfes. In expliziter Abgrenzung von der ›Kreuzzeitung‹ und der von ihr favorisierten »Zunftreaction« und unter ebenso expliziter Berufung auf Lassalle, demzufolge die große Industrie durch nichts anderes besiegt werden könne »als durch die – noch grössere, durch die grösseste Industrie«, wies Meyer alle Bestrebungen zurück, sich dem Gang der Entwicklung entgegenzustellen.33 Wie im städtischindustriellen Gewerbe werde auch in der Landwirtschaft »der Grossbetrieb zweifellos in nicht allzulanger Zeit mehr und mehr Platz greifen« und »eine mit ›Actiencapital‹ betriebene Latifundienwirthschaft« hervorbringen, welche allein noch rentabel zu produzieren imstande sein werde. Da jedoch auch eine hochmechanisierte Landwirtschaft noch der Arbeitskräfte bedürfe, wenn auch nicht mehr im gleichen Umfang; da ferner der Staat aus wehrwirtschaftlichen Gründen ein Interesse an einer hinreichend großen Landbevölkerung habe, sei es wünschenswert, »neben diesem Grossbetriebe grundbesitzende Landarbeiter« zu haben, »die doch in ihren Gärten nur für den Bedarf des eigenen Heerdes produciren.«34
Eine solche »Sesshaftmachung der Arbeiter« habe »ohne Beraubung der Grundbesitzer« zu geschehen und in einer Weise zu erfolgen, die sicherstelle, daß nicht aus unzufriedenen Arbeitern noch unzufriedenere Grundbesitzer würden – ein Ziel, das sich am besten mit dem von einigen Liberalen (!) vorgeschlagenen Verfahren erreichen lasse, den Abschluß von Pachtverträgen zu erleichtern.35 Auf diese Weise würden den erfolgreich wirtschaftenden Arbeitern Aufstiegschancen in den Stand der Rentengutsbesitzer eröffnet und die Irrwege abgeschnitten, die sie sonst veranlassen könnten, Landarbeitergewerkschaften zu gründen oder gar für eine »Revolutionirung unserer ländlichen Verhältnisse« einzutreten.36 Auch werde eine Entwicklung in Richtung des Parzellensystems abgeschnitten, das sich in Frankreich als überaus verderblich, weil nur zur Überschuldung führend, erwiesen habe. »Wir paar deutschen Social-Conservativen wussten wohl, weshalb wir grundbesitzende Arbeiter schaffen wollten. Arbeiter, nicht kleine Ackerbauer, wie v. d. Goltz will, weil wir den Grossbetrieb als volkswirthschaftlich allein richtig anerkennen und erhalten wollen. Grundbesitzende Arbeiter, weil wir principielle Vertheidiger des Grundbesitzes schaffen wollen.«37
Meyer beließ es indes nicht bei publizistischen Interventionen. Vielmehr warb er, in Abstimmung mit Wagener und Rodbertus (wenn auch mit beiden nicht immer d’accord)38, auf verschiedenen Foren um politische Unterstützung für seine Forderungen. So besuchte er im Februar 1872 den Kongreß deutscher Landwirte in Berlin und setzte sich gemeinsam mit Rodbertus und Schumacher für eine Enquête zur Lage der ländlichen Arbeiter ein, die insbesondere die Reallohnentwicklung über einen längeren Zeitraum ermitteln sollte.39 Es folgte der bereits erwähnte Auftritt auf der Konferenz ländlicher Arbeitgeber im Mai 1872, bei der er neben der Möglichkeit des Eigentumserwerbs auch für den gesetzlichen Normalarbeitstag und Maßnahmen der sozialen Sicherung warb.40 Ein Artikel von 1873 verlangte »Maßregeln, die den Landarbeitern steigenden Lohn mit steigender Productivität sichern« sollte.41 Ein gemeinsam mit Rodbertus und Adolph Wagner 1875 auf dem Kongreß der Landwirte eingebrachter Antrag auf Einrichtung einer staatlichen Untersuchungskommission über die wirtschaftliche Lage der arbeitenden Klassen auf dem Lande wurde zwar angenommen, blieb aber folgenlos.42 Ebenso leer liefen seine Bemühungen, den 1872 gegründeten Verein für Sozialpolitik für seine Ideen zu gewinnen.43 Es half auch nichts, daß Hermann Wagener sie sich zu eigen machte und bei Bismarck für eine »Vermehrung der kleinen ländlichen Besitzungen« eintrat, um dadurch »der Staatsgewalt gegenüber der fluctuirenden industriellen Arbeiterbevölkerung in einem sesshaften ländlichen Grundbesitze und Arbeiterstande einen materiellen Rückhalt zu schaffen und zugleich […] dieser Bevölkerung die Fundamental-Institutionen des Staates als auch für ihr Privatinteresse wirksam und wohlthätig erscheinen zu lassen«.44
Die Chancen für eine Umsetzung dieser Programmatik verringerten sich vollends ab 1873, als Wagener in den Strudel des oben erwähnten Gründerskandals geriet und dadurch nicht nur sein Amt als Erster Vortragender Rat verlor, sondern wegen einer Verurteilung zu hohen Schadensersatzzahlungen auch die Berliner Revue nicht mehr halten konnte.45 Nach neuzehn Jahren mußte sie sich im Januar 1874 von ihren Lesern verabschieden.46 Während Wagener sich mit öffentlichen Stellungnahmen zurückhielt, versuchte Meyer, ihn durch Gegenangriffe zu entlasten, die insbesondere darauf zielten, einen Keil zwischen Bismarck und die Nationalliberalen zu treiben. In einer Serie von Social-politischen Flugblättern und verschiedenen Artikeln in der Deutschen Eisenbahn-Zeitung forderte er 1874 den Reichskanzler auf, den Liberalen nicht länger freie Hand zu lassen und sozialpolitisch aktiv zu werden.47 Das Kaisertum solle die »Emancipation des vierten Standes vom Joche des Capitalismus« zu seiner Sache machen, indem es den Normalarbeitstag durchsetze, Kinder- und Sonntagsarbeit verbiete und von Ausnahmegesetzen gegen die Sozialdemokratie absehe.48
Noch im selben Jahr publizierte Meyer den ersten Band seines opus magnum über den Emanzipationskampf des vierten Standes, der gleichzeitig in einer stark gekürzten Volksausgabe erschien. Darin trat er für ein umfassendes Reformprogramm ein, das eine gleichmäßigere Verteilung des Reichtums durch Steuerreformen, Mindestlöhne und ein Maximum für Zinsen vorsah und dem Staat neue Felder zur sozial- und wirtschaftspolitischen Aktivität zuwies.49 Neben dem Wohnungsbau für seine Beamten solle der Staat auch »das Eisenbahnwesen, Versicherungs- und zum Theil das Bankwesen vorläufig« der Privatindustrie entziehen. Um der sozialen Polarisierung entgegenzuwirken und die »aufsteigende Klassenbewegung« zu fördern, seien darüber hinaus durch gesetzlichen Zwang Arbeitgeber und Arbeiter zu sich selbst verwaltenden »Gewerkvereinen« mit eigenen, aus gleichen Beiträgen zu finanzierenden »Gewerkskassen« zusammenzufassen, denen obligatorisch die Sorge in allen Fällen von Krankheit, Invalidität und Armut zu übertragen sei.50 Das waren Vorschläge, die zwar nicht mehr ganz neu waren, bei Liberalen wie »Altkonservativen« jedoch gleichermaßen Protest hervorriefen und selbst bei den Arbeitern wenig Anklang fanden. Als Bismarck knapp zehn Jahre später einiges davon in freilich stark abgewandelter Form in seine Sozialgesetzgebung aufnahm, stieß er damit ausgerechnet bei der Sozialdemokratie auf vehemente Ablehnung, teils, weil man die vorgesehenen sachlichen Leistungen für unzureichend hielt, teils weil man die dahinter stehende Gesinnung verdächtigte.51
Im gleichen Maße, in dem Meyer einsehen mußte, daß seine Vorschläge in den Wind gesprochen waren, vergrößerte sich seine Distanz zu dem Milieu, dem er sich bis dahin zugehörig gefühlt hatte. Glaubte er noch im Frühjahr 1872, die ›altconservative Schule‹ in eine ›neuconservative‹ überführen zu können, die sich dadurch auszeichnen sollte, daß sie sich nicht mit der Befestigung des Großgrundbesitzes begnügte, sondern den Grundbesitz möglichst verallgemeinerte52, so war davon gut ein Jahr später nicht mehr die Rede. In einem dezidiert als »Grabschrift« ausgewiesenen Artikel konstatierte er den »Verfall der conservativen Partei«, der ihm nicht zuletzt durch das Versagen der konservativen Presse, allen voran die ›Kreuzzeitung‹, verursacht zu sein schien, aber auch durch die mangelnde Bereitschaft der Partei, auf die von Wagener und Rodbertus entwickelten Ideen einzugehen.53 Eine weitere Artikelfolge zum Thema »Was ist conservativ?« kam zu dem betrübenden Ergebnis, »daß ein großer Theil der Conservativen bei uns ein ebenso verhängnißvolles Bündniß mit der liberalen Bourgeoisie eingehen will, wie es sich in Frankreich vollzogen hat.«54
Wie tief der Graben inzwischen war, der den Kreis um Wagener und Meyer von den sich konservativ nennenden Parteien trennte, zeigen die Worte, mit denen der Redakteur der Berliner Revue im Januar 1874 von seinen Lesern Abschied nahm.55 Keine dieser Parteien, so sein Fazit, habe die neuen Aufgaben begriffen, die sich ihr gestellt hätten – die nationale so wenig wie die kirchlich-religiöse, um von der sozialen zu schweigen, für die man nur die Antwort der Repression gefunden habe. Man habe sich deshalb von ihnen trennen müssen, um die »Gründung einer deutschen conservativen Reformpartei« in die Wege zu leiten, einer, wie es in anderem Zusammenhang hieß, »neuen Regierungspartei«, die daran gehen werde, die gegensätzlichen Interessen durch »Erweiterung des Kreises der Besitzenden« zu versöhnen.56
Die Regierung freilich, auf deren Unterstützung man zunächst noch hoffte, hielt sich zurück. So begann Meyer, der sie bis dahin in allen Belangen verteidigt hatte, in der Frage der Schulaufsicht sogar gegen die Konservativen57, auch diesen potentiellen Alliierten mit Kritik zu überziehen. Der Kanzler habe sich, so der Vorwurf, in immer stärkere Abhängigkeit vom großen Bankkapital, insbesondere des »Disconto-Bleichröder-Ringes« begeben, dessen Ziel es sei, »die Bankiers und ihre Helfershelfer auf Kosten der Grundbesitzer zu bereichern und diese unter deren Herrschaft zu bringen, den Grundbesitz schliesslich zu Gunsten einer Finanzclique zu expropriiren, wie die Juden des Foncier dies beabsichtigten«58 – eine Anspielung auf die Wirtschaftspolitik Napoleons III. und das von ihr geschaffene System des Crédit Foncier bzw. Mobilier, über das Meyers Urteil eigentümlich zwiespältig ausfiel. In seinem ursprünglichen Zuschnitt eine durchaus großartige, die Keime eines »cäsaristische[n] Socialismus auf St. Simonistischer Grundlage« enthaltende Konzeption, mit deren Hilfe Napoleon Frankreichs Aufstieg enorm gefördert habe, sei dieses System doch schon in Frankreich selbst gescheitert, weil es sich zu eng mit dem Finanzkapital eingelassen habe.59 Das gleiche Schicksal erlebten gegenwärtig Napoleons Nachahmer, zu denen auch Bismarck zu rechnen sei, der »den Bankiers zu einer Macht in Deutschland« verholfen habe, »der sich jetzt fast Alles und Alle beugen müssen, wenn sie nicht vernichtet werden wollen«60: »Anstatt die Erhaltung der Familien im Besitz und die Ansiedelung der Landarbeiter durch das Rentensystem zu fördern und den Grundbesitz von der Finanzherrschaft frei zu machen«, wie Wagener und Rodbertus ihm geraten hätten, habe Bismarck »das Entstehen von Capitalistenbanken begünstigt, die den Grundbesitzern den Hals abschneiden und – die schliesslich selbst zum grossen Teil pleite gehen werden.«61
Das berührte sich, auch und gerade in der Identifikation von Bankkapital und Judentum, mit der in Frankreich schon vor 1848 einsetzenden antisemitischen Agitation, die in Deutschland seit den 1860er Jahren ein Echo fand und im Zuge des Gründerkrachs eskalierte.62 Schon in seiner Kritik der »Central-Boden-Credit-Actien-Gesellschaft« scheute sich Meyer nicht, diese als »kosmopolitisch-jüdisch« zu denunzieren und sie damit gleichsam zu expatriieren.63 Die Macht der liberalen Parteien schien ihm dadurch erklärbar zu sein, »daß die Leiter der Presse, die Redacteure, im intimsten Verkehr mit den Führern im Parlament und mit den Capitalisten und Börsenkönigen lebten«, einem Verkehr, der »vornehmlich durch die gemeinsame, canaanitische Abstammung vieler der Vorzüglichsten« jener Parteien erleichtert werde.64 Im zweiten Band des Emanzipationskampfes referierte er über zehn Seiten kommentarlos die Invektiven des Fourieristen Alphonse Toussenel und verkündete im Kapitel über Österreich seine feste Überzeugung, »dass die Juden, beschnittene und unbeschnittene, welche heute thatsächlich in Wien herrschen, hier wie überall die Zersetzung eminent fördern«.65 In Belgien sei ein großer Teil der Industrie in jüdischen Händen, in Frankreich habe nach der Niederlage im Krieg gegen Deutschland eine liberale Clique die Macht ergriffen und eine »Judenwirthschaft« installiert. Selbst beim Sieger müßten Parlament und Regierung längst sich den Juden beugen. Deutschland stehe unter der »Herrschaft einer capitalistischen, semitischen Clique«, der Westen insgesamt sei »durch die goldene Internationale, das Geldjudenthum in den oberen Kreisen, entsittlicht«.66 Ähnliche Vorwürfe wurden zur gleichen Zeit in der Gartenlaube, in der Deutschen Landeszeitung oder der Staatsbürgerzeitung erhoben, unter anderem von Otto Glagau und Ottomar Beta, welch letzterem Meyer auch die Berliner Revue geöffnet hatte.67 Mit Bruno Bauer, der nach Meyers Auskunft während seiner Redaktionsführung die politische Wochenschau des Blattes betreute, war darüber hinaus ein weiterer »Klassiker« des Antisemitismus an Bord.68 Bismarck, so der Tenor, führe Deutschland in den Staatsbankrott, er liefere das Volk einem »System der Aussaugung und Ausraubung […] durch Blutsauger« aus und sei auf dem besten Wege, »das Ende der christlichen Civilisation« einzuleiten.69 Hinsichtlich der Juden gab es deshalb nur eine Lösung: die Rücknahme der Emanzipation.70 Aber damit war es nicht getan:
»Wir wissen, dass, wenn die Regierung des Landes anderen Händen seit 1871 anvertraut gewesen wäre, wenn einfache schlichte Männer in des Königs Rath gesessen hätten, keine Einzige der entsetzlichen Gründungen, welche den Courszettel der Berliner Börse schänden, existiren würde. Wir wissen, dass der ›Culturkampf‹ die deutsche Nation nicht zerklüften, die Noth nicht in Palästen und Hütten wohnen würde. Solange der Fürst Bismarck das allein mächtige Idol bleibt, wird die deutsche Nation dem Reich, das Reich dem Kanzler geopfert werden, und der Kanzler – gehört den Juden und Gründern. Daher giebt es für unsere Politik nur eine gebundene Marschroute: Beseitigung des jetzigen Systems und seines Trägers.«71
Den Vorwurf, »plötzlich zum jüdischen St. Simonismus gekommen« zu sein72, wollte Bismarck nicht auf sich sitzen lassen. Er ließ Meyer durch seine Anwälte wegen Beleidigung anklagen und erwirkte im Februar 1877 seine Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe, der sich Meyer durch Flucht in das benachbarte Ausland entzog.73 Ein Versuch Wageners, Bismarck zum Einlenken gegenüber Meyer zu bewegen, scheiterte, und bald darauf brach Bismarck auch die Beziehungen zu Wagener ab.74