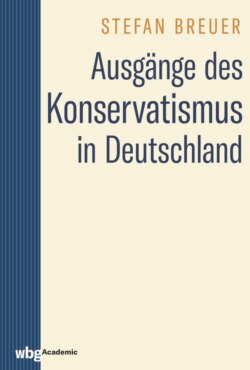Читать книгу Ausgänge des Konservatismus - Stefan Breuer - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеMit seiner Flucht vollendete Meyer auch räumlich, was sich in der Sache schon länger angekündigt hatte: eine Distanzierung, wenn nicht vom Konservatismus schlechthin, so doch von dem, wozu dieser in Preußen seit der Neuen Ära geworden war: von den Neukonservativen, die im Kielwasser der Liberalen segelten, und von den Altkonservativen, die der Donquijoterie anhingen, ein patriarchalisches Königtum restaurieren zu wollen, das so unzeitgemäß sei wie das patriarchalische Arbeitgebertum oder das patriarchalische »Consistorialtum«.75 Das nahm, zumindest was die Arbeitsbeziehungen betraf, den Befund vorweg, zu dem zwei Jahrzehnte später auch Max Weber auf empirischem Wege kam.76
Wenn Meyer dennoch nicht resignierte, so deshalb, weil er bald nach seiner Flucht ein neues Forum fand. Im Frühjahr 1877 bot ihm Karl Freiherr von Vogelsang (1818–1890), spiritus rector der in Wien erscheinenden kleinen »Zeitung für die österreichische Monarchie« mit dem Obertitel Das Vaterland, eine Stellung als fester Mitarbeiter an77, eine Position, die ihm endlich wieder ein festes Einkommen bot und ihn überdies in unmittelbare Nähe zu Lorenz von Stein brachte, dessen Lehre vom sozialen Königtum im Kreis um Wagener höchste Wertschätzung genoß.78 Eine weitere Attraktion bestand darin, daß die Redaktion ihm die Möglichkeit eröffnete, zeitweise als Auslandskorrespondent zu agieren. Für die nächsten Jahre wurde Wien zu einer Art Heimathafen, von dem aus er auf lange Fahrten ging: 1878 für sieben Monate nach Paris, 1879 für neun Monate nach England, 1881 auf ein ganzes Jahr in die Vereinigten Staaten, danach wieder nach England und Frankreich, außerdem nach Italien und Ungarn.79
Das Vaterland war 1860 von Adelskreisen in Böhmen, Mähren und Österreich in der Absicht gegründet worden, den konservativen Standpunkt auch auf publizistischem Feld zur Geltung zu bringen und dabei »die Besprechung der socialen Frage im großen Styl an erster Stelle auf unsere Tagesordnung zu setzen.«80 Aus lokalen Versammlungen in Prag, Brünn und Wien mit insgesamt rund vierhundert Teilnehmern hatte sich ein Gründungsausschuß konstituiert, der wiederum einen Verwaltungsrat einsetzte, aus dessen Mitte ein Direktorium und ein fünfköpfiger Redaktionsausschuß gewählt wurden. Die Oberleitung lag bis zu seinem Rückzug aus Altersgründen bei Leo Graf Thun (1811–1888), von 1849 bis 1860 Minister für Kultus und Unterricht, außerdem erbliches Mitglied des Herrenhauses und Abgeordneter des böhmischen Landtags81; ab 1887 bei Egbert Graf Belcredi (1816–1894), von 1879 bis 1891 Reichsratsabgeordneter für den mährischen Großgrundbesitz.82 Für die politische Linie des Blattes, das mit seinen höchstens 3000 Abonnenten »immer zwischen Leben und Sterben« lag83, zeichnete seit 1875, in ständiger und nicht selten spannungsreicher Abstimmung mit den Gründern und Geldgebern, der erwähnte Karl Freiherr von Vogelsang verantwortlich, wie Meyer ein Norddeutscher, der 1850 zum Katholizismus konvertiert war.84 Alle drei brachten bis 1882 Meyers Arbeit ein hohes Maß an Wertschätzung entgegen, Belcredi, der als Vorsitzender der Kommission zur Revision der Gewerbeordnung ab 1879 häufig auf Meyers Expertise zurückgriff, auch darüber hinaus.85
Welch großen Einfluß Meyer auf die in Entstehung begriffene christlich-soziale Bewegung in Österreich ausübte, war den Zeitgenossen durchaus geläufig.86 Sein spezieller Anteil an der Profilbildung des Vaterlands dagegen ist bis heute unerforscht. Beachtung gefunden hat lediglich die Tätigkeit Vogelsangs, dessen wichtigster Biograph Meyer jedoch auf parteiliche Weise beurteilt und überdies unterschätzt, wenn er ihm vorwirft, die Dinge »zu einseitig von der wirtschaftlichen Seite« aufzufassen.87 Zur Unterschätzung mag beigetragen haben, daß die Artikel überwiegend nicht namentlich, sondern allenfalls mit Siglen gekennzeichnet sind. Man muß sehr viel gelesen haben, bis man in der Nr. 92 vom 3. 4. 1881 auf einen redaktionellen Vermerk stößt, wonach die sich durch das ganze Jahr hindurch ziehende, mit der Sigle √ gekennzeichnete Artikelserie »Amerikanische Briefe« ›unserem Mitarbeiter‹ Dr. Rudolf Meyer zukommt. Auch Meyer selbst bestätigt diese Sigle, unter der bis dahin bereits mehrere hundert, oft mehrteilige Artikel erschienen waren.88
Das Themenspektrum, das Meyer in diesen Jahren bearbeitete, war von beeindruckender Breite. Es umfaßte in allgemein-politischer Hinsicht, um nur einige herausragende Titel zu nennen: die liberale und konservative Parteibildung in Deutschland, die Christlich-Sozialen, das OEuvre des cercles catholiques d’ouvriers, den Beginn des Klassenkampfes in Deutschland im 18. Jahrhundert, die Sozialdemokratie in Deutschland und Frankreich, den Anarchismus in Italien und den Agrarkommunismus in Rußland; in wirtschafts- und sozialpolitischer Hinsicht: die Gestaltung des Kreditwesens und des Schutzzolls, die Tätigkeit der Nationalbanken, die Geldpolitik, das Aktienprinzip und die Pfandbriefemission, die Arbeitsgesetzgebung in Frankreich, den Handel mit Indien, die Agrarverhältnisse in Ostindien, die englischen Gewerkschaften, das Steuersystem in England, die Wuchergesetze in den USA, die Auswanderung nach Amerika, das Budget in Ungarn, den Übergang zur Goldwährung, die Wirtschaftspolitik Bismarcks und vieles mehr.
Lag der Akzent in den ersten drei Jahren mehr auf einzelnen Problemen, die mit der Industrialisierung in Zusammenhang standen, so schoben sich ab 1880 die Folgen in den Vordergrund, welche die zunehmende überseeische Konkurrenz sowohl für die Industrie als auch vor allem für die Landwirtschaft des europäischen Kontinents hatte. Im März 1880 schrieb Meyer erstmals über »Das Sinken der Grundrente und seine Folgen«, das sich teils aus der höheren Produktivität des Getreideanbaus wie der Viehzucht in Nord- und Südamerika ergebe, teils aus der sinkenden Produktions- und Konsumtionskraft Europas, die wiederum ein Effekt verschiedener Faktoren von der Gesetzgebung über das Steuersystem bis zu den höheren Militärbudgets sei.89 Habe man im Agrarrecht bis 1848 Wert darauf gelegt, »das Eigenthumsrecht an Land unabhängig von der Rentabilität der Landwirthschaft« zu machen, also Sicherheit vor Freiheit zu setzen, so habe sich seitdem das kontradiktorische Prinzip einer maximalen »Freiheit des Grundbesitzes« durchgesetzt. Dieses habe einen sich stetig verschärfenden Wettbewerb entfesselt, mit der Folge, »daß die Reste der noch existierenden Grundbesitzerfamilien in größter Gefahr stehen, durch die sich über Europa ergießende Flut von überseeischen Nahrungsmitteln von ihrem Besitze weggeschwemmt zu werden, so daß der Ueberfluß von Nahrungsmitteln, an sich ein Gottessegen, diesem Grundstocke unserer socialen Organisation zum Verderben zu werden droht.«90 Da von der generellen Verminderung des Reinertrags weniger der Staat und die Hypothekenbanken betroffen seien, als vor allem die Grundbesitzer, sei zu erwarten, daß der größte Teil derselben, »nämlich alle solchen, die bis zur Hälfte jenes Capitalwerthes, den ihre Besitzungen in den letzten 10 bis 20 Jahren hatten, verschuldet sind, aus dem Grundbesitze vertrieben und darin von Capitalisten, meist Juden, oft auch von dem selbstständig gewordenen Capital einer Hypothekenbank, ersetzt werden.« Das vorhersehbare Ergebnis werde entweder eine »elende Plänklerwirthschaft« wie in Ungarn oder Italien sein oder eine von Großkapitalisten und Banken »nach neuamerikanischem Factoreimuster […] mit für Wochen oder Monate aus aller Welt zusammengerafften Arbeitern« betriebene Großlandwirtschaft.91
Mit derartigen Prognosen handelte sich Meyer bei seinen Mitstreitern im Vaterland bald den Vorwurf des unangebrachten Pessimismus ein.92 Zu diesem Zeitpunkt war er sich indes noch nicht sicher, ob die Zukunft allein dem amerikanischen Modell gehören werde, oder ob nicht vielmehr auch Kleinbetriebe nach französischem Muster eine Chance besäßen, da sie elastischer und weniger abhängig vom Weltmarkt seien.93 In jedem Fall vertrat er die Ansicht, »daß es zum hoffnungslosen Pessimismus immer noch zu früh ist«.94 Der Staat könne jederzeit die Steuern herabsetzen, die Schuldgesetze ändern und eine Politik des »sozialen Schutzzoll[s]« betreiben, die nicht nur den Reichtum der Fabrikanten und der Banken vermehre, sondern auch den Wohlstand der Allgemeinheit: durch Eindämmung der Unternehmergewinne oder durch Erhöhung der Löhne.95 Speziell in der Landwirtschaft sei an Moratorien und eine Gesetzgebung zu denken, welche »die Schuldentlastung durch Landesanstalten ordnete und für das dann noch existirende Capitalbedürfniß durch Landescultur-Rentenbanken und damit, sowie mit den Landschaften, für bestehende Hypothekenschulden Personal-Creditanstalten aus Landesmitteln in Verbindung brächte.«96
Forderungen wie diese fügten sich einerseits in einen Kreis, der darauf aus war, »mit modernen Mitteln, mit Hilfe relativ radikaler Sozialgesetzgebung die gesellschaftliche Herrschaftsstruktur der vorindustriellen Vergangenheit in abgewandelten Formen zu neuer Blüte bringen zu können.«97 Andererseits hatte Meyer sich erst drei Jahre vor seiner Flucht selbst ausdrücklich der Wagener-Fraktion der preußischen Konservativen zugeordnet, die sich im Unterschied zur ›Kreuzzeitung‹ »nicht mehr bloß abwehrend und defensiv gegen die Großindustrie« verhalte, vielmehr »die letztere selber in den Kreis ihrer Berechnung« ziehe.98 Wie unvereinbar diese erst um die Jahrhundertwende von den Christlich-Sozialen Luegers eingenommene Position mit den Prinzipien Vogelsangs war, der im Vaterland den Ton angab, blieb in den ersten Jahren von Meyers Exil noch verdeckt. Es trat jedoch deutlicher hervor nach der Rückkehr von seiner Amerikareise, die ihn 1881 ein Jahr lang von Washington über die Südstaaten nach Kalifornien und dann über Chicago ins östliche Kanada geführt hatte. Von dort brachte er einen großen Respekt für eine Landwirtschaft mit, die im Gegensatz zur europäischen »auf der möglichst umfangreichen Anwendung der Maschinerie beruht«, außerdem die Hoffnung auf eine mögliche Überwindung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse im Wege einer Humanisierung der Arbeit:
»Der Traum des Aristoteles, dass die Maschine, das sich selbst bewegende Weberschifflein, dem Weber die Arbeit erleichtern solle, ist in der amerikanischen Maschinenlandwirthschaft annähernd Wahrheit geworden und wenn sich dies auch in Europa verbreitet, so wird die Maschine auch hier ein Segen für die Arbeiter werden, während sie bis jetzt meist ein Fluch für sie ist. Darum haben niemals amerikanische Landarbeiter landwirthschaftliche Maschinen zerstört, Industriearbeiter oft solche Maschinen, die sie ausser Brod setzten. Der Reitpflug versöhnt den Arbeiter mit den Fortschritten der Mechanik, der mechanische Webstuhl thut das nicht, er unterjocht den Arbeiter und macht ihn zum Stück an sich selbst. Er raubt ihm alle Individualität, die an der Industriemaschine stattfindende Theilung der Arbeit lässt den Arbeiter kein Ganzes, an dem er seine Freude hätte, mehr schaffen. Die amerikanische Maschinenlandwirthschaft ist sehr productiv, aber sie ist auch menschlich. Sie schont die Kraft des Arbeiters, gewährt ihm bei der Arbeit Musse. Sie rein capitalistisch, nur vom Standpunkt des ›Reingewinnes‹ auffassen, verräth den rohen, europäischen, unmenschlichen Standpunkt, auf dem wir uns leider meist schon befinden.«99
Unter der langen Liste von Errungenschaften, die ihn in Amerika begeisterten100, war nicht die kleinste eine Gesetzgebung, die »die Macht des Geldcapitals über den Grundbesitz« einschränkte. Der Sieg der Nordstaaten im Sezessionskrieg habe zur »Vernichtung des im Süden geltenden Principes des Grossgrundbesitzes durch jenes des freien Kleinbesitzes« geführt, zur Zerschlagung der Plantagen in Parzellen, die in den meisten Staaten durch Homestead-Gesetze vor Überschuldung und Depossedierung geschützt seien.101 Der im industriellen Sektor wirksame Konzentrationsprozeß sei in der Landwirtschaft außer Kraft gesetzt, mache doch hier die Mechanisierung die kleineren und mittleren Betriebe konkurrenzfähig und halte die Latifundienbildung hintan.102 Nehme man hinzu, daß in Amerika ein mittelloser Landarbeiter in zehn bis zwölf Jahren zum wohlhabenden Bauern werden könne, so habe man es mit einer Konstellation zu tun, der die alte Welt nichts Vergleichbares entgegenzusetzen habe. Die Zeit für den Bauernstand, dies jedenfalls zeigten die nordwestlichen Staaten der Union, sei noch nicht verloren. Vielmehr lehrten sie, wie hier aus den Trümmern des europäischen Bauern- und Landarbeiterstandes ein neuer Bauernstand entstehe, »während ihn in Europa Staatsmänner ruiniren, deren Politik das grosse Capital und das Börsenspiel begünstigten.«103 Das war eine deutlich andere Perspektive, als sie Meyer noch kurz zuvor, in der zweiten Auflage seines Werkes über den Emanzipationskampf, bekräftigt hatte.
Im Vaterland konnten solche Ideen zunächst mit der Zustimmung Vogelsangs rechnen, der ebenfalls für eine Befreiung des Bauernstandes von der »Herrschaft der Plutokratie« eintrat.104 Allerdings wollte Vogelsang diese Befreiung auf alle Grundbesitzer ausgedehnt wissen, also auch eben jenen Großgrundbesitz, dem nach Meyer schon nicht mehr die Zukunft gehörte. Darüber hinaus erschien ihm die Einschätzung der amerikanischen Landwirtschaft und der von ihr ausgehenden Bedrohung für Europa übertrieben. Nach einer ersten noch zurückhaltenden Distanzierung von Meyers Reiseberichten, die seit April 1881 im Vaterland erschienen105, schlug er sich auf die Seite der Skeptiker, die die Überlegenheit der amerikanischen Konkurrenz für ein temporäres, auf Raubbau beruhendes Phänomen erklärten, das sich ähnlich rasch auflösen werde wie der Gründungsschwindel der 70er Jahre.106 Besonderes Mißfallen erregten Meyers »Schwärmerei für den nächtlichen Dampfpflug« und sein »forcierter Amerikanismus«, der ihm die hiesigen Verhältnisse in allzu ungünstigem Licht erscheinen lasse.107 Durch seine Berichte nehme das Vaterland mehr und mehr den Charakter eines »Auswanderungsorgan[s] für die nordamerikanische Republik« an. Die Leserschaft werde deshalb allmählich »amerikamüde«: »Von allen Seiten beschwert man sich über die Anpreisungen des Wirtschaftslebens jener in Wahrheit bis auf die Knochen verfaulten Republik. Die ganze Literatur ist angefüllt mit den Skandalen der dortigen Wirtschaft – nur Dr. Meyer will nichts davon wissen und anerkennt nur das, was man ihm von der korrumpierten Verwaltung in die Hand gesteckt hat. Das ›Vaterland‹ fing schon an lächerlich zu werden.«108
Zum Dissens in der Sache kamen bald persönliche Animositäten hinzu. Anstatt die Probleme zu lösen, steigerten mehrere Gespräche nur das wechselseitige Unverständnis und die Erbitterung, bis Vogelsang schließlich gegenüber den Geldgebern seine Tätigkeit für das Vaterland zur Disposition stellte. Da er seine »sozialdemokratisch tangierten Ansichten« nicht habe durchsetzen können, habe Meyer sich »immer mehr zu einem bösen Element in der Redaktion ausgebildet«, er habe die Mitarbeiter gegen ihn, Vogelsang, aufgewiegelt und verfolge ihn geradezu mit »unauslöschlichem tödlichen Haß«.109 Graf Thun versuchte eine Zeitlang, in diesem Konflikt zu vermitteln, wußte er Meyers Expertise doch durchaus zu schätzen. Schließlich stellte er sich jedoch auf die Seite Vogelsangs, so daß Meyer keine Wahl sah, als das Vaterland Ende 1882 zu verlassen. Das folgende Jahr verbrachte er damit, die Erfahrungen seiner Amerikareise zu zwei umfangreichen Büchern auszuarbeiten.110 1884 lieh er sich Geld von Freunden und erwarb in Kanada einen Bauernhof von 64 ha, den er durch weitere Ankäufe nach und nach zu einem Latifundium von 2000 ha erweiterte. 1889 mußte er aus gesundheitlichen Gründen das Anwesen verkaufen und nach Europa zurückkehren.111