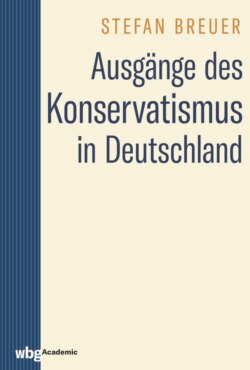Читать книгу Ausgänge des Konservatismus - Stefan Breuer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеWas die zuletzt angedeutete Perspektive betrifft, so berührt sie sich in vielem mit Kondylis’ These einer zunehmenden »Antiquiertheit der politischen Begriffe«.54 Aber auch in der Auffassung des Konservatismus finden sich manche Übereinstimmungen. Hier wie dort ein historisch-typisierender Ansatz, darauf ausgerichtet, die »für eine ›Periode‹ relativ stabilen Typenbegriffe […] für die Erklärung und Deutung der Kulturgebilde« herauszuarbeiten und entsprechend den Konservatismus zeitlich und räumlich zu lokalisieren; hier wie dort eine Zurechnung von Denkweisen zu bestimmten Weltanschauungen und Ideologien sozialer Klassen, auch wenn dies im Fall des Konservatismus bei Mannheim zu einem deutlich breiteren Spektrum führt als bei Kondylis; hier wie dort eine ausgesprochen agonale Sicht der zwischen den Klassen waltenden Beziehungen, sowohl auf der Ebene der Interessen wie auf derjenigen der Ideen, die als »geistige Waffen« präsentiert werden.55 Und wenn Mannheim darauf beharrt, den Konservatismus nicht isoliert zu behandeln, sondern als Teil einer »Gesamtsituation«, dann ist es nicht weit zu Kondylis, der ebenfalls großes Gewicht auf die Spannungen und Wechselwirkungen legt, die zwischen dem Konservatismus und seinen jeweiligen Gegenspielern – dem Absolutismus, dem Liberalismus oder der Demokratie – bestehen. Gewiß: Mannheim sieht in dieser Lagerung die Kräfte von Aktion und Reaktion eindeutiger verteilt als Kondylis, der immer wieder davor warnt, den Konservatismus auf bloße Reaktion zu reduzieren. Aber lokalisiert letztlich nicht auch Kondylis die eigentliche Triebkraft der Veränderung im neuzeitlichen Rationalismus, der die Positivierung des Rechts und damit die Trennung von Staat und Gesellschaft vorantreibt? Was schließlich trennt eine Sichtweise, die in diesem Rationalismus die Manifestation einer »weltanschauliche[n] Grundhaltung« erkennt56, von einem Ansatz, der darauf zielt, ›Grundintentionen‹, Stilprinzipien sichtbar zu machen, die im Aufbau der Weltanschauungen und Ideologien wirksam sind?57
Eine erste Abweichung findet sich in der Bestimmung des Verhältnisses von Traditionalismus und Konservatismus. Anders als Mannheim, der dieses Verhältnis als eines zwischen präreflexiven und reflexiven Einstellungen deutet und dies zugleich mit einem zeitlichen Index versieht, weist Kondylis die Annahme zurück, es habe einen »stummen unreflektierten Traditionalismus der vorrevolutionären Zeit« gegeben, von dem sich dann der Konservatismus abgehoben habe.58 Die Behauptung einer solchen »teils unreflektierten teils passiven Billigung herrschender Verhältnisse [sei] historisch unhaltbar bzw. eine rein hermeneutische Fiktion«, die allenfalls insofern ein begrenztes Recht habe, als im 17. und 18. Jahrhundert zeitweise eine gewisse »Müdigkeit des Adels nach seinen Niederlagen im Kampfe gegen den Absolutismus« zu verzeichnen sei.59 Zuvor jedoch, und dann wieder verstärkt zur Zeit der französischen Fronde und der prérévolution, habe es eine höchst bewußte, z. T. dezidiert an Aristoteles und Thomas von Aquin anknüpfende Verteidigung der überlieferten Strukturen der alteuropäischen Herrschaftswelt gegeben, und zwar sowohl von Seiten einzelner Autoren wie der Spätscholastiker oder der Monarchomachen, als auch von Seiten der dazu legitimierten Institutionen wie der Ständeversammlungen und vormodernen Parlamente.60
Diese Verteidigung aber, so der zweite Punkt, mit dem Kondylis andere Akzente setzt, reagierte auf eine Herausforderung, die nicht erst auf das späte 18. Jahrhundert datiert. Sie ergab sich durch das Aufkommen der modernen Souveränitätsidee und einer entsprechenden Praxis, in deren Gefolge sich die Politik aus ihrer Bindung an Religion und Ethik sowie an die herkömmlichen leges fundamentales löste und das Recht sich aus einer mit Sitte und Brauch identischen, ontologisch verbürgten Größe in eine zweckrational konzipierte und jederzeit in ihrem Bestand revidierbare Ordnung verwandelte. Auf diese Weise wurde die alteuropäische societas civilis, die in politischer Hinsicht polyzentrisch war (»wegen des Aufbaus des sozialen Ganzen auf der Grundlage von autonomen Oikoi und Korporationen«), in weltanschaulich-religiöser Hinsicht dagegen »monistisch«, auf den Kopf gestellt, war doch der vom entstehenden Absolutismus durchgesetzte Gesetzgebungsstaat politisch einheitlich und religiösethisch polyzentrisch, nämlich »tolerant«.61
Aus dem Widerstand gegen diese Umkehrung ist nach Kondylis der Konservatismus hervorgegangen, gestützt auf die politisch aktionsfähigen Schichten: den ländlichen, städtischen und höfischen Adel. Sein Ziel war, wenn nicht de jure, so doch de facto, die Adelsrepublik, die Sicherstellung der Naturwüchsigkeit und strukturellen Unabänderbarkeit der societas civilis62, in der Terminologie Louis Dumonts: des »homo hierarchicus« gegenüber dem »homo aequalis«. Daraus entstand die erste Stufe des Konservatismus, der »antiabsolutistische Konservatismus«, dessen Leitpräferenzen Kondylis folgendermaßen zusammenfaßt: »Priorität der Gruppe gegenüber dem in ihr geborenen und ihr lebenslänglich angehörenden Individuum«; Ausschluß der rechtlichen und politischen Unmittelbarkeit des Einzelnen; Ablehnung des Gleichheitsgedankens und »Verteidigung der Hierarchie sowohl unter den Ständen als auch innerhalb derselben.«63
Die letzte Abweichung ergibt sich unmittelbar aus den beiden anderen. So wie die Revolution des 18. Jahrhunderts in vielem nur eine Radikalisierung des absolutistischen Souveränitätsanspruchs war, war auch der gegenrevolutionäre Konservatismus – die zweite Stufe des Konservatismus – keine parthenogenetische Erscheinung, setzte er doch die Bemühungen des antiabsolutistischen Konservatismus um eine Bewahrung der societas civilis fort. Das geschah freilich unter Bedingungen, die es erforderlich machten, die Strategie neu zu justieren. Um die von der Revolution noch weit grundsätzlicher als vom Absolutismus negierte societas civilis zu verteidigen, entschloß sich der Adel, die vom modernen Staat bereitgestellten Zwangsmittel zunächst zu übernehmen und gegen den radikaleren Gegner zu wenden.64 Unter Umständen konnte dies die Errichtung oder auch nur die Tolerierung einer Diktatur bedeuten, welche man allerdings (wenn auch nicht immer erfolgreich) auf eine »kommissarische« (im Unterschied zu einer »souveränen«) Diktatur festzulegen bemüht war.65 Auf der gleichen Linie lag die Strategie, das Lager der Gegner zu spalten und den gemäßigten Flügel auf die eigene Seite zu ziehen – ein Vorhaben, das nicht nur auf der politischen Bühne spielte, sondern ein Pendant auf ideeller Ebene hatte: in zahlreichen Versuchen, »aufklärerische Sprache und gelegentlich auch (uminterpretiertes) aufklärerisches Gedankengut gegen die liberalen und demokratischen Auswüchse der Aufklärung zu verwenden«.66 Daß diese wie immer auch partielle Anpassung an den Gegner zu keiner stabilen Position führte, vielmehr in einen offenen Selbstwiderspruch mündete, der den Niedergang des Konservatismus beschleunigte, stand für Kondylis jedoch außer Zweifel.67
Eine Bedingung der Möglichkeit dafür war nach Kondylis, daß die Aufklärung als Denkweise des aufstrebenden Bürgertums mitnichten auf eine extreme Form des »Intellektualismus« reduziert werden kann, wie das bei Mannheim geschieht.68 Auch wenn es in ihr eine dahingehende Tendenz gab, war diese doch keineswegs vorherrschend. Die Hauptströmung der Aufklärung wandte sich vielmehr »gegen das, was sie als theologischscholastischen und cartesianischen Intellektualismus betrachtete, und dabei entwickelte sie eine umfassende antiintellektualistische Position, die nicht nur erkenntnistheoretisch, sondern auch anthropologisch und geschichtsphilosophisch fundiert war.«69 Das wiederum ermöglichte es konservativen Ideologen, hieran anzuschließen und den aufklärerischen Antiintellektualismus gegen zentrale Normen und Absichten der Aufklärung selbst zu wenden. Das geschah z. T. im Ausgang von Positionen der literarischen Romantik, jedoch weder so ausschließlich noch so eindeutig, wie von Mannheim dargestellt. Weit davon entfernt, eine bloße Gegenbewegung gegen den neuzeitlichen Rationalismus zu sein, legte die Romantik nach Kondylis vielmehr den Akzent ganz auf die konstitutive Tätigkeit des ästhetischen Subjekts, das die Welt im Sinne Carl Schmitts »als Anlaß und Material seines unablässigen geistigen Experimentierens« behandelte.70 Staat und Gesellschaft gerieten von hier aus nicht in der geschichtlich konkreten Gestalt der societas civilis in den Blick, sondern als fiktive Gemeinschaft, »welche die vom romantischen Subjekt vertretenen (ästhetischen) Werte verkörpert«, also utopischer Qualität sei.71 Das habe zeitweilige Bündnisse zwischen dem Konservatismus und den romantischen Intellektuellen nicht ausgeschlossen, wie die Karriere von Adam Müller oder Friedrich Schlegel zeigt. Insgesamt aber sei die Romantik eine viel zu ambivalente Erscheinung gewesen, als daß sie in so exklusiver Weise für die Grundlegung des Konservatismus herangezogen werden könne, wie dies bei Mannheim der Fall sei:
»Denn Konservativismus bedeutet Glaube an eine feste, überindividuelle und von keinem menschlichen Subjekt gemachte (geschweige denn aufgrund ästhetischer Kriterien improvisierte) Ordnung, also radikale Absage an jeden Subjektivismus und Individualismus. An der Notwendigkeit einer Wahl zwischen Romantik und Konservativismus konnte offenbar kein Weg vorbeiführen.«72
Daß der hier angesprochene Glaube das 19. Jahrhundert nicht überlebt hat, ja schon um die Jahrhundertmitte deutliche Erosionserscheinungen aufwies, ist die nächste und im Ergebnis wichtigste Abweichung von Mannheim. Die Epoche zwischen 1789 und 1848 war für Kondylis wohl noch einmal eine Hochblüte konservativer Ideologiebildung, jedoch zugleich Schauplatz einer Doppelrevolution, die neben einer weiteren Ausgestaltung des souveränen Staates vor allem durch die Etablierung einer bürgerlich-kapitalistischen Wirtschafts- und Sozialordnung bestimmt war. Vor die Wahl gestellt, sich ihr anzupassen oder unterzugehen, entschied sich der Adel für das erstere. Er verwandelte sich in eine nach kapitalistischen Maximen wirtschaftende Grundrentnerschicht, akzeptierte die Trennung von Staat und Gesellschaft und öffnete sich sozial gegenüber dem bürgerlichen Reichtum und dessen Besitzern. Was zunächst als Modernisierung konservativer Politik gedacht war, wurde zu deren Transformation: »konservative Politik wird zur Interessenpolitik, angesichts der offensichtlichen Unwiederbringlichkeit des Alten läßt sie sich also nicht mehr von der Idealvorstellung der societas civilis, sondern von konkreten und beschränkten Zielen leiten, wobei stillschweigend vorausgesetzt wird, daß der Realisierungsrahmen dieser Ziele nur die neue bürgerlichkapitalistische Gesellschaft sein könnte.«73 Neuere Untersuchungen zu den sich konservativ nennenden Parteien des ausgehenden Kaiserreichs bestätigen diesen Trend.74
Mag es von Mannheims Standpunkt aus noch diskutabel sein, die Geschichte des Konservatismus bis in die Verfassungskonflikte des 16. Jahrhunderts zu verlängern, so ist in dieser Frage kein Kompromiß möglich, ist doch für Mannheim der Konservatismus Ausdruck einer Grundintention, die durch Vorgänge geschichtlich-sozialer Art wohl in Schwingung versetzt und in Richtung auf neue, von einer historischen Phase zur anderen sich wandelnde »objektive Gehalte« geöffnet wird, aber letztlich unberührt durch diese Wandlungen hindurchgeht75 – zumindest solange, wie die Kräfte in Geltung sind, die sie an ihrer Entfaltung hindern. Aus diesem Grund kann Mannheim seinen Untersuchungsgegenstand – »das konservative Denken in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland« – als »Altkonservatismus« bezeichnen und damit grundsätzlich die Möglichkeit einer Erneuerung dieses Denkens in Gestalt eines »Jung-«, »Neu-« oder »Neokonservatismus« signalisieren, um von der vielzitierten »konservativen Revolution« zu schweigen.76 Eingelöst hat Mannheim diesen Scheck freilich nicht. Wie ein Konservatismus nach dem Altkonservatismus aussehen könnte, hat er nicht ausgeführt, aber immerhin in die die richtige Richtung gewiesen, indem er schon bei Friedrich Julius Stahl »die ersten Spuren des Einflusses liberaler Art auf den Konservatismus« ausmachte.77
So hat es auch Kondylis gesehen, allerdings sehr viel schärfer gefaßt. Aus seiner Sicht setzte in den 1830er Jahren in England und Frankreich sowie bald darauf auch in Deutschland eine Entwicklung ein, die mit dem »Aufgehen des Konservativismus im (Alt)Liberalismus« endete.78 Zwar veränderte sich dabei auch der Liberalismus, der sich beim Aufkommen der modernen Massendemokratie spaltete: in einen linken, sozialliberalen Flügel, der die ursprünglich rein formal verstandenen Grund- und Menschenrechte im Sinne universaler materieller Teilhaberechte deutete, und einen rechten, oligarchischen Flügel, der sich zunächst als alt-, dann als neoliberal bezeichnete und den Schulterschluß mit dem Konservatismus suchte.79 Dem letzteren aber kam dies nicht zugute, weil dabei mehr vom Liberalismus auf ihn abfärbte als umgekehrt. Die Umwandlung seiner Trägerschicht im kapitalistischen Sinne zog unvermeidlich die Loslösung von der Leitvorstellung der societas civilis nach sich und war Mitte des 19. Jahrhunderts so weit fortgeschritten, daß von Konservatismus nur mehr in uneigentlichem, metaphorischem oder polemischem Sinne die Rede sein konnte: einem Konservatismus in Anführungszeichen. »Die Geschichte des Konservativismus fällt weitgehend mit der Geschichte des Adels zusammen, was offensichtlich bedeutet, daß das Ende des Adels als traditionell (im Weberschen Sinne) herrschender Schicht auch das Ende des sozial relevanten und begrifflich prägnanten Konservativismus nach sich ziehen mußte.«80
Wenn Kondylis sich hier auf Max Weber beruft, dann deckt sich das mit dessen Urteil aus dem Jahr 1917, das den Konservativen bescheinigte, seit Stahl, Gerlach und den »alten Christlich-Sozialen« »politischen Charakter im Dienst großer staatspolitischer oder idealer Ziele […] niemals gezeigt« zu haben, vielmehr immer nur dann in Aktion getreten zu sein, wenn es um die Verteidigung von Geldinteressen, Ämterpatronage oder Wahlrechtsprivilegien ging.81 Diese Sichtweise wird durch das Urteil vieler zeitgenössischer Beobachter und moderner Forscher gestützt, die die konservative Partei auf dem Weg sahen, »mehr und mehr sozusagen eine rein agrarische Organisation« zu werden.82 Sie blendet jedoch aus, daß es sich dabei um das Resultat eines Prozesses handelt, von dem um die Jahrhundertmitte noch keineswegs absehbar war, wie er ausgehen werde. Von der Sezession der Wochenblattpartei über die Auseinandersetzungen zwischen Frei- und Deutschkonservativen, Alt- und Neukonservativen bis hin zur Stoecker-Krise in den 90er Jahren war der Konservatismus kein erratischer Block, sondern eine Arena, in der sich zwar immer schärfer das Profil einer Interessentenorganisation und Interessentenideologie des agrarischen Sektors herausschälte, jedoch nur um den Preis einer beständigen Abstoßung damit nicht kompatibler Orientierungen. Mochte es den konservativen Parteien auch am Vorabend des Ersten Weltkriegs gelungen sein, die Reihen fest zu schließen, so hatten sich diese doch dafür merklich gelichtet. Hatten sie noch in den 80er Jahren bei den Reichstagswahlen gut ein Viertel der Wähler gewonnen, so war dieser Anteil 1912 trotz einer absoluten Zunahme relativ gesehen auf etwas über 12 % gesunken, davon drei Viertel für die Deutschkonservativen, ein Viertel für die Freikonservativen.83
Kondylis hat das an einigen Stellen durchaus registriert, es allerdings nicht für erforderlich gehalten, seine These vom Untergang des Konservatismus um 1848 damit in Einklang zu bringen. Immerhin schließt sein Buch mit einigen Bemerkungen über »Das verstreute Erbe des Konservativismus« und enthält darüber hinaus Andeutungen, die erkennen lassen, daß der postulierte Schnitt so scharf nicht war. Das bezieht sich einerseits auf die Existenz einer »nationalkonservativen« Strömung in Gestalt der sog. Wochenblattpartei, die weniger eine Partei als vielmehr ein lockeres Bündnis einiger Abgeordneter und Beamter aus den westlichen Landesteilen Preußens war, das sich um das von Ende 1851 bis 1861 erscheinende Preußische Wochenblatt gruppierte.84 Den Anstoß zur organisatorischen Verselbständigung gaben allerdings nicht so sehr nationalpolitische als vielmehr spezifisch preußische Themen wie die Ablehnung der Verquickung von Religion und Politik durch den Gerlach-Kreis oder der von der Regierung Manteuffel betriebenen Revitalisierung der Kreis- und Provinzialordnung.85 Das schloß ein starkes Engagement für die nationale Einigung Deutschlands nicht aus, legte dieses aber auf die kleindeutsche Lösung unter preußischer Hegemonie fest und vertrat verfassungs- und wirtschaftspolitisch einen so entschiedenen Legalismus, daß prominente Liberale wie Droysen oder Treitschke den Eintritt in die Redaktion des Wochenblatts erwogen.86 Insgesamt erscheint es deshalb angemessener, statt von einer eigenen »nationalkonservativen« Richtung von einer Variante des Liberalkonservatismus auszugehen87, wofür nicht zuletzt auch die Aufnahme und Fortführung vieler Ziele dieser Gruppe durch die 1867 gegründete Freikonservative Partei spricht, die im Kaiserreich als ›oberste Mehrheitsbeschafferin der Regierung‹ wirkte, indem sie von Fall zu Fall zwischen Deutschkonservativen und Nationalliberalen vermittelte.88
Deutlich eigenständiger erscheint dagegen die zweite von Kondylis angeführte Strömung, der sogenannte Sozialkonservatismus89, der dem Bestreben entsprang, die Erosion des Ancien Régime durch einen »kollektiven Patriarchalismus« zu kompensieren, wenn nicht auf dem Land, wo die Herrschaftsbasis des allem Kollektivismus abgeneigten Adels lag, so doch in Handwerk und Industrie. Durch eine korporative Organisation der dort Beschäftigten und eine Politik, die deren Interessen etwa in der Lohnfrage entgegenkam, hoffte man dem Konservatismus breitere Volksschichten zu erschließen, womit sich zugleich die Nebenabsicht einer Steigerung der Grundrente verband, sollte doch die Erhöhung der Arbeitslöhne zu einer Senkung der industriellen Profite führen und das Kapital in die Landwirtschaft umlenken. Eine derartige Förderung bestimmter gesellschaftlicher Interessen war indes nicht zu haben ohne gleichzeitige Aktivierung des bürokratischen Staates auf sozialpolitischem Gebiet, wodurch die Trennung von Staat und Gesellschaft weiter forciert wurde, gegen die der historische Konservatismus doch gerade angetreten war. Und dies mußte um so mehr der Fall sein, je mehr der Staat den Vorschlägen folgte, die aus den Reihen der Sozialkonservativen kamen – Vorschläge, die bald weit über das von Kondylis für möglich gehaltene Maß hinausgingen, indem sie etwa den Ausbau des Steuerstaates, die Schaffung eines Systems der sozialen Sicherung oder umfassende Eingriffe in die Produktionsverhältnisse der Landwirtschaft auf die Agenda setzten. Was als Sozialkonservatismus begann, wurde auf diese Weise schließlich zum »Staatssozialismus«.90
Kombiniert man die hier nur grob angedeuteten Ansätze zu einer Transformation des Konservatismus mit dem Befund der neueren Sozialgeschichte, wonach sich der Adel keineswegs schon 1848 aus der Rolle eines historischen Akteurs verabschiedet hat, dann eröffnet sich die Möglichkeit, aber auch die Notwendigkeit, den von Kondylis gesteckten Rahmen für eine Nachgeschichte des Konservatismus zu erweitern. Diese Nachgeschichte würde nicht an der These rütteln, daß der Konservatismus »keine historische oder anthropologische Konstante, sondern eine konkrete geschichtliche, also an eine bestimmte Epoche und an einen bestimmten Ort gebundene Erscheinung ist, die mit dieser Epoche oder selbst noch vor deren Ende dahinschwindet«.91 Sie würde aber im speziellen Fall Deutschlands mit einer Reihe von Hybridbildungen rechnen, bei denen sich genuin konservative Traditionsbestände mit Motiven und Topoi aus dem Ideenvorrat der modernen bürgerlichen Gesellschaft zu wie immer auch labilen Aggregaten verbänden und so die Geschichte des Konservatismus um einige Jahrzehnte über das von Kondylis angegebene Verfallsdatum verlängerten.