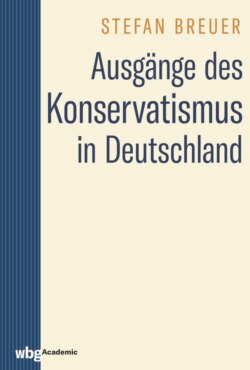Читать книгу Ausgänge des Konservatismus - Stefan Breuer - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.
ОглавлениеHermann Wagener, geboren am 8. 3. 1815 in einer kleinen Gemeinde der Ostprignitz, war eine Gestalt, die sich durch ihren sozialen Status, durch ihre religiöse Orientierung sowie durch eine Reihe ungewöhnlicher persönlicher Eigenschaften von den meisten übrigen Repräsentanten des preußischen Konservatismus unterschied.4 Als Sohn eines Pfarrers war Wagener bürgerlicher Herkunft. Erst nach seinem Ausscheiden aus der ›Kreuzzeitung‹ erhielt er von seiner Partei als Abschiedsgeschenk das Gut Dummerfitz im Kreis Neustettin und rückte damit, wenn auch nicht in den Adel, so doch in den Kreis der ländlichen Elite auf. Daß er von Landwirtschaft nicht viel verstand und auf diesem Feld daher wenig reüssierte, unterschied ihn nicht von vielen anderen Gutsbesitzern, wohl aber sein Engagement in der Sekte der Irvingianer, in der er die Stelle eines Diakons einnahm und sogar Predigten hielt.5 Die Weltanschauung dieser von Edward Irving (1792–1834), einem Mitglied der Schottisch-Presbyterianischen Kirche, geprägten Richtung war, nach dem Urteil von Schoeps, »dualistisch-pessimistisch und einem schroffen Chiliasmus verschrieben«, demzufolge die Gegenwart seit der Französischen Revolution als von gottesleugnerischer Verwirrung bestimmte Endzeit galt.6 Denkbar, obschon nicht beweisbar, daß in dieser apokalyptischen Weltsicht die von Theodor Fontane bemerkte Bereitschaft zum Hasardieren, aber auch eine gewisse Bedenkenlosigkeit hinsichtlich der zu verwendenden Mittel wurzelte, die für Wagener typisch wurde.7
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften war Wagener einige Jahre in Westpreußen tätig, bis ihn Ernst Ludwig von Gerlach als Assessor nach Magdeburg und bald darauf an die ›Kreuzzeitung‹ holte. Seine durch zahlreiche Beleidigungsprozesse und Verurteilungen geprägte Karriere als Chefredakteur endete 1854, doch blieb er dem Blatt noch bis 1872 als Autor verbunden. 1857 begann er mit den Arbeiten zu einem bis 1867 auf 23 Bände anwachsenden Staats- und Gesellschafts-Lexikon, einer wahren »Enzyklopädie des Konservatismus« (Stillich), die explizit als Pendant zu dem seit 1834 erscheinenden Staatslexikon von Rotteck und Welcker gedacht war.8 1861 erwarb er die seit 1855 bestehende Berliner Revue, eine »social-politische Wochenschrift«, die es bis zu ihrer Einstellung Ende 1873 auf 75 starke Quartalsbände brachte.9 Schon zwei Jahre zuvor hatte sie sich für »die Emanzipation und Befreiung der Hintersassen des Industrialismus und der Plutokratie« ausgesprochen und »das Protektorat über die zahlreichen Vereinigungen und Korporationen« verlangt, in denen »die wirklich arbeitenden Klassen, unter denen die Aristokratie obenan steht, ihre soziale Selbständigkeit und politische Bedeutung suchen.«10 Im gleichen Jahr erschien mit der Preußischen Volkszeitung ein weiteres Blatt, das sich für Wageners Programm einer »Verteidigung des Handwerker- und Bauernstandes« stark machte.11
Der volle Umfang von Wageners Einfluß wird jedoch erst deutlich, wenn man sich neben diesen Aktivitäten im Feld der Publizistik auch seine politische Karriere vergegenwärtigt. 1853 wurde er mit Hilfe seines Freundes Kleist-Retzow vom Wahlkreis Belgard-Neustettin ins preußische Abgeordnetenhaus gewählt, wo er, mit zeitweiliger Unterbrechung, bis 1870 tätig war. In den ersten Jahren trat er dort nicht nur mit verschiedenen Interventionen zur Änderung der in wesentlichen Zügen durchaus liberalen Verfassung hervor, auf die im nächsten Abschnitt näher einzugehen sein wird. Er unternahm zugleich verschiedene Anläufe, um »die große Schwäche der conservativen Partei«, den »Mangel eines positiven Programms«, zu kompensieren.12 1856 verfaßte er gemeinsam mit dem Gründer der Berliner Revue, Freiherrn von Hertefeld, sowie dem Rittergutsbesitzer, westpreußischen Landrat und Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses, Moritz von Lavergne-Peguilhen13, die Grundzüge der conservativen Politik, die sich im ersten, von Wagener verfaßten Teil mit beträchtlichem rhetorischen Aufwand gegen den »Constitutionalismus« wandten, hinter dessen Schleier sich »die gewaltigen geistigen Mächte des Bösen« befänden, um es dann aber bei einer Verschiebung der Balance in Richtung des Königtums belassen, ohne an der Grundentscheidung für das System des monarchischen Konstitutionalismus zu rütteln.14 Die Forderung nach »Hebung der bis dahin gesellschaftlich und staatlich unterworfenen Klassen« wurde nur pauschal erhoben und nicht weiter konkretisiert, plädierte man doch dafür, »alle socialen Fragen in die Special-Legislatur« zu verweisen und »die Initiative der Details der besseren Einsicht und Information der Staatsregierung« zu überlassen.15 So blieb es im wesentlichen bei Maßnahmen für die beati possidentes, deren Besitz vor den Gefahren der Verschuldung und der Bodenzersplitterung geschützt und durch eine »zweckmäßige Darlehnsgesetzgebung sowie durch Herstellung gesunder Creditanstalten« gefördert werden sollte, flankiert von der Einrichtung korporativer Genossenschaften auf dem Gebiet des Handwerks und einer »Feudalisirung der Stellung des Fabrikherrn zu seinen Arbeitern«.16 Drei Jahre später, in einem Vortrag vor konservativen Parteigenossen, bekräftigte Wagener diese Forderungen noch einmal, ohne viel Neues hinzuzufügen. Immerhin ließ die scharfe Akzentuierung des »militärischen Charakters der preußischen Monarchie« bereits etwas von den Konflikten erahnen, die Preußen in den kommenden Jahren erschüttern sollten.17
1861 gehörte Wagener zu den Gründern des Preußischen Volksvereins, der als Gegenorganisation zur Fortschrittspartei konzipiert war und auf seinem Höhepunkt nach dem Krieg gegen Dänemark mehr als 50 000 Mitglieder zu mobilisieren vermochte.18 Im März 1866 wurde er auf Betreiben Bismarcks, mit dem er seit den 40er Jahren befreundet war, zum Zweiten Vortragenden Rat im Staatsministerium ernannt, sechs Jahre später, als Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat, zum Ersten Vortragenden Rat und damit zum wichtigsten Berater Bismarcks.19 Ob er in dieser Rolle, wie man gemeint hat, zum größten Politiker neben Bismarck avancierte, den die Konservative Partei hervorgebracht hat20, sei dahingestellt, doch zählte er bis zu seinem Sturz 1873 sicherlich zu den einfluß- und einfallsreichsten Köpfen dieser Partei, die er von 1867 bis 1871 auch im Norddeutschen Reichstag und danach bis 1873 im Reichstag vertrat. Auch nach seinem Abschied von der politischen Bühne, der durch die Verwicklung in einen der vielen Gründerskandale verursacht war, beriet Wagener Bismarck weiter, wie verschiedene von ihm verfaßte Denkschriften zu sozialpolitischen Fragen zeigen.21 Zum Bruch kam es erst 1877, als Wagener durch die Veröffentlichung von Interna Druck auf Bismarck auszuüben versuchte.22
Hermann Wagener war, wie zu Recht festgestellt worden ist, als Theoretiker »unbedeutend und unselbständig«.23 Er war jedoch nichtsdestoweniger »einer der klügsten Sozialdiagnostiker seiner Generation«24, wenn man darunter die Fähigkeit versteht, die Zeichen der Zeit zu erkennen und sich für Deutungsangebote zu öffnen, die mit althergebrachten Mustern brachen. Dazu gehörte eine kritische Haltung gegenüber den »herrschenden Stände[n]«, denen Wagener vorwarf, »die Schleusen der Speculation, der Agiotage, des persönlichen Reichwerdens« zu öffnen, »anstatt das Volk in der Beschäftigung mit den Problemen der socialen und staatlichen Organisation zu erziehen«25; gehörte die Bereitschaft zum Dissens mit dem eigenen politischen Lager, wo dieses sich allzu kompromißbereit zeigte; gehörte endlich auch die von keinen Skrupeln getrübte Übernahme von Essentials des gegnerischen Lagers, wenn sich damit die eigene Macht vergrößern ließ. Schon in den frühen 50er Jahren mußten sich die Häupter der konservativen Fraktion im Abgeordneten- wie im Herrenhaus Angriffe der »jeune droite« um Wagener und Bindewald gefallen lassen, die auf eine entschiedenere Haltung sowohl gegenüber der Regierung als auch gegenüber den Liberalen drängten.26 Zur Zeit des Heereskonflikts wurde daraus gar ein förmlicher Bruch, als Ernst Ludwig von Gerlach und die ihm nahestehenden Kreise nolens volens an der preußischen Verfassung von 1848 und erst recht an deren revidierter Version von 1850 festhielten und Veränderungen allein auf legalem Wege angehen wollten27, Wagener hingegen Bismarck empfahl, den Verfassungskonflikt im Wege der »königliche[n] Diktatur« zu lösen. Diese sei zwar nur als ein »Notrechtsmittel«, gedacht »nicht zur Beseitigung, sondern zur Bewahrung der Verfassung«28, mithin eine kommissarische und keine souveräne Diktatur im Sinne der Terminologie Carl Schmitts.29 Doch schloß dies ein Vorgehen nicht aus, das an die radikale Phase der Französischen Revolution erinnert. So sprach Wagener dem »Terrorismus« »ein gewisses Recht« zu, »da die Völker vor allen Dingen erst wieder Gehorsam lernen müssen«, verlangte »die rücksichtsloseste Anwendung der verfassungsmäßigen Machtbefugnisse der Krone« gegen die Feinde der Monarchie – »die Oligarchen des Geldkapitals, sowie an deren Leine laufenden ›katilinarischen Existenzen‹ der Literatur und der wechselverbundenen freisinnigen Größen des Bürokratismus« – und steigerte sich bis zu der Forderung, die Fortschrittspartei, diesen Repräsentanten der Börse und der Bourgeoisie, nicht nur zu besiegen, sondern zu vernichten.30
Wie eine andere Denkschrift zeigt, wollte Wagener die königliche Diktatur zugleich im Sinne Lorenz von Steins verstanden wissen, der dem Königtum 1850 ins Stammbuch geschrieben hatte, es werde »fortan entweder ein leerer Schatten, oder eine Despotie werden, oder untergehen in Republik, wenn es nicht den hohen sittlichen Mut hat, ein Königtum der sozialen Reform zu werden.«31 Was bei Stein jedoch im Sinn einer Förderung der sozialen Aufstiegsmobilität im Rahmen einer auf Konkurrenz gegründeten Wirtschafts- und Sozialordnung gedacht war, reduzierte sich bei Wagener zu diesem Zeitpunkt auf das gezielte Bemühen, einen Keil in das oppositionelle Lager zu treiben, das sich seit der Wahlniederlage der Konservativen von 1858 im Aufwind befand.32 Um ein politisches Gegengewicht zu den Liberalen zu schaffen, empfahl Wagener der Regierung, den Interessen des kleinen Gewerbestandes und der Arbeiterschaft, »deren politische Bedürfnisse stets nach der monarchischen Gewalt gravitieren«, ein Stück weit entgegenzukommen.33 Dazu böten sich mit Blick auf das Handwerk eine schärfere Abgrenzung der Gewerbe an, eine Reorganisation der Gewerberäte sowie die Einrichtung von Gewerbegerichten und Handwerkerdarlehenskassen, bezogen auf die Arbeiter staatlich festgelegte Mindestlöhne, eine Freigebung der Stück- und Akkordarbeit, die gesetzliche Feststellung der Zusammengehörigkeit des Arbeiters und der betreffenden Fabrikzweige und die »Anerkennung des Satzes, daß andauernde Mitarbeit auch Miteigentum verschaffen muß.«34 Ein halbes Jahr später fügte Wagener hinzu:
»Die wesentliche Aufgabe bleibt hier die Sicherung eines angemessenen Arbeitslohnes durch korporative Gestaltungen, ähnlich den zünftigen, welche solange innerhalb des Handwerks alle diesfallsigen Ansprüche befriedigt haben. Zugleich würde in solchen korporativen Gestaltungen auch die rechtliche Unterlage für die politische Vertretung jener Volksklassen gefunden, und dürfte es sich für die Regierung empfehlen, zur Koupierung der beginnenden politischen Agitation das nach Ständen geordnete allgemeine Wahlrecht, modifiziert vielleicht durch die Bedingung der Wehrfähigkeit, als ihr politisches Programm zu proklamieren.«35
Drei Jahre später, nach dem Sieg über Österreich, ließ Wagener die Einschränkung auf Stände fallen und legte darüber hinaus Verwahrung gegen den Vorwurf ein, er habe sich »jemals zu dem Census-System als zu einem echten politisch-konservativen Princip bekannt.« Mit dem Census-System habe der Konstitutionalismus sein eigenes Prinzip verfälscht, es sei deshalb konsequent, dem männlichen Teil der Bevölkerung das allgemeine und direkte Wahlrecht zu gewähren, als »das nothwendige politische Korrelat der allgemeinen Wehrpflicht«.36 Dieser Vorschlag blieb bekanntlich für Preußen unrealisiert, wo bis 1918 das Dreiklassenwahlrecht weiterbestand, wurde aber für die Verfassung des Norddeutschen Bundes übernommen, dessen konstituierender Reichstag im Februar 1867 gewählt wurde.37
In der Wahl seiner theoretischen und praktischen Allianzen legte Wagener eine Haltung an den Tag, die je nach Standpunkt mehr als Unbedenklichkeit oder als Flexibilität erscheint. So erklärte er 1869, für die radikale Gewerbefreiheit und die Beseitigung der Zwangskassen zu stimmen, weil er aus der Geschichte so viel gelernt habe, »daß man ein Princip und jedes Princip sich erst muß vollenden lassen in seinen äußersten Konsequenzen, dann beginnt die Reaktion – und die wünsche ich.«38 Zur Vorbereitung eines Gesetzentwurfs über die Bildung von Gewerkvereinen, den er Bismarck vorlegen wollte39, setzte er sich im April 1866 mit Eugen Dühring (1831–1921) in Verbindung, einem Berliner Privatdozenten, auf dessen Kritische Grundlegung der Volkswirtschaftslehre (Berlin 1866) er aufmerksam geworden war. Dühring, der vor seiner scharfen Verurteilung durch Friedrich Engels (1878) erhebliche Resonanz in sozialistischen Kreisen fand40, obwohl er selbst dem Sozialismus in seinen damaligen Ausprägungen kritisch gegenüberstand, hatte das Prinzip, aus dem heraus Friedrich List seine Lehre vom Schutzzoll entwickelt hatte, »auf die verschiedenen Wirtschafts- und Gesellschaftsgruppen innerhalb der Nationen« übertragen und dies so gefaßt, »daß die Wirtschafts- und Sozialkämpfe nicht Kämpfe der Einzelnen untereinander, sondern Gruppenkämpfe sind«.41 Wie in der Weltmarktkonkurrenz die benachteiligten Nationen sich mithilfe des Schutzzolls zu behaupten vermochten, sollten in den Gruppenkämpfen innerhalb der Nationen die schwächeren Gruppen sich abschließen und organisieren, was in diesem Fall vor allem für die Arbeiter galt. In Kenntnis dieser Prämissen beauftragte Wagener Dühring mit der Abfassung einer Denkschrift über die wirthschaftlichen Associationen und socialen Coalitionen, die für die Arbeiterschaft ein freies Koalitions- und Arbeitsrecht forderte, den Staat zur Regulierung der Arbeitskämpfe in die Pflicht nahm und Ansätze zur Schaffung eines »Arbeiterrechts« entwickelte, »durch das der Staat Einfluß auf die Gestaltung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse« gewinnen sollte.42
Die Denkschrift erschien noch im gleichen Jahr im Druck, zunächst anonym, in der zweiten Auflage jedoch, zum Erstaunen und zur Erbitterung des Verfassers, unter dem Namen – Hermann Wageners. Der daraufhin ausbrechende Rechtsstreit ist von Dühring ausführlich geschildert worden und kann hier außer Betracht bleiben.43 Interessant ist der Fall vor allem deshalb, weil er zum einen die Bereitschaft Wageners zeigt, sich öffentlich mit der Forderung der Arbeiterschaft nach höheren Löhnen, gewerkschaftlicher Organisation und einer Legalisierung der »wirthschaftlichen Kriegführung gegen die Kapital-Herrschaft« zu identifizieren44, zum andern aber eine Übereinstimmung in der Strategie signalisiert, »auf die allseitige combinatorische Vereinigung antagonistischer Regungen« hinzuarbeiten.45 Denn genau darin waren sich Wagener und Dühring einig: »Die alten Parteien mussten, wenn nicht eine innere Wandlung, dann jedenfalls eine äussere Kreuzung erfahren.«46
Wenn man dennoch nicht zusammenkam, so dürfte dies von Wageners Seite her daran gelegen haben, daß er damals noch mit dem Gedanken liebäugelte, in den zu gründenden Gewerkvereinen »die beiden Klassen des gewerblichen Betriebes, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, gleichmäßig« zu vereinigen.47 Von Dührings Seite her erwies sich als Hindernis dessen Forderung, den oppressiven Staat zugunsten der aus Wirtschaftsgemeinschaften bestehenden ›freien Gesellschaft‹ zurückzudrängen48, was für Wagener entschieden zu weit ging. Denn so groß seine Vorbehalte gegen eine bürokratisch-absolutistische Gestaltung des Staates und seine Sympathie für eine Selbstregierung und -verwaltung intermediärer Gruppen auch sein mochten: daß ein moderner Staat ohne starke Zentralgewalt nicht vorstellbar war, stand für ihn fest.49 Eine Regierung, hieß es denn auch kategorisch, kann auf die Dauer nicht bestehen, »wenn es nicht eine Körperschaft giebt, wo die Souveränität voll, unbedingt und ungetheilt vertreten ist«.50 Und das war ein Postulat, das Wagener nicht nur von Dühring und vom Korporatismus trennte, sondern ebensosehr vom historischen Konservatismus.