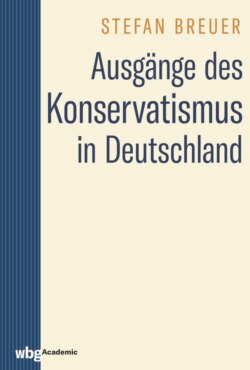Читать книгу Ausgänge des Konservatismus - Stefan Breuer - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеWageners Version des sozialen Königtums, von seinem Adlatus Rudolf Meyer nach 1871 rasch zum »hohenzollernsche[n] Kaiserthum der socialen Reform« aufgewertet51, scheint gleich in doppelter Hinsicht genuin moderner Natur zu sein: zum einen durch seine Neubegründung der Legitimität von bestimmten Funktionen her anstatt vom Gottesgnadentum52; zum andern durch die spezifische Auslegung dieser Funktionen auf materiale Postulate hin, wie sie für den modernen Sozialstaat typisch sind.53 Eine derart eindeutige Positionsbestimmung ist jedoch im Hinblick auf Wagener nicht durchzuhalten. In seinen Äußerungen und Aktivitäten durchkreuzen sich moderne und vormoderne Bestrebungen und gehen bisweilen intrikate Verbindungen ein, die eine genauere Einordnung erschweren. So ist zwar Funktionalität zweifellos ein in der Moderne besonders scharf ausgeprägtes Prinzip, doch läßt sich schwerlich bestreiten, daß sich das Königtum in allen geschichtlichen Erscheinungsformen auch durch die Erfüllung bestimmter Funktionen legitimiert hat, und daß unter diesen Wohlfahrtszwecke jedweder Art eine erhebliche Rolle spielten. Das gilt für das charismatische Königtum der Frühzeit, zu dessen Verpflichtungen es gehörte, das ›Wohlergehen der Beherrschten‹ sicherzustellen.54 Es gilt für das patrimoniale Königtum mit bürokratischer Verwaltung, die in ihrem »Interesse an der Zufriedenheit der Beherrschten« zu einer an utilitarischen oder materialen Idealen orientierten Regulierung der Wirtschaft tendiert, womit stets eine »Durchbrechung ihrer formalen, an Juristenrecht orientierten, Rationalität« verbunden ist.55 Und es gilt schließlich auch noch für das demokratisch legitimierte Königtum, die auf der Volkssouveränität beruhende plebiszitäre Herrschaft, die infolge ihrer »Legitimitätsabhängigkeit von dem Glauben und der Hingabe der Massen« genötigt ist, »materiale Gerechtigkeitspostulate auch wirtschaftlich zu vertreten, also: den formalen Charakter der Justiz und Verwaltung durch eine materiale (›Kadi‹-) Justiz (Revolutionstribunale, Bezugscheinsysteme, alle Arten von rationierter und kontrollierter Produktion und Konsumtion) zu durchbrechen.«56
Wie sehr bei Wagener moderne und vormoderne Motive ineinander verschlungen waren, zeigen die Initiativen, die er 1856 zur Revision der preußischen Verfassung von 1850 entfaltete. Nach dem Erfolg der Konservativen bei den Wahlen vom Herbst 1855 konstituierte sich im Abgeordnetenhaus eine »Commission für Verfassungs-Angelegenheiten« unter dem Vorsitz Ernst Ludwig von Gerlachs, die einen weiteren Umbau der bereits mehrfach revidierten Verfassung in die Wege leiten sollte. Der radikalste Vorstoß wurde im Januar 1856 von Wagener vorgetragen und noch im März Gegenstand einer erregten Debatte im Abgeordnetenhaus, an der sich auch die Öffentlichkeit beteiligte.57 Er zielte mit Artikel 4 auf eine zentrale Hinterlassenschaft der Revolution, die die Gleichheit aller Preußen vor dem Gesetz statuierte und dies mit zwei weiteren Bestimmungen verknüpfte: der Aufhebung der Standesvorrechte und dem gleichen Zugang aller dazu Befähigten zu den öffentlichen Ämtern. Wageners Antrag lautete auf ersatzlose Streichung dieses Artikels. Die Menschen seien zwar, wie es in Anspielung auf 1. Korinther 15,45 ff. hieß, »geboren in der Gleichheit des ersten, und berufen zur Gleichheit des zweiten Adam«, doch sei in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ordnung die Gleichheit ersetzt durch die Ungleichheit der Gnadengaben und Ämter. Eine Gleichheit der politischen Rechte sei damit ebenso ausgeschlossen wie eine gesellschaftliche Gleichheit. Vielmehr sei Ungleichheit »authentisch, selbstverständlich und von göttlichem Ursprung, ja mit Blick auf das Entstehen und Funktionieren von Staat und Gesellschaft gar organisch.«58 Niemand, folgerte Wagener, einmal mehr unter ausführlicher Bezugnahme auf Lorenz von Stein, stehe im Staate isoliert da, vielmehr sei »die Person Theil und Glied organischer Anstalten und Verbindungen«, von denen keine aus gleichen Teilen bestehe. Die politischen Rechte, die aus der Zugehörigkeit zu diesen Anstalten erwüchsen, seien nicht minder als Eigentum zu betrachten »als das erworbene Privat-Eigenthum«.59
Es bedarf keiner weit ausholenden Erläuterungen, um klar zu machen, was hier gemeint ist: die Rückkehr zur stratifikatorischen Differenzierung und damit zu einer Ordnung, in der die Schichtzugehörigkeit multifunktional wirkt und einer Eigengesetzlichkeit verschiedener Handlungssphären schwer zu überwindende Schranken zieht. Das entspricht ganz der oben referierten programmatischen Kundgebung zur konservativen Politik, in der dem »sociale[n] Liberalismus« vorgeworfen wird, »zur Lösung der gesellschaftlichen Bande, zur Atomisirung der Gesellschaft« geführt zu haben, ein Ergebnis, dem das »Recht der Gesellschaft« gegenübergestellt werden müsse, namentlich das »Grundgesetz des organischen Lebens«, wonach »jedes Glied und jedes System des Organismus möglichst vollkommen, d. h. zu selbständiger Lebens- und Bildungsfähigkeit entwickelt sein müsse, um den Gesammt-Organismus zur höchsten Vollkommenheit und Machtfülle zu erheben.«60 Das hieß positiv gewendet: Befestigung der Familie, Befestigung des Grundbesitzes und der darauf basierenden Gemeindeordnungen, »Decentralisation des staatlichen und wirthschaftlichen Lebens, Herstellung örtlicher und provinzieller Selbständigkeit« und nicht zuletzt: Schaffung einer »auf produktiver Arbeit gegründete[n] und sich ausbildende[n] politische[n] Aristokratie«.61 Mochten die alten Stände auch an Kraft und Legitimität eingebüßt haben, so schien es dem Irvingianer Wagener doch im Bereich des Möglichen, eine »ständische Wiedergeburt (!) mit neuen Ständen« anzustreben, die über umfassende Rechte der Selbstverwaltung verfügen würden.62 Zu ihnen sollten neben Adel, Bürgertum und Bauerntum auch der Handwerkerstand sowie der zu Korporationen zusammenzufassende Arbeiterstand gehören, welch letzterer nach dem Vorbild der Stein-Hardenbergschen Reformen zu ›emanzipieren‹ sei.63 »Kein Bruch mit der Vergangenheit im Innern unseres Staates«, hieß es im Programm des von Wagener gegründeten Preußischen Volksvereins, »keine Beseitigung des christlichen Fundaments und der geschichtlich bewährten Elemente unserer Verfassung; […] kein Preisgeben des Handwerkes und des Grundbesitzes an die Irrlehren und Wucherkünste der Zeit.«64
Schon die Liste der von Wagener angesprochenen Stände sollte allerdings davor warnen, seine Ausführungen zum Nominalwert zu nehmen. Das Allgemeine Preußische Landrecht kannte lediglich drei Stände (Adel, Bürgertum und Bauern), auch wenn es daneben bereits die Existenz neuer Klassen und Gruppen einräumen mußte, die das dreigliedrige Modell aufweichten.65 Als eigentlicher Herrschaftsstand galt dabei der Adel, während das Bürgertum unterprivilegiert war, um von den Bauern zu schweigen.66 Gar keinen Platz in der herkömmlichen Standesordnung hatte dagegen die städtische und die ländliche Arbeiterschaft, weshalb Ernst Ludwig von Gerlach noch 1865 behaupten konnte, ein vierter Stand existiere nicht.67 Einen solchen ins Leben zu rufen, lag aber letztlich auch in Wageners Absicht nicht, erklärte er doch ausdrücklich die Arbeiterfrage zu einer »ganz neue[n] Frage«, deren Behandlung durch »die alten Organe […] nichts weiter sein [würde] als ein komischer Versuch. Man kann leichter mit einem schweren Frachtwagen im Sande Galopp fahren als die Arbeiterfrage lösen mit Männern und Organen, die derselben fremd oder feindlich gegenüberstehen. Man füllt eben nicht ›neuen Most in alte Schläuche‹, und wenn man ein fehlerhaftes System aus den Angeln heben will, so kann dies nur dadurch geschehen, daß man einen festen Punkt außerhalb desselben zu finden weiß.«68
Der Punkt außerhalb, von dem hier die Rede ist, war indes nicht nur ein Punkt. Er war die Keimzelle eines gänzlich anderen Systems. War in der ständischen Ordnung, in den Worten Max Webers, die soziale Lage der verschiedenen Schichten »durch eine spezifische, positive oder negative, soziale Einschätzung der ›Ehre‹ bedingt«, so wich die Lage der Arbeiterschaft hiervon insofern ab, als sie primär ökonomisch bestimmt war, durch die für die Wirtschaftsordnung typische unterschiedliche »Verfügung über sachlichen Besitz«.69 Das Verhältnis von Besitz und Besitzlosigkeit aber ist, wiederum nach Weber, die Basis aller »Klassenlagen«, die dazu tendieren, zugleich »Marktlagen« zu sein – im Fall der Arbeiter wie der Unternehmer: Arbeits- und Gütermarktlagen.70 Das scheint auch Wagener gegen Ende der 60er Jahre deutlich geworden zu sein, sprach er doch seit dieser Zeit von einer »Entwicklung des Staates aus feudalistischen und bürokratischen Elementen zu einer modernen Erwerbsgesellschaft«, deren Teilnehmer sich nach materiellen Interessen gruppierten.71 Entsprechend stünden sich nicht mehr verschiedene Stände gegenüber, sondern »die Interessen der handelstreibenden und industriellen Klassen« auf der einen Seite und die »Interessen des Grundbesitzes und der arbeitenden Klasse« auf der anderen. Deren Beziehungen aber würden anstatt durch Herrschaft durch Markt und Geld bestimmt. Schon das oben zitierte Grundsatzprogramm von 1856 trug dem Rechnung, indem es der konservativen Agrarpolitik die paradoxe Aufgabe zuwies, eine »Feudalisirung des ländlichen Grundvermögens im modernen, der Macht der Geldwirthschaft entsprechenden Sinne« anzustreben.72 Mit den Ansichten Ernst Ludwig von Gerlachs, der die soziale Frage mit den Mitteln des »Lehnsrechts« lösen und die Grundherrschaft wie die Fabrik als »kleine Fürstentümer« nach dem Modell des herkömmlichen Patriarchalismus organisieren wollte73, war unter solchen Voraussetzungen eine Verständigung nicht mehr möglich, und so war es denn auch nur konsequent, wenn beide 1865 ihren Gegensatz in der sozialen Frage endlich auch in der Öffentlichkeit austrugen.74
Wie unorganisch die von Wagener anvisierte Neubegründung des Konservatismus ungeachtet aller Beschwörungen des ›Organischen‹ war, läßt sich auch am Verhältnis von Politik und Religion demonstrieren. Nachdem Wagener Anfang 1856 im Abgeordnetenhaus mit seinem Antrag auf Abschaffung des Artikels 4 der revidierten preußischen Verfassung von 1850 gescheitert war, suchte er wenigstens die für stratifizierte Ordnungen charakteristische Einheit von Herrschaftsausübung und Religion zu sichern, indem er bei der Beratung der Gemeindeordnung unter Verweis auf die in Artikel 14 festgelegte besondere Bedeutung des Christentums für diejenigen Einrichtungen des Staates, »welche mit der Religionsausübung in Zusammenhang stehen«, eine Modifizierung des Artikels 12 verlangte. Aus diesem Artikel, der die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, die Vereinigung zu Religionsgesellschaften und der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Religionsausübung gewährleistete, wollte Wagener, in Wiederaufnahme eines bereits 1852 von einem Posener Abgeordneten gestellten, jedoch abgelehnten Antrags, die Bestimmung gestrichen haben, wonach der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte unabhängig vom religiösen Bekenntnis sei75, mit der Folge, daß damit automatisch alle Nichtchristen – und das hieß rebus sic stantibus vor allem: die Juden – von diesen Rechten ausgeschlossen sein würden: eine Wiederaufnahme und Verschärfung der von Friedrich Julius Stahl vertretenen Lehre vom »christlichen Staat«, die sich in den Beratungen über die Verfassung nicht hatte durchsetzen können, obwohl sie sich im Unterschied zu Wageners Antrag nur auf die staatsbürgerlichen Rechte bezogen hatte.76 Daß der preußische Staat ein christlicher Staat sei, so Wageners Begründung, sei eine Bestimmung, deren Auswirkung bis tief in die bürgerlichen Verhältnisse, etwa in die Begriffe von Person und Eigentum, hineinreiche und nicht weniger bedeute, als daß allen Zielen und Endzwecken des Staates »der christliche Glaube und die christlichen Verheißungen und dessen Gesetzen und Institutionen die christliche Moral zu Grunde liegt«, woraus wiederum zwingend folge, daß er »um deswillen seine Gesetze nur durch Christen machen, auslegen und anwenden lassen darf.«77
Die Kommission, die im Vorfeld dieses Antrags unter der Leitung Ernst Ludwig von Gerlachs darüber beraten hatte, war vielen der von Wagener vorgebrachten Argumenten gefolgt, hatte sich dann aber aus pragmatischen Gründen für eine abgeschwächte Lösung entschieden, die den Genuß der bürgerlichen Rechte vom religiösen Bekenntnis unabhängig machte, die »Regulierung der staatsbürgerlichen Rechte der nicht-christlichen Staats-Angehörigen« hingegen der »Spezial-Gesetzgebung« überantwortete, welche man sich entlang der Vorgaben des Gesetzes vom 23. 7. 1847 dachte, das die Juden von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen hatte.78 Selbst diese Version, die recht genau zusammenfaßte, was die Juden zu dieser Zeit und noch auf längere Sicht von der konservativen Partei zu gewärtigen hatten79, kam jedoch aufgrund einer Intervention des mit Wagener seit 1848 verfeindeten Grafen von Schwerin nicht zum Zuge, der den Antrag auf Übergang zur Tagesordnung stellte.80 Obwohl die Konservativen über eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus verfügten, kam die Kammer dem Antrag nach, wohl nicht zuletzt auch deshalb, weil die Regierung deutlich signalisierte, an der konkurrierenden Gültigkeit der Gesetze neben der Verfassungsurkunde festhalten und »eine zu weit greifende, den christlichen Charakter des Staates verletzende Anwendung des fraglichen Satzes des Artikels 12 nicht Platz greifen lassen« zu wollen.81
Das Thema war damit freilich für Wagener und seinen Anhang nicht vom Tisch. Ein Jahr später gab er die Schrift eines ungenannt bleibenden Verfassers über Das Judentum und der Staat heraus, die den Juden zwar »die Bürgerschaft mit ihren civilen Rechten« zugestand, ihnen »das auf die religiös-nationale Einheit gegründete Staatsbürgerthum mit seinen politischen Rechten« indessen kategorisch absprach.82 Im März 1859 unternahm sein Parteifreund Moritz von Blanckenburg einen neuerlichen Vorstoß im Abgeordnetenhaus, um den Bestrebungen entgegenzuwirken, die auf eine Anwendung der Artikel 4 und 12 der Verfassung gegen die im Gesetz vom 23. 7. 1847 festgelegten Restriktionen zielten, unter dem Beifall der Brüder Gerlach, die Blanckenburg bescheinigten, er habe »in der Judensache als trefflicher Feldherr gekämpft, den Feind vorgelockt und gezwungen, die Waffen zu strecken.«83 Noch Jahre später erklärte Wagener, er wolle nicht, daß ihm in einem christlichen Staate ein Eid abgenommen werde von Jemandem, »der das Kruzifix als einen Spott und als einen Hohn ansehen muß.« Sehr wohl aber sei das Umgekehrte möglich, »weil die christliche Religion die höhere Form des Judenthums ist«.84
Seine Interventionen haben Wagener den Vorwurf eingetragen, nicht nur Antisemit, sondern auch Rassist gewesen zu sein und eine Entwicklung eingeleitet zu haben, an deren Ende der Holocaust stand.85 Richtig ist, erstens: Wagener hat als Herausgeber des Staats- und Gesellschafts-Lexikons einen krassen Antisemiten wie Bruno Bauer zum leitenden Redakteur berufen und ihn einen Artikel schreiben lassen, in dem die Juden als auf der Stufe des »Thiergeistes« stehengebliebene »Naturwesen« charakterisiert werden, als »eine fremde und geistlich-feindliche Race«, als »Parasit[en]« und »bodenlose[n] Zigeuner-Aristokratie«, die in Preußen seit Anfang des 19. Jahrhunderts »fast zu einer herrschenden Klasse« geworden sei.86 Richtig ist, zweitens: Wagener hat als Eigentümer der Berliner Revue zahllose Artikel gegen das Judentum zu verantworten, die weit über einen rein religiös begründeten Antijudaismus hinausgehen.87 Ob diese Artikel alle, wie man vermutet hat88, aus der Feder Bruno Bauers stammen, ist nicht gesichert, allerdings zumindest für einen Teil derselben auch nicht auszuschließen. Und richtig ist, drittens: er hat die Redaktion des vom Preußischen Volksverein herausgegebenen Kalenders ausgerechnet Hermann Goedsche anvertraut, der unter dem Pseudonym »Sir John Retcliffe« seit Mitte der 50er Jahre mit höchst erfolgreichen zeitgeschichtlichen Sensationsromanen hervortrat – Werken, die nicht nur antisemitische Ressentiments und (nach den Maßstäben der Zeit) pornographische Interessen bedienten, sondern darüber hinaus die Blaupause für die »Protokolle der Weisen von Zion« lieferten, bis heute ein zentraler Referenztext für das Phantasma einer jüdischen Weltverschwörung.89
Das alles war zweifellos Wasser auf die Mühlen des sich seit den 60er Jahren immer aufdringlicher artikulierenden Antisemitismus, und dies nicht nur tropfen-, sondern kübelweise. Nicht leicht zu beantworten ist hingegen die Frage, ob Wagener sich all dies auch subjektiv zu eigen gemacht oder nicht vielmehr nur strategisch eingesetzt hat. Spezifisch rassistische Begründungen seiner Judenfeindschaft lassen sich in dem von ihm als Herausgeber gezeichneten Text von 1857 nicht ausmachen90, es sei denn, man dehnt den Rassismusbegriff in der heute beliebten Weise so weit aus, daß er ein Synonym für ›gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit‹ ist, was dem Begriff jede Unterscheidungskraft nimmt. Selbst dort jedoch, wo das Judentum expressis verbis »nicht allein als Religion und Kirche, sondern ganz vorzüglich als der Ausdruck einer Raceneigenthümlichkeit« thematisiert wird91, ist Rasse deckungsgleich mit »Nationalität«, die wiederum ihren Hauptinhalt durch die Religion erhält. Die Vorstellung, daß zu einem »Volksgeist« auch eine »Volksseele« und ein »Volkskörper« gehören, bleibt im Rahmen der idealistischen Begrifflichkeit des frühen 19. Jahrhunderts und ist deshalb nicht mit dem biologisch begründeten Rassismus zu verwechseln, der erst in der Endphase des Jahrhunderts aufkommt.92
Mehr scheint dagegen für die Vermutung zu sprechen, Wagener habe im Judentum eine Fusion von Religion und Politik, eine Art Staatskirchentum gesehen, das in Konkurrenz zu dem analog konzipierten christlichen Staat stand. Tatsächlich schreibt der Emanzipationsartikel im Staats- und Gesellschafts-Lexikon dem Judentum den »Charakter einer Staatskirche« zu und lehnt die Emanzipation vor allem deshalb ab, weil ihr kein Staatsvertrag vorausgegangen sei.93 Die Verweigerung gleicher staatsbürgerlicher Rechte für die Juden wäre von hier aus gesehen eine Folgerung aus der Eigenart ständischer Differenzierung, für die Herrschaftsausübung und Religion nicht zu trennen sind.94 Das kommt der Wahrheit zwar näher als moralisierende Anklagen im Stil Sartres, für die der Antisemitismus »von keinem äußeren Faktor herstammen kann«, vielmehr »eine selbstgewählte Haltung der ganzen Persönlichkeit« ausdrückt.95 Doch geht auch diese Deutung noch an einem wichtigen Punkt vorbei. Mit seinem Änderungsvorschlag für Artikel 12 wollte Wagener gewiß die Christlichkeit des preußischen Staates festschreiben, doch zeigen die näheren Ausführungen in Das Judenthum und der Staat, daß ihm dabei eine sehr spezifische Ausprägung dieser Christlichkeit vorschwebte. Denn der christliche Staat sollte zwar wie die jüdische ›Staatskirche‹ auf einer religiösen Grundlage beruhen und deshalb auch »nur Christen als wahrhaft befähigt zur Theilnahme an seinem öffentlichen Leben anerkennen dürfen.«96 Er sollte sich jedoch zugleich von ihr unterscheiden, indem er eine religiös-politisch indifferente Sphäre des bürgerlichen Verkehrs freigab und damit eine Differenzierung »zwischen Bürgern und Staatsbürgern, zwischen civilen und politischen Rechten« ermöglichte.97 In dieser Sphäre seien Juden zu gleichen Rechten zuzulassen wie alle anderen. »Sie sollen leben und wohnen, erwerben und besitzen, handeln und wandeln wie irgend Jemand. Keine Einschränkung soll ihnen mehr das Leben verbittern, ihren Verkehr und ihre Ehre beschädigen.«98 Vom Staatsbürgertum dagegen, in dem sich »die sittlich religiöse und die sittlich nationale Voraussetzung des Staates« erfülle99, seien sie fernzuhalten – ein fernes Echo jener Lutherschen Lehre von den zwei Reichen, deren eines – das »Reich Christi« – eine allein aus der Offenbarung zu verstehende Ordnung der göttlichen Liebe sei, deren anderes – das der Sünde preisgegebene »Reich der Welt« – seine eigenen Gesetze habe, denen sich Christen wie Nichtchristen gleichermaßen zu unterwerfen hätten.100 Wageners Version der Lehre vom christlichen Staat setzte zwar insofern einen anderen Akzent, als sie Staatlich-Politisches auch in das Reich Christi hinüberzog, doch steht die Herauslösung einer religiös indifferenten Sphäre unverkennbar in jener mit dem Protestantismus einsetzenden Reihe fortschreitender Neutralisierungen, in der Carl Schmitt ein zentrales Merkmal des neuzeitlichen Rationalisierungsprozesses ausgemacht hat.101 In bezug auf die Juden dagegen steht sie am Anfang einer Reihe von Strategien der Exklusion, für die die Bezeichnung »radikaler Antisemitismus« angemessen ist.102