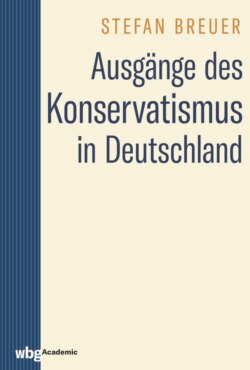Читать книгу Ausgänge des Konservatismus - Stefan Breuer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zur Einführung
ОглавлениеAls Thomas Mann am Ende des Zweiten Weltkriegs im amerikanischen Exil einen Vortrag über das Schicksal seines Landes hielt, das soviel Tod und Elend über die Welt gebracht hatte, kam er auch auf die Rolle des Konservatismus zu sprechen, zu dem er sich selbst einmal bekannt hatte. Deutschland, so sein Gedankengang, habe sich mit der Reformation, genauer gesagt: mit der Reformation lutherischen Gepräges, auf einen Sonderweg begeben, in dessen Verlauf das Streben nach Freiheit aus der politischen Sphäre in die Innerlichkeit verbannt worden sei. Dort habe es in Magie und Mystik, aber auch in Musik und Literatur, reichen Ausdruck gefunden, während zur gleichen Zeit das politische Feld den powers that be überlassen wurde. Im 19. Jahrhundert sei daraus jenes fatale Amalgam von politischer Romantik und Konservatismus entstanden, das im 20. Jahrhundert den Nationalsozialismus hervorgebracht habe. Damit habe sich auf politischer Bühne wiederholt, was der Autor des Doktor Faustus zur gleichen Zeit am Schicksal seines Helden, Adrian Leverkühn, exemplifizierte: »Wo der Hochmut des Intellektes sich mit seelischer Altertümlichkeit und Gebundenheit gattet, da ist der Teufel.«1
Historiker und Politikwissenschaftler pflegen diese Geschichte etwas anders zu erzählen, doch nicht so, daß dieses Grundmuster nicht noch erkennbar wäre. Ganz gleich, wann man den Konservatismus beginnen läßt: ob schon im 17. Jahrhundert mit der Kritik am Rationalismus2, im 18. mit dem Kampf gegen den bürokratischen Staat und / oder die Französische Revolution3 oder erst im 19. mit der Reaktion auf den Liberalismus4: stets sind es spezifisch moderne Erscheinungen, die ihn erst erzeugt haben sollen. Als »der Geist, der stets verneint«, sei der Konservatismus die reine Negativität, allerdings nicht im Goetheschen Sinne »jener Kraft, Die stets das Böse will und stets das Gute schafft«. Vielmehr sei er für die »Zerstörung der Vernunft« (Georg Lukács) verantwortlich, die Abdrift in den Irrationalismus, die politische Romantik oder auch den »Nihilismus« (Fritz Stern), Erscheinungen, die es bewirkt hätten, daß Deutschlands »Weg in den Westen« sich so ungebührlich in die Länge zog und überhaupt nur mit fremder Hilfe abgeschlossen werden konnte.5 Lange Zeit eine elitäre Angelegenheit ländlicher Honoratioren, habe sich der Konservatismus mit dem Aufkommen der modernen Massenpolitik auf ein Bündnis mit nationalistischen und rassistischen Verbänden wie dem Bund der Landwirte eingelassen und dabei offensichtlich nichts von seinem Wesen eingebüßt, vielmehr dieses sogar noch zu einem »Radikal«- oder »Ultrakonservatismus« gesteigert, der in einer letzten Stufe sich selbst aufgehoben habe und im völkischen deutschen Nationalismus aufgegangen sei6 – eine Entwicklungskonstruktion, die bis heute für Darstellungen das Schema abgibt, die unter dem Obertitel Konservatismus »Theorien des Konservatismus und Rechtsextremismus« abhandeln.7 Wie lange die Metaphorik Thomas Manns auf diesem Feld nachgewirkt hat, konnte man noch 1982 in einem Text von Jürgen Habermas lesen, in dem er anläßlich der »innenpolitischen Wende zum Neokonservativismus« – gemeint ist der Regierungswechsel von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl – vor einem »Teufelskreis« warnen zu müssen glaubte, der dazu führen könne, daß »die intellektuelle Jugend […] zu Nietzsche zurückkehrt und in den bedeutungsschwangeren Stimmungen eines kultisch erneuerten, eines authentischen, noch nicht von Kompromissen entstellten Jungkonservatismus ihr Heil sucht.«8
Diese bis heute gepflegte große Erzählung hat freilich nicht überall Zustimmung gefunden. Vor allem amerikanische und britische Forscher haben den Akzent auf die zunehmende Fragmentierung gelegt, die das konservative Lager schon in wilhelminischer Zeit zersplittert und besonders die moderateren Kräfte geschwächt habe.9 Spätestens die Führungskrise in der Deutschnationalen Volkspartei, aus der 1928 Alfred Hugenberg als Sieger hervorgegangen sei, habe dann einen Wendepunkt in der Geschichte des deutschen Konservatismus markiert, an dem sich Konservatismus und radikaler Nationalismus getrennt hätten.10 Einen wesentlichen Beitrag dazu habe der radikalnationalistische Alldeutsche Verband geleistet, durch dessen Interventionen »the development of a moderate, state-supporting, mass-based conservative party« unterbunden worden sei.11 Der Aufstieg des Nationalsozialismus müsse deshalb gerade nicht als Ergebnis einer Transformation des deutschen Konservatismus verstanden werden, sondern als Folge seiner »Marginalisierung« und ›Veralldeutschung‹, die schon vor dem Ersten Weltkrieg eingesetzt und seine Fähigkeit beeinträchtigt habe, die radikale Rechte einzubinden und auf eine »konservative« Plattform zu verpflichten.12
Noch einen Schritt weiter ist Panajotis Kondylis gegangen. Für ihn handelt es sich beim Konservatismus nicht um eine konstante, auf Sicherung des jeweiligen Status quo ausgerichtete Einstellung, die daher unter wechselnden Umständen in stets neuen Formen auftreten kann, vielmehr um eine konkrete geschichtliche, an eine bestimmte Sozialformation – die vormoderne societas civilis – und eine bestimmte Trägerschicht – den Adel – gebundene Erscheinung, welche in dem Augenblick zu ihrem Ende kam, »als sich die Trennung von Staat und Gesellschaft (d. h. vom modernen zentralisierten und einheitlich verwalteten Staat und der vom Bürgertum beherrschten, sich rasch industrialisierenden Gesellschaft) auf der ganzen Linie durchsetzte« – ein Prozeß, der in England und Frankreich seit 1830 zu beobachten sei, in Deutschland bzw. Preußen zwischen 1848 und der Nationalstaatsgründung.13 Im Zuge dieser Entwicklung habe sich eine Art von doppelter Mimikry vollzogen. Während diejenigen, die »den Ideen des herkömmlichen adligen Konservativismus treu geblieben waren, sich bei etwaiger Beibehaltung des konservativen Schildes (alt-)liberale Grundpositionen« aneigneten, »vornehmlich in bezug auf die Unverletzlichkeit des Eigentums und der Wirtschaftsfreiheit«, hätten umgekehrt die Liberalen angesichts der wachsenden sozialistischen Gefahr immer stärkere Neigung gezeigt, »sich das ›konservative‹ Schild anzuhängen«.14 Es entspricht dieser Sachlage, wenn neuere Untersuchungen zum Konservatismus nach 1945 zu dem Ergebnis kommen, man habe es entweder mit einem Hybrid aus liberalen und konservativen Denkfiguren (mit deutlichem Vorrang der ersteren) zu tun oder mit Rückgriffen auf das Ideengut der radikalen Rechten.15 Von solchen Diagnosen unterscheidet sich Kondylis nur in der Rigorosität, mit der er den Konservatismusbegriff bereits für das Kaiserreich und die nachfolgenden Regime verabschiedet.
Über die einzelnen Schritte seiner Argumentation wird noch ausführlicher zu sprechen sein. Hier sei nur vorausgeschickt, daß dieses Buch ihr zwar in der großen Linie folgen, im historischen Detail aber einige Nuancierungen vornehmen wird. Denn auch wenn man zugibt, daß sich in Deutschland nach 1848 der soziale Träger des Konservatismus in den Rahmen einer »ökonomisch orientierten Gesellschaft« fügte und in »eine der antagonistischen Gruppen oder Klassen der neuen [scil. bürgerlichkapitalistischen] Gesellschaft« verwandelte16, so muß doch für eine längere Übergangsphase mit der Kopräsenz von Formen der Vergemeinschaftung im Sinne Max Webers gerechnet werden, die mit den Formen der Vergesellschaftung nicht durchweg harmonierten. So hat insbesondere die neuere, wesentlich von Heinz Reif angestoßene Adelsforschung nachweisen können, daß Adlige und Bürgerliche auf dem Lande bis zum Ende des Kaiserreiches, weit davon entfernt, zu einer einzigen composite elite zu verschmelzen, zwei deutlich voneinander unterscheidbare Gruppen bildeten17: zum einen durch die unterschiedliche Besitzverteilung, blieben doch die ersteren mehrheitlich im Besitz der größeren Güter und vermochten diese auch zu bewahren, wohingegen die Bürgerlichen »weitgehend den schon lange vor 1800 existierenden Markt kleinerer Güter [übernahmen], die immer wieder zwischen oft wechselnden Besitzern fluktuierten« und demgemäß nicht die Stabilität aufwiesen, die für den adligen Besitz charakteristisch blieb18; zum andern durch die nach 1848 massiv einsetzende Tendenz zur Besitzsicherung im Wege der Fideikommißbildung, die über ein Viertel der Rittergüter dem Markt entzog und zumal dem Kleinadel eine seigneuriale Lebenshaltung ermöglichte, mit dem Effekt, auf diese Weise die Verbürgerlichung der grundbesitzenden Klassen, wenn nicht zu blockieren, so doch erheblich in die Länge zu ziehen19; last, but not least sozial und kulturell durch den Ausbau exklusiver Heirats- und Geselligkeitskreise, vermöge deren der Bürger auch als Großgrundbesitzer Bürger blieb und »nicht (neo-)feudalisiert oder aristokratisiert« wurde.20 Ungeachtet aller Tendenzen zur Herausbildung einer »Elitensynthese aus Großbürgertum und den reichsten, kultiviertesten Teilen des alten Adels« blieben deshalb in Deutschland »Adel und Bürgertum […] bis in das 20. Jahrhundert hinein zwei im europäischen Vergleich ungewöhnlich deutlich voneinander getrennte Gruppen«.21
Die dadurch entstehende Spannung zwischen Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung war groß genug, um Raum für Versuche zu bieten, die membra disiecta des historischen Konservatismus zu Ordnungen zusammenzufügen, in denen sich Neues mit allerlei Altem verbinden sollte, von der christlichen Religion über die Monarchie bis hin zum Ständewesen. Das geschah, eine Folge der Bildungsrevolution des 19. Jahrhunderts, durch ideologische Unternehmer, durch Intellektuelle in jenem Sinne, den Gangolf Hübinger im Anschluß an Max Weber dieser Kategorie verliehen hat.22 Allerdings betraten diese die Bühne zu einem Zeitpunkt, als sich in Deutschland ein ›literarisches Feld‹ eben erst zu bilden begann – einer Lage mithin, die ihnen nur begrenzte Möglichkeiten bot, ihre Existenz über den Verkauf geistiger Erzeugnisse auf preisregulierten Märkten zu sichern.23 Typisch für sie war deshalb die gesuchte und zeitweise auch erreichte Nähe zur politischen Herrschaft, die in zentralen Bereichen wie den Spitzen von Armee und Verwaltung noch lange vom Adel geprägt blieb. Das gilt schon für Friedrich Julius Stahl, der als Staatsrechtslehrer an der Berliner Universität und zugleich als Mitglied der Ersten Kammer bzw. des Herrenhauses wirkte; für Hermann Wagener, der jahrelang zu den engsten Beratern Bismarcks gehörte; für seinen Mitarbeiter Rudolf Meyer, der mit der Berliner Revue das wichtigste Theorieorgan des preußischen Konservatismus leitete und später im Exil adlige Sozialpolitiker der Donaumonarchie beriet; für Adolf Stoecker in seiner Doppelfunktion als Hofprediger und Vorsitzender der Christlich-sozialen Partei, in der auch der Nationalökonom Adolph Wagner eine wichtige Rolle spielte; und es gilt selbst noch für Constantin Frantz, der vor seiner Entscheidung für eine Privatgelehrtenexistenz zur Entourage des preußischen Ministerpräsidenten Manteuffel zählte und einige Jahre im diplomatischen Dienst verbrachte. Erst mit Lagarde, Langbehn, den Brüdern Mann und anderen meldeten sich Autoren zu Wort, die sich bewußt außerhalb dessen plazierten, was im weitesten Sinne des Wortes noch als »konservatives Milieu« gelten mag.
Gemeinsam war ihnen die Absicht, den historischen Konservatismus auf verschiedenen Wegen – mittels Memoranden, Gesetzgebungsinitiativen oder publizistischen Interventionen – theoretisch der Zeitlage anzupassen und praktisch zu festigen, indem sie ihm über seine bisherige Verankerung im Adel hinaus neue Trägerschichten erschlossen, sei es im Bürgertum, im Handwerk, im Bauerntum oder der städtischen und ländlichen Arbeiterschaft. Manche, wie Stahl, zögerten nicht, »jenen großen Gewinn unseres öffentlichen Zustandes« anzuerkennen, »der sich von der Epoche 1789 an datirt«, und rückten den Konservatismus an den Liberalismus.24 Sie ebneten damit den Weg für konservativ-liberale Hybridbildungen, denen auf liberaler Seite ähnliche Bestrebungen in Richtung einer Assimilierung konservativer Elemente entsprachen.25 Andere, wie Hermann Wagener, warben um das von den Fortschritten der Industrie gefährdete Handwerkertum und setzten sich frühzeitig für das allgemeine Wahlrecht ein, während wieder andere sich der Kleinbauern und Landarbeiter annahmen oder das neue Feld der Sozialpolitik entdeckten, von dem die Liberalen nichts wissen wollten. Gewiß waren die Motive, in diesen Richtungen tätig zu werden, nicht primär philanthropischer Natur. In diesem Punkt ist Kondylis recht zu geben, auch wenn die von ihm angegebenen ökonomischen Motive durch die Notwendigkeit zu ergänzen sind, sich auf einem neu entstehenden politischen Massenmarkt zu behaupten, der, je länger, je mehr, zu Ungunsten der konservativen Parteien wirkte.26 Darüber hinaus war die angestrebte Inklusion von Anfang an mit massiven Exklusionen verbunden, die sich gegen religiöse und ethnische Minderheiten richteten, nicht nur, aber in besonders aggressiver Weise, gegen Juden.
Eine Darstellung indessen, die nur hiervon handelt und dafür einen generellen ›Antimodernismus‹ verantwortlich macht, wird den Widersprüchen nicht gerecht, die für alle großen politischen Ideologien charakteristisch sind. Der ausgehende Konservatismus mag alle Vorwürfe verdienen, die an seine Adresse gerichtet wurden. Ihn darauf zu reduzieren, hieße die Bedeutung zu ignorieren, die einige seiner Verfechter im Vorfeld der im Fin de siècle einsetzenden »Umverteilungsrevolution« gehabt haben, formulierten sie doch schon den den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts Vorschläge, wie durch Steuerreformen, den Aufbau von Institutionen der sozialen Sicherung sowie die Einrichtung von Formen der kollektiven Interessenvertretung der Lohnabhängigen die sozialen Spannungen, wenn nicht beseitigt, so doch verringert werden konnten.27 Das alles mag als Mittel für gänzlich andere Zwecke gedacht worden sein. Daß es geschehen ist und diese Resultate hinterlassen hat, gehört zu jenen eigentümlichen ›Paradoxien der Wirkung gegenüber dem Wollen‹, für die Max Weber den Blick geschärft hat.28
Zur Zitierweise: Um das Literaturverzeichnis zu entlasten, werden dort nur die häufig zitierten Hauptwerke der Primär- und Sekundärliteratur ausgewiesen. Das übrige Schrifttum wird mit vollen bibliographischen Angaben im Anmerkungsapparat nachgewiesen, bei wiederholter Bezugnahme innerhalb eines Kapitels nur in Kurzzitation. Hervorhebungen im Original wurden nur in Ausnahmefällen übernommen, eigene als solche markiert.