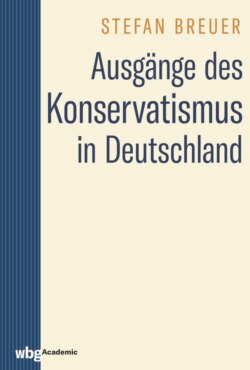Читать книгу Ausgänge des Konservatismus - Stefan Breuer - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV.
ОглавлениеDer Rechtsstaat wie auch der ihm korrespondierende nationalökonomische Zustand, das sah Stahl allerdings genauer als die Liberalen, waren instabile Systeme, die leicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden konnten. Der nationalökonomische Zustand gestaltete sich weniger nach den Vorgaben von Adam Smith, denen zufolge sich die interessegeleiteten Handlungen der Einzelnen durch die unsichtbare Hand des Marktes zu einer harmonischen Einheit fügen sollten, als vielmehr nach denjenigen von Simonde de Sismondi, für den aus der Konkurrenz eine Anhäufung des Reichtums bei Wenigen und eine »Verarmung der großen Masse« resultierten – Folgen, die Eingriffe in den Wirtschaftsprozeß unabdingbar machten, wenn anders die bestehende Ordnung nicht gesprengt werden sollte.120 Insbesondere sei es geboten, der unbedingten Gewerbe- und Handelsfreiheit entgegenzutreten und Maßnahmen zu ergreifen, die »nicht bloß die Möglichkeit künftigen Vermögens in abstracto eröffnen, sondern vor Allem das bestehende Auskommen den Inhabern zu erhalten suchen.«121
Ebenso instabil erschien Stahl der Rechtsstaat, sei er doch der permanenten Gefahr eines ›arbitrary government‹ ausgesetzt122, die ihm gleich von mehreren Seiten drohe: von denjenigen Fraktionen der Partei der Legitimität, die sich entweder dem bürokratischen Absolutismus verschrieben hatten oder theokratischen Ordnungsmodellen anhingen, welche die Eigengesetzlichkeiten von Staat und Recht leugneten und den religiösen Imperativen unmittelbare Geltung verschaffen wollten; aber auch von den Parteien der Revolution, für die Staat und Recht bloße Mittel waren, sei es zur Absicherung der wirtschaftlichen Freiheit (wie die Liberalen), sei es zur Umverteilung des Reichtums (wie die Sozialisten). Stahl lag nicht falsch, wenn er im Unterschied zu späteren Kritikern der konstitutionellen Monarchie wie Carl Schmitt oder Ernst-Wolfgang Böckenförde eine Ausbalancierung der auseinanderstrebenden Kräfte für möglich hielt, wie sie auch von der neueren Verfassungsgeschichtsschreibung anvisiert wird.123 Worin er sich allerdings irrte, war sein Glaube, sich damit noch in der Kontinuität des historischen Konservatismus zu befinden.
Sollte der Rechtsstaat funktionieren, so sein Gedankengang, bedurfte es einer Instanz, die die »Erzwingbarkeit« des Rechts gewährleistete.124 Das aber setzte einen Status derselben voraus, in dem diese »alles Ansehen in sich vereinigt und keinen Richter auf Erden hat« – eine Bedingung, die Stahl in dem modernen, erstmals von Bodin ins Spiel gebrachten Konzept der »Souveränetät« erfüllt sah.125 Zur vollen Entfaltung habe Hobbes dieses Konzept gebracht und sich »ein wahres wissenschaftliches Verdienst« erworben, indem er »den Gedanken der Einheit des Staats im Gegensatze einer bloßen Gesellschaft und, damit zusammenhängend, den Gedanken der Souveränetät […] zuerst in seiner ganzen Tiefe ausgesprochen« habe.126 Seither wisse man, daß der Staat als die »Anstalt zur Beherrschung des gesammten menschlichen Gemeinzustandes […] die Eine, oberste, die souveräne Macht auf Erden« sei, deren Gesetzgebungsmacht keine Grenze gesetzt sei, auch nicht in Form einer richterlichen Kontrolle der verfassungsmäßigen Statthaftigkeit der Verordnungen.127
In dieser Eigenschaft, die sich nach Stahl letztlich ›göttlicher Fügung‹ verdankte, lag jedoch zugleich das Risiko einer Überziehung dieser Macht in Richtung einer »Omnipotenz« bzw. eines »Absolutismus des Staates«.128 Das hatte schon der historische Konservatismus so gesehen und deshalb dafür plädiert, die Abkoppelung des Staates von der Gesellschaft rückgängig zu machen. Stahl hingegen reagierte anders. Er trennte zwischen der souveränen und der absoluten Macht auf Erden, indem er dem Staat unumschränkte Gewalt nur in formeller, nicht in materieller Gewalt zuschrieb. Danach könne der Staat sämtliche Gewohnheiten und Traditionen, »Freiheit, Vortheil, Rechte der Individuen, der Gemeinschaften, der Kirche in der Sphäre, welche überhaupt seiner Anordnung unterliegt«, beliebig ändern, Sachen enteignen oder Rechte abschaffen, und doch mit Grund Verbindlichkeit und Gehorsam für seine Anordnungen erwarten.129 Eine Schranke sollten seine Eingriffe dagegen in jenen Sphären finden, die einer »höheren Ordnung« zugehörten, worunter Stahl keineswegs nur die religiösen Überzeugungen verstand, sondern auch die »politische Gesinnung«, die Freiheit der Berufswahl oder die Erziehung. Zwar schlug der formelle Anspruch auf Gehorsam auch hier insofern durch, als die staatlichen Anordnungen nicht aktiv durchkreuzt werden durften, doch stehe den Betroffenen »die Protestation und der passive Widerstand« zu.130
Optimal verwirklicht war diese temperierte Form der Souveränität in Staaten, die sich dem »monarchischen Prinzip« unterworfen hatten. War die Souveränität »ein reiner und unmittelbarer Rechtsbegriff«, so bezeichnete das monarchische Prinzip »eine thatsächliche Stellung«131, die, mit Max Weber zu reden, in der Sphäre des realen Geschehens anstatt in derjenigen des ›ideellen Geltensollens‹ lag, daher auch lediglich »empirische Geltung« beanspruchen konnte.132 Es gewährte dem Herrscher die Kompetenz zur Abfassung der Gesetze, zur alleinigen Durchführung der Administration und zur Verfügung über die dafür erforderlichen Mittel, räumte aber zugleich den hiervon Betroffenen bzw. ihren Vertretern, den »Reichsständen«, Rechte ein, die sowohl Schutzmittel zur Einhaltung der Verfassung betrafen als auch eine Mitwirkung an der Gesetzgebung ermöglichten.133 Unter den fortgeschrittenen Bedingungen der Gegenwart seien die Stände nicht mehr auf die Geltendmachung isolierter Befugnisse beschränkt, vielmehr komme ihnen »die große mächtige Bedeutung [zu], den gesammten öffentlichen Rechtszustand zu schützen, sie sind die Wächter und Garanten für Erhaltung und Beobachtung der Gesetze, für Ordnung und gesetzmäßige Verwendung im Staatshaushalte und üben eine moralische Macht der Anregung und Fortbildung.«134
Die Gefahr, daß die Balance nach der einen oder anderen Seite kippte, wollte Stahl nicht grundsätzlich in Abrede stellen. Es erschien ihm jedoch möglich, dagegen ein hinreichendes Maß an Sicherungen zu mobilisieren. Die herausgehobene Stellung des Fürsten legitimierte er nicht allein mit dessen Funktionen, sondern auch mit religiösen und nicht zuletzt ästhetischen Argumenten, die die Kategorie des »Erhabenen« bemühten, um den Anstalten »eine höhere Bedeutung« zuzuschreiben, seien diese doch nicht allein durch menschliche Zwecke bestimmt, sondern auch durch das »Urbild«, das sie darstellen sollten. Stahl zögerte deshalb nicht, sich die von Schelling erhobene Forderung zu eigen zu machen, »daß der Staat ein Kunstwerk sey, daß Schönheit des öffentlichen Lebens, große, erhabene Einrichtungen bestehen, um ihretwillen, nicht um irgend ein Individuum als letzten Zweck zu befriedigen.«135 Vor allen anderen Staatsformen habe die Monarchie den »Vorzug der Ursprünglichkeit und Erhabenheit der Herrschaft«, der darin liege, daß ihre Gewalt »nicht von den Unterthanen kommt, sondern von sich selbst besteht« und daraus ihren Anspruch auf Pietät, Ehrfurcht und Gehorsam bezieht.136 Im Konfliktfall sollte deshalb der Krone, und nur ihr, »die letzte Entscheidung« zustehen.137
Als Gegengewichte hierzu dachte sich Stahl Institutionen wie die Hausherrschaft und die durch Ausbau der Fideikommisse zu festigende, zugleich aber nicht mehr kastenartig abgeschlossene Grundherrschaft138, die ständische Gliederung sowie nicht zuletzt die christlichen Kirchen139, beruhten doch auf dem Christentum das Ansehen des Königtums, das Bildungs- und Erziehungswesen, die »Harmonie nationaler Einheit und ständischer Gestaltung, staatsbürgerlicher Gleichheit und verschiedener Berufsstellung mit besonderer Berechtigung und Ehre«.140 Um ganz sicher zu gehen, verlangte allerdings auch Stahl eine förmliche Garantie dieser stabilisierenden Faktoren durch ein Staatsgrundgesetz (Konstitution), das nicht einseitig, sondern nur durch den Fürsten und die Landesvertretung zusammen zu ändern sei.141
Für die Vertretung der Stände war ein Zweikammersystem vorzusehen, das den »Gegensatz herrschaftlicher und gemeiner (d. i. nicht-herrschaftlicher Stellung)« repräsentieren sollte.142 Für die Erste Kammer, das Oberhaus, kam Stahl den Ideologen der Restauration insoweit entgegen, als er der erblichen Pairie einen Anteil einräumte, den er jedoch an anderer Stelle gleich wieder zurücknahm.143 Wichtiger erschien ihm eine Repräsentation der »mächtigsten Elemente des Landes«, die sich aus der Ritterschaft und den Städten rekrutierten: eine Gruppe, die in der Gegenwart allein noch repräsentierte, was in früheren Zeiten die Geburtsaristokratie gewährte, »aber jetzt nicht mehr vermag: eine starke konservative Macht und eine starke Stütze der Krone.«144 Auch die Zweite Kammer sollte überwiegend aristokratischen Zuschnitts sein, jedoch so, daß im Unterschied zur Ersten Kammer die Prinzipien Vorrang vor den Interessen haben würden. Das implizierte nach der negativen Seite die Ausscheidung des Geburtsadels, der Stahl allzusehr auf sein ständisches Interesse fixiert und auf Abgeschlossenheit bedacht zu sein schien; nach der positiven Seite eine Abbildung des wirklichen Machtverhältnisses der Stände, die freilich je nach Land unterschiedlich ausfallen konnte.145 Für Preußen sah Stahl eine »Führerschaft der Aristokratie« als gegeben an, von der allerdings zu verlangen sei, daß sie sich nicht exklusiv gegenüber den übrigen Ständen, namentlich der nichtadeligen Ritterschaft und den höheren bürgerlichen Ständen verhalte, im übrigen auch berücksichtige, daß »ihre Abordnung durch die ganze ländliche Bevölkerung, mit der sie zusammenschließt, mit bedingt ist«. Halte sie sich an diese Maximen, sei ihre Führerschaft gerechtfertigt, sei diese doch mitnichten ein traditional überkommenes Privileg, sondern funktional begründet.146 Von einer nach diesen Bauprinzipien gestalteten Landesvertretung zeigte sich Stahl überzeugt, daß sie sich von »einer Macht der Zersetzung in eine Macht der Erhaltung« verwandeln werde, »daß sie wie sonst den revolutionären Fortschritt so den geschichtlichen Zustand vertrete und eine Bürgschaft der Stetigkeit gewähre, daß sie wie sonst der Nebenbuhler der Krone so der treue Wächter der Krone sey, und daß sie hierdurch auch im Lande eine konservative Partei hervorrufe und ihr als Mittelpunkt und Wegweiser diene.«147
Der hier anvisierte Konservatismus hatte freilich mit dessen historisch überlieferten Gestalten nur noch wenig gemein. Er rechnete bereits mit der Trennung von Staat und Gesellschaft und damit der Dekomposition der societas civilis, unterstellte eine nach den Regeln des Marktes und der Konkurrenz operierende Eigendynamik der Gesellschaft einschließlich der Aristokratie und trug auch sonst dem Prozeß der funktionalen Differenzierung Rechnung, etwa im Verhältnis von Recht und Moral, von Staat und Kirche148, auch wenn Stahl, erschrocken vor der eigenen Kühnheit, wieder zurückruderte und verlangte, die bürgerliche Gesetzgebung mit der kirchlichen in größeren Einklang zu bringen oder die Wechselwirkung des Sozialen und des Politischen zu beachten.149 Stahl mochte sich noch so stark dafür machen, die Elemente, »die auf dem Bande zu der Vergangenheit ruhen« gegen alle diejenigen zu verteidigen, »welche nach einer neuen Zukunft drängen«, er mochte noch so sehr darauf insistieren, den Vorrang des ›hervorragenden Reichtums‹ vor den mittleren und ärmeren Ständen zu sichern.150 Am Ende war, was er als »das konservative Princip« offerierte, nicht sehr viel mehr als »eine gewisse Vorliebe für das Bestehende und ein Streben nach langsamerem Gange der Veränderung.«151 Und da dieses Bestehende seit Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend durch die moderne bürgerliche Gesellschaft und ihren Staat bestimmt war, spricht dies für Deutungen, die in Stahl eher den »Totengräber« des Konservatismus sehen als dessen »Chefideologen«.152 Aber das war eine Einsicht, der sich nicht bloß zu Stahls Zeiten die Akteure gern verschlossen, so daß dieses Buch hier noch nicht zu Ende sein kann.